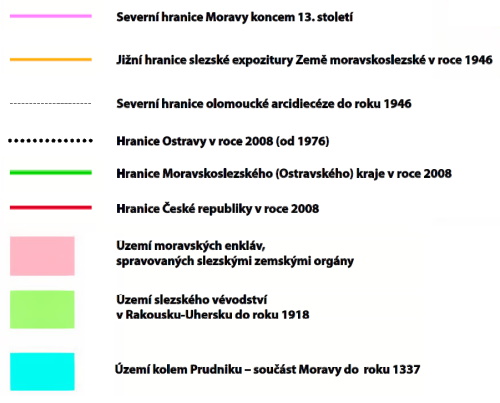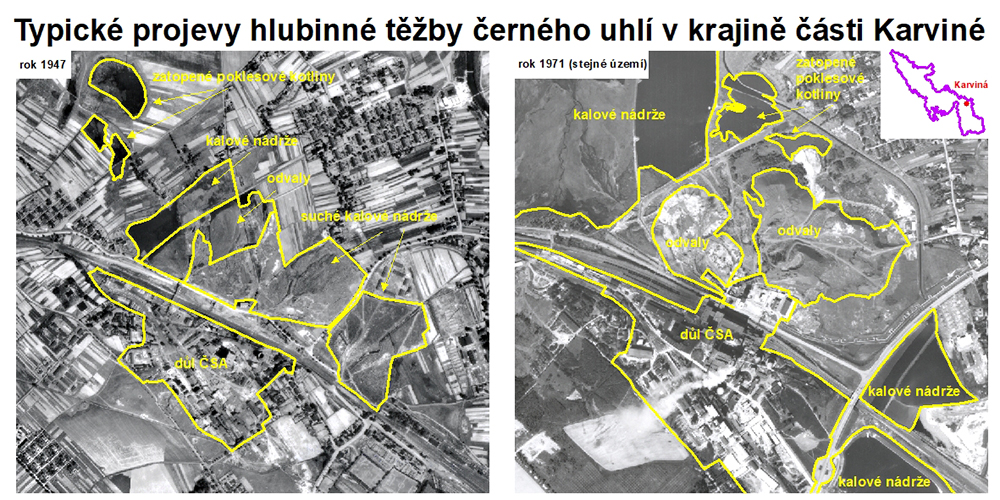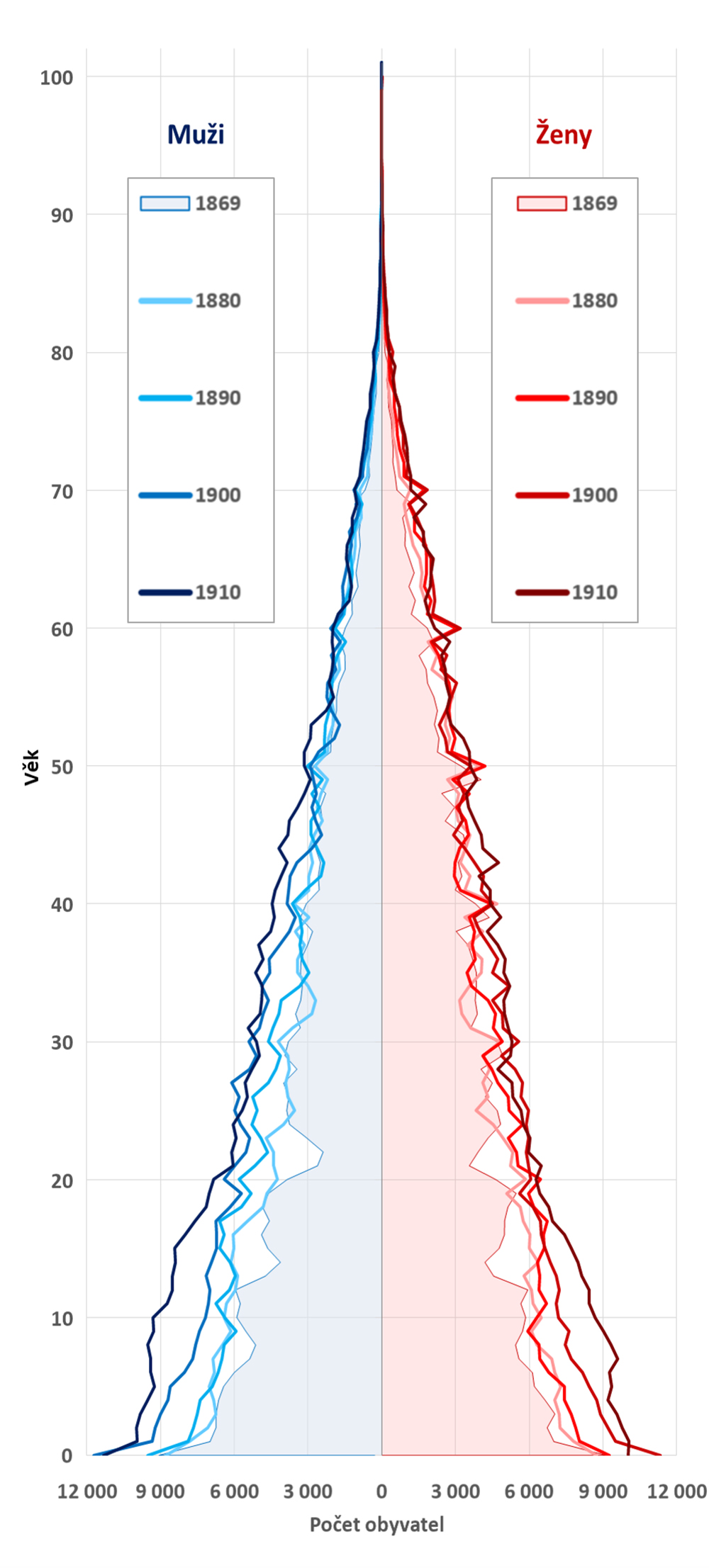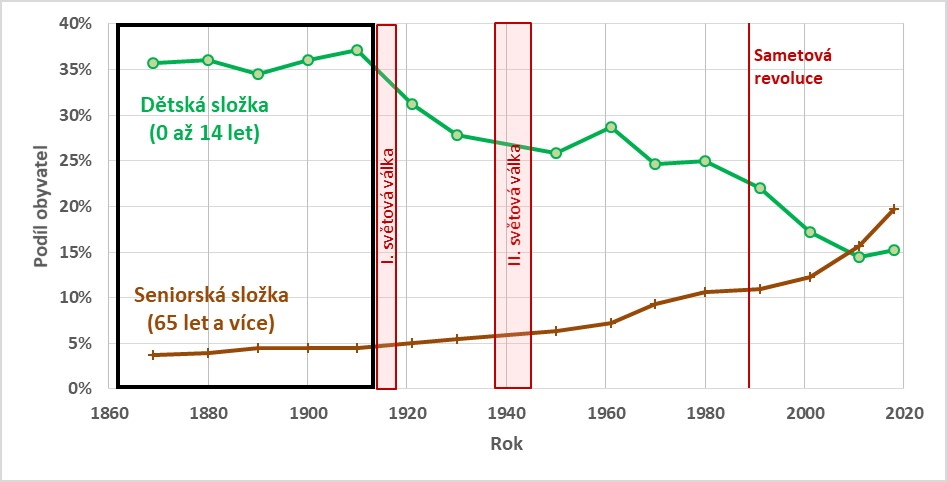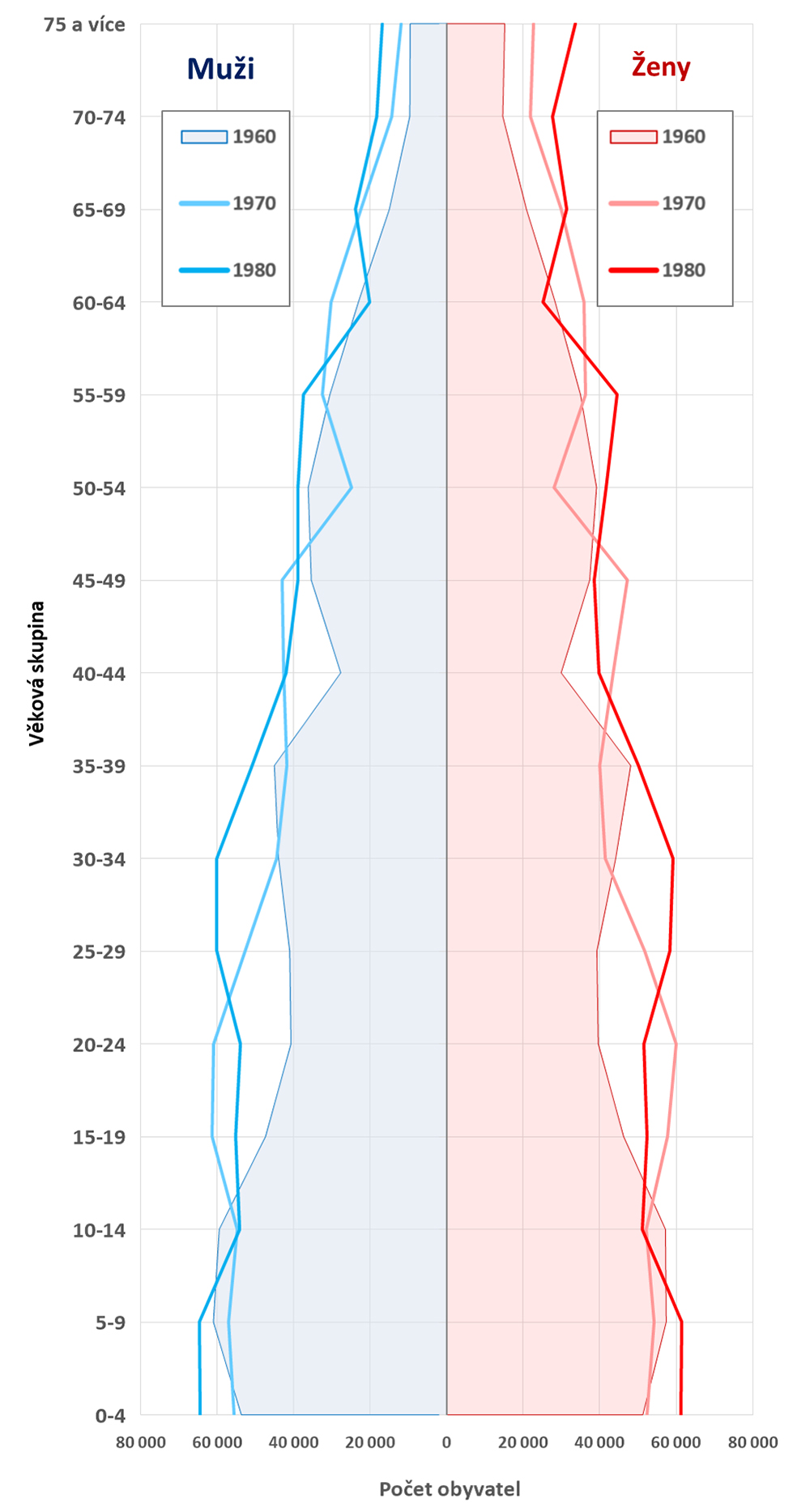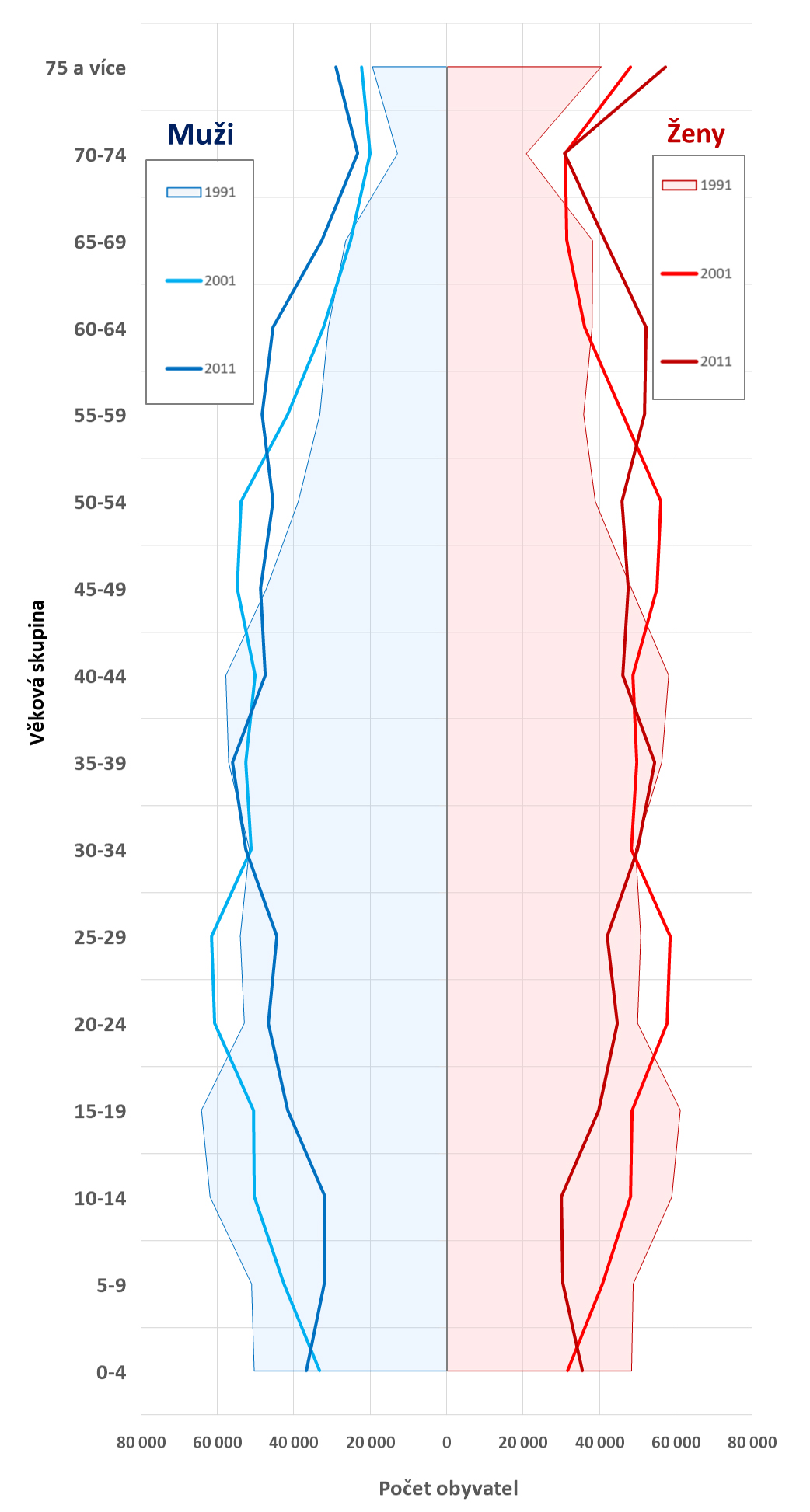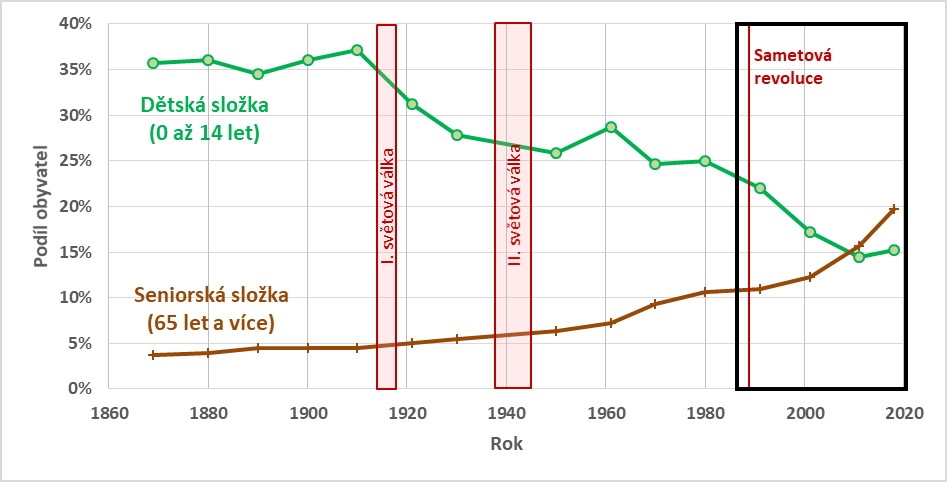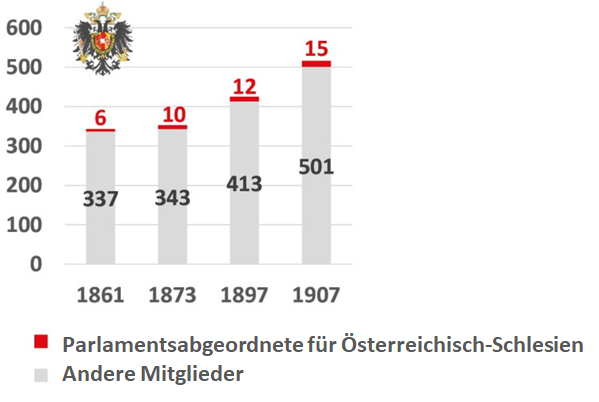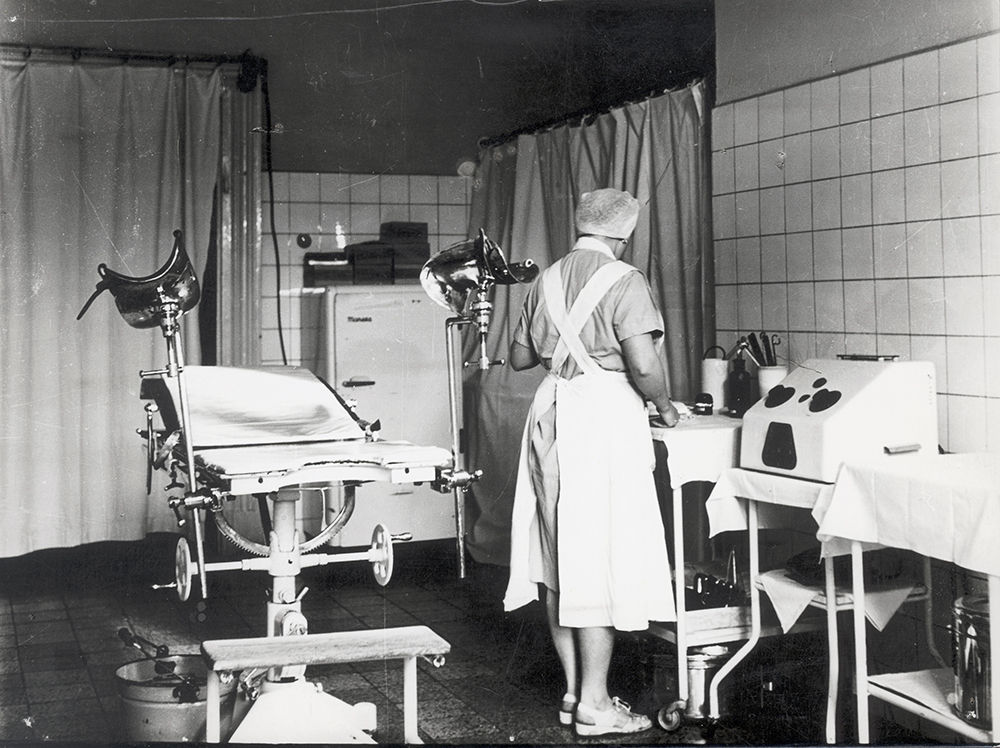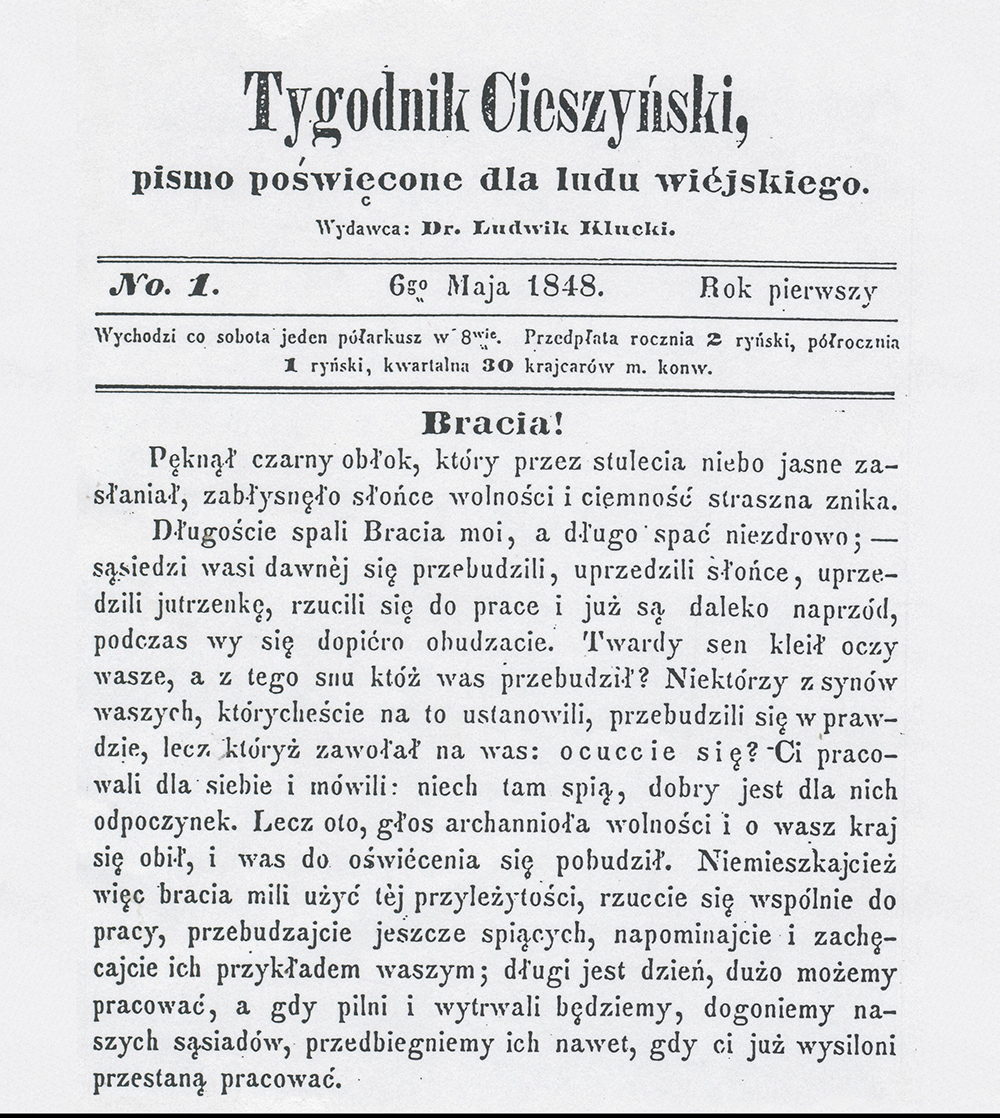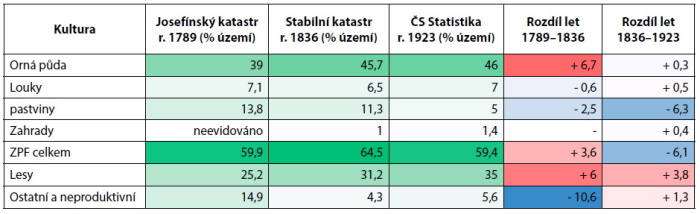Der große historische Atlas
von Tschechisch-Schlesien
Identität, Kultur und Gesellschaft Tschechisch-Schlesiens
im Prozess der gesellschaftlichen Modernisierung mit Auswirkungen auf die Kulturlandschaft
Lubor Hruška, Lenka Jarošová, Radek Lipovski (eds.)
ACCENDO - Zentrum für Wissenschaft und Forschung
Ostrava
2021
Diese Publikation erscheint im Rahmen des Projektes DER GROSSE HISTORISCHE ATLAS TSCHECHISCH-SCHLESIENS - Identität, Kultur und Gesellschaft Tschechisch-Schlesiens im Prozess der gesellschaftlichen Modernisierung mit Auswirkungen auf die Kulturlandschaft; Projektkennzeichen: DG18P02OVV047; das Projekt wird aus dem Programm zur Förderung der angewandten Forschung und experimentellen Entwicklung der nationalen und kulturellen Identität für die Jahre 2016 bis 2022 (NAKI II) finanziert.
Gegenstand des Projektes ist eine umfassende Kartierung der historischen Prozesse, die die Bevölkerung und die Landschaft vor allem nach 1848 bis in die Gegenwart auf dem Gebiet Tschechish-Schlesiens und des territorial zusammenhängenden "Mährischen Keils" beeinflusst haben. Es handelt sich um ein synthetisierendes multidisziplinäres Projekt, das Geschichte, Demographie, Soziologie, Wirtschaft, Stadtplanung und Naturwissenschaften miteinander verbindet. Das Projekt integriert die Erkenntnisse aus früheren Forschungsprojekten dreier Institutionen, die sich auf das Gebiet Tschechish-Schlesiens konzentrieren, und ergänzt sie durch weitere notwendige Forschungen. Diese Synthese wird eine neue Perspektive auf die Entwicklung des Territoriums bieten, das innerhalb des mitteleuropäischen Raumes großen historischen Veränderungen unterworfen war, einschließlich der Interaktion zwischen Gesellschaft und Landschaft, der Landschaftsverwaltung (Geschichte der Forst- und Landwirtschaft) und anderer Prozesse im Territorium (Auswirkungen des Bergbaus, des Krieges auf die Landschaft). Das multidisziplinäre Forschungsteam hat das Potenzial, völlig neue Kausalitäten zwischen historischen Prozessen und dem aktuellen Zustand von Gesellschaft und Landschaft zu identifizieren (mehr Informationen auf der Projektwebsite : http://atlas-slezska.cz/).
Projektlöser: das ACCENDO - Zentrum für Wissenschaft und Forschung, z. ú.
Mitlöser: Das Schlesische Landesmuseum
Mitlöser: Philosophische Fakultät, Universität Ostrava
In Zusammenarbeit mit: Museum der Region Teschen, Zuschussorganisation
Schlüsselwörter: Schlesien, Geschichte, Landschaft, Kultur, Identität
Herausgeber: Lubor Hruška – Lenka Jarošová – Radek Lipovski
Rezensenten:
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – Schlesische Universität in Opava, Fachbereich für historische Wissenschaften
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. – VŠB – Technische Universität Ostrava, Institut für Umwelttechnologien
Autorenteam:
Jiří Brňovják, Lukáš Číhal, Lumír Dokoupil, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Dan Gawrecki, Tomáš Herman, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Ludmila Nesládková, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná
Kartografische Ausgaben:
Igor Ivan, David Kubáň, Peter Golej, Ondřej Kolodziej
Gegenstand des Projektes ist eine umfassende Kartierung der historischen Prozesse, die die Bevölkerung und die Landschaft vor allem nach 1848 bis in die Gegenwart auf dem Gebiet Tschechish-Schlesiens und des territorial zusammenhängenden "Mährischen Keils" beeinflusst haben. Es handelt sich um ein synthetisierendes multidisziplinäres Projekt, das Geschichte, Demographie, Soziologie, Wirtschaft, Stadtplanung und Naturwissenschaften miteinander verbindet. Das Projekt integriert die Erkenntnisse aus früheren Forschungsprojekten dreier Institutionen, die sich auf das Gebiet Tschechish-Schlesiens konzentrieren, und ergänzt sie durch weitere notwendige Forschungen. Diese Synthese wird eine neue Perspektive auf die Entwicklung des Territoriums bieten, das innerhalb des mitteleuropäischen Raumes großen historischen Veränderungen unterworfen war, einschließlich der Interaktion zwischen Gesellschaft und Landschaft, der Landschaftsverwaltung (Geschichte der Forst- und Landwirtschaft) und anderer Prozesse im Territorium (Auswirkungen des Bergbaus, des Krieges auf die Landschaft). Das multidisziplinäre Forschungsteam hat das Potenzial, völlig neue Kausalitäten zwischen historischen Prozessen und dem aktuellen Zustand von Gesellschaft und Landschaft zu identifizieren (mehr Informationen auf der Projektwebsite : http://atlas-slezska.cz/).
Projektlöser: das ACCENDO - Zentrum für Wissenschaft und Forschung, z. ú.
Mitlöser: Das Schlesische Landesmuseum
Mitlöser: Philosophische Fakultät, Universität Ostrava
In Zusammenarbeit mit: Museum der Region Teschen, Zuschussorganisation
Schlüsselwörter: Schlesien, Geschichte, Landschaft, Kultur, Identität
Herausgeber: Lubor Hruška – Lenka Jarošová – Radek Lipovski
Rezensenten:
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – Schlesische Universität in Opava, Fachbereich für historische Wissenschaften
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. – VŠB – Technische Universität Ostrava, Institut für Umwelttechnologien
Autorenteam:
Jiří Brňovják, Lukáš Číhal, Lumír Dokoupil, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Dan Gawrecki, Tomáš Herman, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Ludmila Nesládková, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná
Kartografische Ausgaben:
Igor Ivan, David Kubáň, Peter Golej, Ondřej Kolodziej
Eine interaktive Version des Atlasses in vier Sprachen (Tschechisch, Polnisch, Englisch und Deutsch) finden Sie unter: http://mapa.atlas-slezska.cz
Neben öffentlich zugänglichen Webquellen haben die Autoren des ATLASSES auch private Quellen genutzt. Die Autoren des ATLASSES bedanken sich bei den folgenden Institutionen und Personen für die Erlaubnis, ihre Mittel, Sammlungen und Fotos für die Erstellung der Bildteile des ATLASSES zu verwenden. Fotografien und Karten © Stadtarchiv Ostrava - Statutarische Stadt Ostrava; Archiv des Innenministeriums der Tschechischen Republik, Prag; Tschechisches Amt für Vermessungswesen und Kartographie , Prag; Tschechoslowakische Hussitenkirche; Museum Śląska Cieszyńskiego; Museum der Region Teschen; Nationalmuseum, Prag; Religionsgemeinschaft der Tschechoslowakischen Hussitenkirche, Ostrava-Radvanice; Nationales Kulturerbe-Institut; Niederösterreichisches Landesarchiv St. Pölten; Gemeindeamt Sedliště; Schlesisches Landesmuseum; Zentralarchiv für Vermessung und Kartographie, Prag; Landesarchiv Opava;, Staatliches Bezirksarchiv Bruntál mit Sitz in Krnov; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Frýdek-Místek; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Jeseník; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Karviná; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Nový Jičín; Wagenmuseum in Studénka, Militäramt für Geographie und HydrometeorologieDobruška und M. Anděra; D. Baránek; O. Boháč; J. Bohdal; J. Brňovják; L. Číhal; J. Hamza; J. Horáková; V. Hrazdil; M. Hykel; T. Indruch; R. Janda; L. Jarošová; Z. Jordanidu; J. Juchelka; S. Juga; J. Jung; Z. Kittrich; O. Klusák; J. Kristiánová; J. Křesina; P. Koudelka; O. Kolář; I. Kozelek; J. Kubica; P. Lazárková; I. Lička; B. Lojkásek; J. Mach; K. Müller; F. Nesvadba; M. Pešata; M. Pietoň; D. Pindur; Z. Pohoda; A. Pokludová; M. Polák; M. Polášek; A. Pončová; A. Prágr; P. Proske; A. Pustka; L. Pustka; Š. Rak; V. Reichman; J. Roháček; P. Rödl; D. Saktorová; J. Sejkora; E. Schweserová; F. Sokol; J. Solnický; P. Suvorov; K. Šimeček; M. Šišmiš; P. Šopák; M. Šos; V. Švorčík; T. Urbánková; J. Vaněk; L. Wünsch; J. Zajíc; I. Zwach.
Die Luftaufnahmen (I. Kozelek - T. Indruch) wurden im Rahmen des Projektes "Die tschechisch-polnische Grenzregion aus der Vogelperspektive" aufgenommen. Das Projekt wurde im Jahr 2011 von der Stadt Krnov in Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Hlubčice mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung umgesetzt..
Neben öffentlich zugänglichen Webquellen haben die Autoren des ATLASSES auch private Quellen genutzt. Die Autoren des ATLASSES bedanken sich bei den folgenden Institutionen und Personen für die Erlaubnis, ihre Mittel, Sammlungen und Fotos für die Erstellung der Bildteile des ATLASSES zu verwenden. Fotografien und Karten © Stadtarchiv Ostrava - Statutarische Stadt Ostrava; Archiv des Innenministeriums der Tschechischen Republik, Prag; Tschechisches Amt für Vermessungswesen und Kartographie , Prag; Tschechoslowakische Hussitenkirche; Museum Śląska Cieszyńskiego; Museum der Region Teschen; Nationalmuseum, Prag; Religionsgemeinschaft der Tschechoslowakischen Hussitenkirche, Ostrava-Radvanice; Nationales Kulturerbe-Institut; Niederösterreichisches Landesarchiv St. Pölten; Gemeindeamt Sedliště; Schlesisches Landesmuseum; Zentralarchiv für Vermessung und Kartographie, Prag; Landesarchiv Opava;, Staatliches Bezirksarchiv Bruntál mit Sitz in Krnov; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Frýdek-Místek; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Jeseník; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Karviná; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Nový Jičín; Wagenmuseum in Studénka, Militäramt für Geographie und HydrometeorologieDobruška und M. Anděra; D. Baránek; O. Boháč; J. Bohdal; J. Brňovják; L. Číhal; J. Hamza; J. Horáková; V. Hrazdil; M. Hykel; T. Indruch; R. Janda; L. Jarošová; Z. Jordanidu; J. Juchelka; S. Juga; J. Jung; Z. Kittrich; O. Klusák; J. Kristiánová; J. Křesina; P. Koudelka; O. Kolář; I. Kozelek; J. Kubica; P. Lazárková; I. Lička; B. Lojkásek; J. Mach; K. Müller; F. Nesvadba; M. Pešata; M. Pietoň; D. Pindur; Z. Pohoda; A. Pokludová; M. Polák; M. Polášek; A. Pončová; A. Prágr; P. Proske; A. Pustka; L. Pustka; Š. Rak; V. Reichman; J. Roháček; P. Rödl; D. Saktorová; J. Sejkora; E. Schweserová; F. Sokol; J. Solnický; P. Suvorov; K. Šimeček; M. Šišmiš; P. Šopák; M. Šos; V. Švorčík; T. Urbánková; J. Vaněk; L. Wünsch; J. Zajíc; I. Zwach.
Die Luftaufnahmen (I. Kozelek - T. Indruch) wurden im Rahmen des Projektes "Die tschechisch-polnische Grenzregion aus der Vogelperspektive" aufgenommen. Das Projekt wurde im Jahr 2011 von der Stadt Krnov in Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Hlubčice mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung umgesetzt..
© ACCENDO - Zentrum für Wissenschaft und Forschung, 2021
Inhaltsverzeichnis
Liste der Abkürzungen
| a. v. | Augsburger Bekenntnis |
| AMO | Archiv der Stadt Ostrau - Statutarische Stadt Ostrau |
| AOPK | Naturschutzbehörde der Tschechischen Republik |
| c. k. | kaiserlich-königlich |
| ČCE | Tschechische Evangelische Kirche |
| CČS | Kirche der Tschechoslowakei |
| CČSH | Tschechoslowakische Hussitenkirche |
| ČR | Tschechische Republik |
| ČSAD | Tschechoslowakischer Automobiltransport |
| ČSD | Tschechoslowakische Eisenbahnen |
| ČSR | Tschechoslowakische Republik |
| ČSSS | Tschechoslowakische Staatliche Bauernhöfe |
| ČSTV | Tschechoslowakischer Verband für Leibeserziehung und Sport |
| ČSÚ | Tschechisches Statistisches Amt |
| ČÚZK | Tschechisches Amt für Vermessung und Kartographie |
| DMR | Digitales Höhenmodell |
| CHKO | Landschaftsschutzgebiet |
| JZD | Landwirtschaftliche Genossenschaft |
| k. ú. | Katastergebiet |
| KSČ | Kommunistische Partei der Tschechoslowakei |
| KBD | Eisenbahn Košice-Bohumín |
| LECAV | Lutherische Evangelische Kirche des Augsburger Bekenntnisses in der Tschechischen Republik |
| LFA | weniger begünstigte Gebiete |
| MHD | öffentlicher Nahverkehr |
| MLL | Masaryk Flugliga |
| MT | Museum Teschen |
| MSK | Region Mährisch-Schlesien |
| MŚC | Museum Śąska Cieszyńskiego |
| MU | Masaryk-Universität |
| MV ČR | Ma Innenministerium der Tschechischen Republik |
| MZV ČR | Außenministerium der Tschechischen Republik |
| n. p. | nationales Unternehmen |
| NDVI | Normalized Difference Vegetation Index |
| NHKG | Nová hut' Klementa Gottwalda |
| NM | Nationalmuseum |
| NPR | Nationales Naturschutzgebiet |
| NPÚ | Nationales Institut für Kulturerbe |
| OKD | Bergwerke Ostrava-Karviná |
| OKR | Ostrava-Carvinský revír |
| OLK | Region Olomouc |
| OU | Universität Ostrau |
| OÚ | Gemeindeverwaltung |
| ÖNB | Österreichische Nationalbibliothek Wien |
| PR | Naturschutzgebiet |
| PřF | Fakultät für Naturwissenschaften |
| RVHP | Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe |
| s. o. | Gerichtsbezirk |
| s. p. | Staatsbetrieb |
| s. r. o. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| SCEAV | Schlesische Evangelische Kirche des Augsburger Bekenntnisses |
| SLDB | Volkszählung, Häuser und Wohnungen |
| SO OPR | Verwaltungsbezirk einer Gemeinde mit erweiterter Zuständigkeit |
| SOkA Bruntál | Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Bruntál mit Sitz in Krnov |
| SOkA Frýdek-Místek | Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Frýdek-Místek |
| SOkA Jeseník | Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Jeseník |
| SOkA Karviná | Landesarchiv Karviná in Opava, Staatliches Bezirksarchiv Karviná |
| SOkA Nový Jičín | Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Nový Jičín |
| StS | State Farm |
| SZM | Schlesisches Landesmuseum |
| SZEŠ | Landwirtschaftliche Mittelschule |
| SZTŠ | Höhere landwirtschaftliche Fachschule |
| ÚAZK | Zentralarchiv für Vermessung und Kataster |
| VGHMÚř | Militärisches geographisches und hydrometeorologisches Amt Dobruška |
| VOKD | Construction - Bergwerke Ostrava-Karviná |
| z. ú. | eingetragenes Institut |
| ZAO | Landesarchiv Opava |
| zl | Zloty |
| ZPF | Fonds für landwirtschaftliche Flächen |
| ŽNO | Jüdische Religionsgemeinschaf |
Unterregionen von Tschechisch-Schlesien
Begründung der Schriftform der Verbindung zwischen Tschechish-Schlesien, Österreichisch-Schlesien, Preußisch-Schlesien und Teschener-Schlesien
Heutzutage begegnen wir verschiedenen Varianten der schriftlichen Form des Ausdrucks " TSCHECHISH-SCHLESIEN". Die Argumente beruhen einerseits auf der Übereinstimmung mit der aktuellen Form der sprachlichen Kodifizierung, andererseits suchen sie Halt in der gewohnheitsmäßigen Verwendung ähnlicher Namen (z.B. Österreichisch-Schlesien) in der Schrift. Das Autorenkollektiv hat sich entschieden, sich an die derzeit gültige Grammatik der tschechischen Sprache zu halten, und deshalb verwenden wir im Text die Formulierung Tschechisch-Schlesien. Im Folgenden stellen wir kurz die Argumente für diese Entscheidung dar. Es handelt sich um einen Zwei-Wort-Namen, der aus einem Adjektiv und einem Eigennamen besteht, wobei der Eigenname nicht Teil des geografischen Namens ist und nur die nähere Lokalisierung des durch den Eigennamen bezeichneten Gebiets angibt (ähnliches Beispiel Opauer Schlesien = das Gebiet in Schlesien um die Stadt Opava). Gleichzeitig kann bei der schriftlichen Form der Bezeichnung " Tschechish- Schlesien" die Regel für die Kombination eines Adjektivs und des Namens einer Region, Mikroregion oder Euroregion nicht angewendet werden, wie im Fall von Teschener-Schlesien, das seit 1998 dank der Einführung eines Europrogramms zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesem Bereich eine Euroregion ist. Letztlich können wir uns nicht auf die Regel verlassen, historische Namen von Staaten zu schreiben, wie im Fall von Österreichisch-Schlesien, das durch kaiserliche Entscheidung in den Jahren 1850-1918 zu einem der Kronländer des österreichisch-ungarischen Reiches mit der Hauptstadt Opava wurde (man beachte, dass wir hier auch sprachlich abwägen können, da der offizielle Name dieses Herzogtums Ober- und Niederschlesien war).
Im Anschluss an die oben genannten Argumente und unter Berücksichtigung des primären Ziels der Autoren, die historischen Prozesse, die die Bevölkerung und die Landschaft vor allem nach 1848 bis in die Gegenwart auf dem Gebiet von Tschechish- Schlesien und des territorial zusammenhängenden "Mährischen Keils" beeinflusst haben, umfassend abzubilden, entschied sich das Autorenteam, die Schriftform des österreichischen, preußischen und teschener Schlesiens in gleicher Weise anzuwenden. Für die ersten beiden stützen wir uns auf das Argument des Fehlens eines offiziellen historischen Namens; für Teschener Schlesien arbeiten wir mit einer anderen zeitlichen und räumlichen Definition als die aktuelle Euroregion.
Heutzutage begegnen wir verschiedenen Varianten der schriftlichen Form des Ausdrucks " TSCHECHISH-SCHLESIEN". Die Argumente beruhen einerseits auf der Übereinstimmung mit der aktuellen Form der sprachlichen Kodifizierung, andererseits suchen sie Halt in der gewohnheitsmäßigen Verwendung ähnlicher Namen (z.B. Österreichisch-Schlesien) in der Schrift. Das Autorenkollektiv hat sich entschieden, sich an die derzeit gültige Grammatik der tschechischen Sprache zu halten, und deshalb verwenden wir im Text die Formulierung Tschechisch-Schlesien. Im Folgenden stellen wir kurz die Argumente für diese Entscheidung dar. Es handelt sich um einen Zwei-Wort-Namen, der aus einem Adjektiv und einem Eigennamen besteht, wobei der Eigenname nicht Teil des geografischen Namens ist und nur die nähere Lokalisierung des durch den Eigennamen bezeichneten Gebiets angibt (ähnliches Beispiel Opauer Schlesien = das Gebiet in Schlesien um die Stadt Opava). Gleichzeitig kann bei der schriftlichen Form der Bezeichnung " Tschechish- Schlesien" die Regel für die Kombination eines Adjektivs und des Namens einer Region, Mikroregion oder Euroregion nicht angewendet werden, wie im Fall von Teschener-Schlesien, das seit 1998 dank der Einführung eines Europrogramms zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesem Bereich eine Euroregion ist. Letztlich können wir uns nicht auf die Regel verlassen, historische Namen von Staaten zu schreiben, wie im Fall von Österreichisch-Schlesien, das durch kaiserliche Entscheidung in den Jahren 1850-1918 zu einem der Kronländer des österreichisch-ungarischen Reiches mit der Hauptstadt Opava wurde (man beachte, dass wir hier auch sprachlich abwägen können, da der offizielle Name dieses Herzogtums Ober- und Niederschlesien war).
Im Anschluss an die oben genannten Argumente und unter Berücksichtigung des primären Ziels der Autoren, die historischen Prozesse, die die Bevölkerung und die Landschaft vor allem nach 1848 bis in die Gegenwart auf dem Gebiet von Tschechish- Schlesien und des territorial zusammenhängenden "Mährischen Keils" beeinflusst haben, umfassend abzubilden, entschied sich das Autorenteam, die Schriftform des österreichischen, preußischen und teschener Schlesiens in gleicher Weise anzuwenden. Für die ersten beiden stützen wir uns auf das Argument des Fehlens eines offiziellen historischen Namens; für Teschener Schlesien arbeiten wir mit einer anderen zeitlichen und räumlichen Definition als die aktuelle Euroregion.
Einleitung
Das Gebiet von Tschechish-Schlesien bildet heute eine sehr vielfältige Region, die sich aus mehreren Regionen zusammensetzt: den Regionen Opava, Hlučín, Ostrava, Těšín und Jesenice. Der überwiegende Teil des Gebietes liegt in der Mährisch-Schlesischen Region, das westliche Ende (Jesenicko) in der Region Olomouc. In der gegenwärtigen Verwaltungsstruktur der Tschechischen Republik sind die Grenzen nicht einfach zu definieren, da die Grenzen von Tschechish-Schlesien derzeit das Gebiet mehrerer Gemeinden und Städte (z.B. Ostrava, Frýdek-Místek) durchqueren. Der Abdruck des historischen Gedächtnisses von Schlesien ist hier immer noch offensichtlich, sowohl im Siedlungsmuster, der Landschaft und der schöpferischen menschlichen Tätigkeit in ihr, als auch in den Köpfen der Menschen, die in diesem Gebiet leben, in ihren Bräuchen, Werten und der Kultur.
Der "Große Historische Atlas von Tschechish-Schlesien" (ATLAS) wurde von einem multidisziplinären Team von Experten aus den Bereichen Geschichte, Demographie, Soziologie, Ökonomie, Stadtplanung und Naturwissenschaften erstellt. Durch die Synthese des Expertenwissens, das im ATLAS benutzerfreundlich interpretiert wird, ist ein umfassendes Bild der Entwicklung eines Gebietes entstanden, das innerhalb des mitteleuropäischen Raumes oft großen historischen Veränderungen unterworfen war. Als Schlesische Kriege werden die drei militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem Königreich Preußen und der Habsburgermonarchie bezeichnet, die zwischen 1740 und 1763 um die Kontrolle der ehemals österreichischen Region Schlesien ausgetragen wurden. Infolge dieser Auseinandersetzungen wurde Schlesien in einen österreichischen und einen preußischen Teil geteilt (die heute noch leben und im Volksmund als "Kaiser" und "Preuße" bezeichnet werden). Zur Zeit des Zusammenbruchs der österreichisch-ungarischen Monarchie kam es auch zwischen den neu entstandenen Staaten Tschechoslowakei und Polen zu einem Streit um Teschen. Ein weiteres bedeutendes Ereignis in der Transformation des Territoriums war die Umsiedlung der Einwohner nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, von der vor allem die Region Jeseníky betroffen war. All diese Ereignisse hatten einen großen Einfluss auf das historische Gedächtnis der dort lebenden Bewohner, auf die Wahrnehmung ihrer Identität mit dem Gebiet und auf die soziokulturelle Entwicklung.
Der ATLAS integriert das Wissen aus Forschungsprojekten mehrerer Institutionen, die sich auf das Gebiet von Teschener-Schlesien konzentrieren. Diese Institutionen sind ACCENDO - Zentrum für Wissenschaft und Forschung, z. ú., die Kunstfakultät der Universität Ostrava, das Schlesische Museum, insbesondere sein Schlesisches Institut. Wichtig für die Entstehung des ATLASSES war auch die Zusammenarbeit mit dem Museum in Těšínsko.
Der ATLAS besteht aus einem Satz kommentierter Karten, die das Gebiet von Teschener-Schlesien in sieben Abschnitten darstellen, die sich mit der physischen Geographie, der historischen Geographie, der Demographie, der soziokulturellen Entwicklung, den wirtschaftlichen Prozessen, der Landschaftsentwicklung und der Identität der Bewohner des Gebietes beschäftigen. Das multidisziplinäre Team hatte dank seiner bisherigen langjährigen beruflichen Erfahrung mit Arbeiten zu den oben genannten Themen das Potenzial, nicht nur Veränderungen zu vergleichen, sondern vor allem völlig neue Kausalitäten zwischen historischen Prozessen und dem aktuellen Zustand der Gesellschaft und der Landschaft zu erkennen. Neben den historischen und geografischen Informationen hat das Team auch mit soziologischen Konzepten von Identität und Kultur gearbeitet. Das Mittel zur Gewinnung soziologischer Informationen über die Bewohner des untersuchten Gebietes war eine umfangreiche quantitative Befragung einer Stichprobe der Bevölkerung (3000 Befragte), die durch eine qualitative Untersuchung in Form von 10 Gruppendiskussionen in fünf Gebieten des untersuchten Gebietes vertieft wurde. Die gewonnenen Informationen fließen in den siebten Abschnitt des ATLASSES ein.
Der "Große Historische Atlas von Tschechish-Schlesien" (ATLAS) wurde von einem multidisziplinären Team von Experten aus den Bereichen Geschichte, Demographie, Soziologie, Ökonomie, Stadtplanung und Naturwissenschaften erstellt. Durch die Synthese des Expertenwissens, das im ATLAS benutzerfreundlich interpretiert wird, ist ein umfassendes Bild der Entwicklung eines Gebietes entstanden, das innerhalb des mitteleuropäischen Raumes oft großen historischen Veränderungen unterworfen war. Als Schlesische Kriege werden die drei militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem Königreich Preußen und der Habsburgermonarchie bezeichnet, die zwischen 1740 und 1763 um die Kontrolle der ehemals österreichischen Region Schlesien ausgetragen wurden. Infolge dieser Auseinandersetzungen wurde Schlesien in einen österreichischen und einen preußischen Teil geteilt (die heute noch leben und im Volksmund als "Kaiser" und "Preuße" bezeichnet werden). Zur Zeit des Zusammenbruchs der österreichisch-ungarischen Monarchie kam es auch zwischen den neu entstandenen Staaten Tschechoslowakei und Polen zu einem Streit um Teschen. Ein weiteres bedeutendes Ereignis in der Transformation des Territoriums war die Umsiedlung der Einwohner nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, von der vor allem die Region Jeseníky betroffen war. All diese Ereignisse hatten einen großen Einfluss auf das historische Gedächtnis der dort lebenden Bewohner, auf die Wahrnehmung ihrer Identität mit dem Gebiet und auf die soziokulturelle Entwicklung.
Der ATLAS integriert das Wissen aus Forschungsprojekten mehrerer Institutionen, die sich auf das Gebiet von Teschener-Schlesien konzentrieren. Diese Institutionen sind ACCENDO - Zentrum für Wissenschaft und Forschung, z. ú., die Kunstfakultät der Universität Ostrava, das Schlesische Museum, insbesondere sein Schlesisches Institut. Wichtig für die Entstehung des ATLASSES war auch die Zusammenarbeit mit dem Museum in Těšínsko.
Der ATLAS besteht aus einem Satz kommentierter Karten, die das Gebiet von Teschener-Schlesien in sieben Abschnitten darstellen, die sich mit der physischen Geographie, der historischen Geographie, der Demographie, der soziokulturellen Entwicklung, den wirtschaftlichen Prozessen, der Landschaftsentwicklung und der Identität der Bewohner des Gebietes beschäftigen. Das multidisziplinäre Team hatte dank seiner bisherigen langjährigen beruflichen Erfahrung mit Arbeiten zu den oben genannten Themen das Potenzial, nicht nur Veränderungen zu vergleichen, sondern vor allem völlig neue Kausalitäten zwischen historischen Prozessen und dem aktuellen Zustand der Gesellschaft und der Landschaft zu erkennen. Neben den historischen und geografischen Informationen hat das Team auch mit soziologischen Konzepten von Identität und Kultur gearbeitet. Das Mittel zur Gewinnung soziologischer Informationen über die Bewohner des untersuchten Gebietes war eine umfangreiche quantitative Befragung einer Stichprobe der Bevölkerung (3000 Befragte), die durch eine qualitative Untersuchung in Form von 10 Gruppendiskussionen in fünf Gebieten des untersuchten Gebietes vertieft wurde. Die gewonnenen Informationen fließen in den siebten Abschnitt des ATLASSES ein.
Das Hauptziel des ATLASSES ist es, die historischen Prozesse zu identifizieren, die die Bevölkerung und die Landschaft nach 1848 bis zur Gegenwart auf dem Gebiet von Teschener-Schlesien und der territorial verbundenen "Mährischer Keil", die gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und Landschaft, Landschaftspflege (Geschichte der Forst- und Landwirtschaft) und andere Prozesse im Gebiet (Einfluss des Bergbaus, Krieg) beeinflusst haben. Im Allgemeinen geht es um die Entwicklung der Gesellschaft in Tschechish-Schlesien im Prozess der Modernisierung mit Auswirkungen auf die Kulturlandschaft, in der die Menschen seit Jahrhunderten leben. Neben dem Hauptziel gibt es Unterziele, die die Gesamtsituation zeigen. Die Kausalität der Entwicklung der territorialen, regionalen, nationalen und kulturellen Identität wird abgebildet und erklärt, einschließlich der Entwicklung der Zufriedenheit der Bewohner mit der Lebensqualität und ihrer Wahrnehmung der Landschaft, in der sie leben. Die Daten, die kartografisch auf dem Gebiet abgebildet sind, erklären langjährige wirtschaftliche und soziodemografische Prozesse, einschließlich der Entwicklung der Siedlungsstruktur. Gleichzeitig werden durch die umfassende Kartografierung der Spezifika der Entwicklung einer Kulturlandschaft, die dramatische Veränderungen erfahren hat, Spuren von Ereignissen in der Landschaft identifiziert, um die Veränderungen im Territorium zu dokumentieren. Der multidisziplinäre Ansatz des ATLASSES hat ein umfassendes Verständnis der Landschaft und der sozioökonomischen Aktivitäten in ihr ermöglicht und damit auch die Möglichkeiten historischer Museumspräsentationen um Perspektiven aus den verschiedenen natur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen erweitert, die die miteinander verknüpften historischen und gegenwärtigen Einflüsse der Bevölkerungen auf die Landschaft und die Siedlungen erklären.
Da die hier präsentierten Informationen eine transnationale Reichweite haben, kann davon ausgegangen werden, dass sie als Grundlage für die aktuelle Diskussion über die Problematik der nationalen Identität und für die Verfolgung der Entwicklung der Beziehung zwischen Menschen und Landschaften dienen werden. Die Autoren sind der Meinung, dass die gewonnenen Informationen sowohl für museale Präsentationen als auch für die Bildung von Schülern, Studenten und Bewohnern des Gebietes genutzt werden können.
Da die hier präsentierten Informationen eine transnationale Reichweite haben, kann davon ausgegangen werden, dass sie als Grundlage für die aktuelle Diskussion über die Problematik der nationalen Identität und für die Verfolgung der Entwicklung der Beziehung zwischen Menschen und Landschaften dienen werden. Die Autoren sind der Meinung, dass die gewonnenen Informationen sowohl für museale Präsentationen als auch für die Bildung von Schülern, Studenten und Bewohnern des Gebietes genutzt werden können.

1. HISTORISCH-GEOGRAPHISCHER KONTEXT
INHALT DES KAPITELS
1.1 Herkunft der Siedlungen
Ing. arch. Dagmar Saktorová (ACC), Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. (ACC)
1.2 Arten von Siedlungen
Ing. arch. Dagmar Saktorová (ACC)
1.3 Entwicklung der Staatsgrenze zwischen 1742-1918
PhDr. Radim Jež, Ph.D. (OU)
1.4 Entwicklung der Staatsgrenze seit 1918
PhDr. Radim Jež, Ph.D. (OU)
1.5 Entwicklung der internen Verwaltungsstruktur 1742-1918
Mgr. Karolína Ondřeková (ACC), Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU)
1.6 Entwicklung der internen Verwaltungsstruktur seit 1918
Mgr. Karolína Ondřeková (ACC), Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU)
1.7 Die Entwicklung der Gebäude auf dem Gebiet von Tschechish-Schlesien
Ing. arch. Dagmar Saktorová (ACC)
Ing. arch. Dagmar Saktorová (ACC), Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. (ACC)
1.2 Arten von Siedlungen
Ing. arch. Dagmar Saktorová (ACC)
1.3 Entwicklung der Staatsgrenze zwischen 1742-1918
PhDr. Radim Jež, Ph.D. (OU)
1.4 Entwicklung der Staatsgrenze seit 1918
PhDr. Radim Jež, Ph.D. (OU)
1.5 Entwicklung der internen Verwaltungsstruktur 1742-1918
Mgr. Karolína Ondřeková (ACC), Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU)
1.6 Entwicklung der internen Verwaltungsstruktur seit 1918
Mgr. Karolína Ondřeková (ACC), Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU)
1.7 Die Entwicklung der Gebäude auf dem Gebiet von Tschechish-Schlesien
Ing. arch. Dagmar Saktorová (ACC)
1.1 Herkunft der Siedlungen
Bei der Besiedlung Schlesiens wurde das uralte Muster der Durchdringung entlang von Bächen (Flüsse, Bäche, Rinnsale) angewendet. Die landwirtschaftliche Bevölkerung siedelte sich zuerst im Tiefland an. Einen wesentlichen Einfluss auf die Lage der Siedlungen hatten die Routen der Handelswege, insbesondere die sog. Bernsteinstraße von der Ostsee zur Adria und die sog. Schilfstraße, die Prag mit Krakau verband.
Die spätere Entstehung des Siedlungsnetzes im größten Teil des Territoriums ist mit der mittelalterlichen Kolonisation verbunden, die die Gründung neuer Städte und Dörfer mit sich brachte, von denen die meisten bis heute erhalten geblieben sind. Ab dem 12. Jahrhundert fand eine interne Kolonisation statt, bei der die heimische Bevölkerung eine große Rolle spielte, aber die substaatliche Transformation war nur mit der externen Kolonisation verbunden, die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts begann, im 14. Jahrhundert fortgesetzt wurde und in den Berggebieten auch später noch weiterging. Es war die Initiative der Herrscher und der hohen Vertreter der Kirche und des Adels. Dabei gingen die Wälder nach und nach durch Rodung verloren und die Agrarlandschaft wurde vergrößert. Aus verschiedenen Ländern kamen Kolonisten nach Schlesien. Der deutsche Strom setzte sich durch und floss elbaufwärts durch Böhmen, Mähren und Schlesien, mit Ziel in Oberungarn. Die Siedler brachten neue Rechtsnormen sowohl für die städtische (Schwaben- und Sachsenspiegel) als auch für die ländliche Bevölkerung (Emphyteutisches Recht). Der Zustrom der Bevölkerung führte zur Besiedlung höher gelegener Gebiete, wo eine Reihe neuer Dörfer entstand, deren Bevölkerung mit ungünstigen natürlichen Bedingungen zurechtkommen musste.
Lokatoren wurden von Grundbesitzern beauftragt, neue Städte auf grünen Wiesen (in unbewohnten Gebieten) oder an der Stelle ehemaliger Dörfer zu gründen. Diese Städte hatten, anders als die älteren, "wachsenden" Städte einen gleichmäßigen Grundriss. Zu den ersten Gründungen gehörten die sogenannten Oberstädte, als neue Siedler durch den großen Bodenschatz Schlesiens (Zlaté Hory) angelockt wurden. Ihre Schirmherren waren oft Bischöfe von Wrocław und Piastenfürsten. Neue Impulse in der Besiedlung brachte auch der Bau oder die Rekonstruktion der mittelalterlichen Burgen (Hradec nad Moravicí, Hukvaldy, Landek, Vikštejn usw.). Es bildete sich ein neues Modell der landwirtschaftlichen Produktion, das die Ausweitung des Dreifeldersystems (das Wintergetreide, das Sommergetreide, die Brache) mit sich brachte. Die regelmäßige Anordnung der Ackerflächen führte zu einem Übergang von extensiver zu intensiver Produktion, und die landwirtschaftlichen Werkzeuge wurden verbessert.
Ein spürbarer Eingriff in die Entwicklung der Siedlung im 15. Jahrhundert waren die ungarischen Kriegszüge. Viele Burgen wurden erobert und Dörfer verwüstet, von denen viele nicht wiederaufgebaut wurden. Der Adel nutzte dies, um sich unbesiedeltes Land anzueignen und seine Besitzungen zu erweitern. Neben dem wachsenden Interesse an der Gewinnung von Edelmetallen (Gold, Silber) nahmen auch die wirtschaftlichen Aktivitäten des Adels zu (z.B. neue Ausrichtung auf Eisenerzbergbau und Metallurgie). In der Region des Odertals entwickelte sich die Fischzucht und es wurden neue Siedlungen gegründet.
Ab dem Beginn des 16. Jahrhunderts begann sich ein neues Phänomen durchzusetzen, die sogenannte Walachische Kolonisation. Die Walachen kamen aus dem Osten entlang des Karpatenbogens nach Teschen und Ostmähren. Ihre Besonderheit war die Art der Viehzucht in den Bergen und die Herstellung von Schafprodukten. Im Frühjahr wurden die Herden zu den Hirtenhütten in den Bergen getrieben, wo sie bis zum Herbst in nicht überdachten Pferchen (Ausläufen) gehalten wurden. Im 17. Jahrhundert breitete sich auch die so genannte Hirtenkolonisation flussaufwärts der Flüsse und Bäche aus, und die beiden Gruppen vermischten sich und gingen ineinander über. Der Dreißigjährige Krieg führte zu einer Entvölkerung der Bevölkerung und einer Verwüstung von Siedlungen - Städten und Dörfern, vor allem entlang der Routen von militärischen Bewegungen und Zusammenstößen. Es gab jedoch keine größeren Veränderungen im Siedlungsnetz. In der Nachkriegszeit kam es zum Höhepunkt des Prozesses der Stärkung der Grundherrschaft, der Differenzierung des Adels, einschließlich der Veränderungen in der Zusammensetzung des Grundbesitzes (Auszug der Nichtkatholiken).
Der letzte Eingriff in die Siedlungsverhältnisse der noch traditionellen Gesellschaft war die Parzellierung der Höfe und die mit der Gründung neuer Siedlungen verbundene Josephinische Kolonisation. Der Grund dafür war die Tatsache, dass die Steuereinnahmen aus dem parzellierten Land höher waren als die Erträge aus der eigenen Landwirtschaft der Eigentümer. Auf Initiative des österreichischen Ökonomen Raab entstanden die sogenannten Raabsiedlungen, die sich durch einen sehr regelmäßigen Grundriss auszeichnen. Auf dem Gebiet von Tschechish-Schlesien waren dies Ditrichštejn (heute Teil der Stadt Jeseník), Lipina (heute Teil der Gemeinde Štáblovice), Tábor (heute Teil der Gemeinde Velké Heraltice) und andere. Im 18. Jahrhundert war der langfristige Prozess der Besiedlung der Landschaft im Wesentlichen abgeschlossen. Neue Impulse brachten die Industrialisierung, die sich ab dem 19. Jahrhundert entwickelte, sowie die massive Förderung des Bergbaus und die Entwicklung der Schwerindustrie in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg.
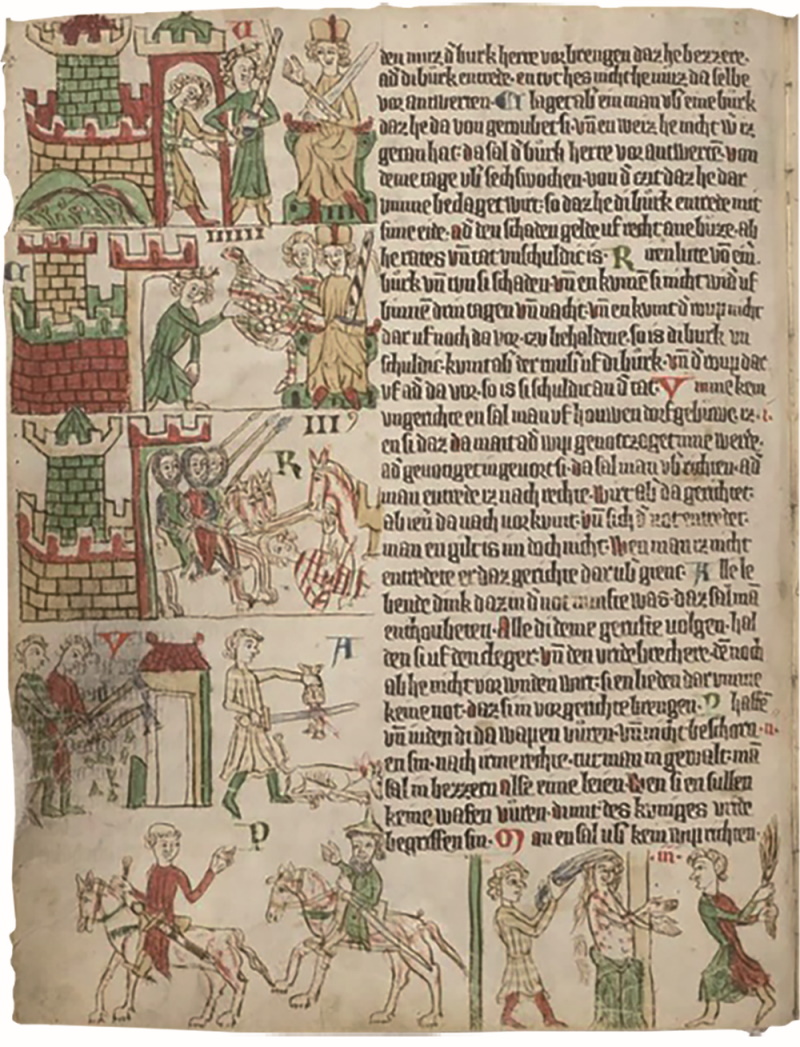


1.2 Arten von Siedlungen
Das Gebiet des heutigen Schlesiens umfasst im Wesentlichen drei Bereiche der ländlichen Besiedlung nach den Siedlungstypen und der Regelmäßigkeit ihres Grundrisses sowie zwei historische Grundtypen von Städten.
In den mittleren Gebieten, die früher von durchgehenden Wäldern bedeckt waren und während der spätmittelalterlichen Kolonisation besiedelt wurden, haben die Dörfer einen lockeren, aber regelmäßigen Grundriss mit einem größeren Abstand zwischen den Gehöften. Die Achse dieser Terrassendörfer, die auch als Walddörfer bezeichnet werden, ist meist ein Bach und eine Straße. Im Gegensatz zum vorherigen Typus ist der Landbesitz der Eigentümer in einem Gürtel hinter den Gehöften konzentriert und bildet ein sogenanntes "Pflugland". Die Grenzen dieser Streifen sind dank der alten Bäume, die sie säumen, an vielen Stellen noch sichtbar. Das ausgedehnte Gebiet der Felddörfer umfasst das gesamte Hohe und Niedere Gesenke mit Ausnahme der höchsten Höhenlagen und eines Teiles des Odertales und des Vorlandes der Beskiden. Die am besten erhaltenen sind die Pflugfelder in der Region Holčovice.
Die Kettendörfer der Beskiden und Teile von Ostrava haben einen ähnlichen, aber noch lockereren und weniger regelmäßigen Grundriss und bilden einen Übergangstyp zum dritten und am wenigsten regelmäßigen Typ - der Streubesiedlung von Teschener Schlesien mit geteilten Abschnitten. Auch die Massendörfer in den höheren Lagen der Beskiden haben einen unregelmäßigen Grundriss. Aber auch in Schlesien sind Dörfer des gemischten Typs häufig anzutreffen.
Die Städte Schlesiens, wie sie erhalten geblieben sind, tragen mit wenigen Ausnahmen die Merkmale von gegründeten Kolonialstädten mit einem regelmäßigen Kernbereich eines zentralen Platzes. Typische Merkmale des Volkshauses in Gesenke sind noch an vielen Stellen erhalten (Holčovicko) quadratischen oder rechteckigen Grundriss und mit einem mehr oder weniger rechtwinkelig verlaufenden Wegenetz. Die Ausnahmen sind Krnov und Opava (und Těšín auf der polnischen Seite), deren unregelmäßiger Grundriss auf einen älteren Ursprung hinweist. Neue Städte wurden auch an der Stelle früherer Dörfer gegründet, die von der neuen Parzellierung überdeckt wurden. Erst in der relativ jungen Zeit wurde die Stadt Havířov gegründet (in den 50. Jahren des 20. Jahrhunderts), aber auch Český Těšín, das nach der Teilung von Těšín durch die tschechisch-polnische Grenze nach dem Stadtplan als neue Stadt errichtet wurde. Zu den ausgestorbenen Siedlungen gehört das ursprüngliche Dorf Karviná (heute Karviná-Doly), das dem Kohlebergbau weichen musste.
1.3 Entwicklung der Staatsgrenze zwischen 1742-1918
Am 11. Juni 1742 wurde in Breslau unter britischer Vermittlung ein vorläufiger (provisorischer) Frieden zwischen Österreich und Preußen geschlossen, der eine achtzehnmonatige militärische Auseinandersetzung beendete, die als Erster Schlesischer Krieg in die Geschichte einging. Die endgültige Unterzeichnung der Friedensverträge fand am 28. Juli 1742 in Berlin statt. Das Friedensprotokoll sah vor, dass der König von Preußen als Sieger ganz Niederschlesien und einen beträchtlichen Teil Oberschlesiens, darunter auch Kladsko, das nie zu Schlesien, sondern zu Böhmen gehört hatte, erhalten sollte. Nur das gesamte Gebiet des Fürstentums Teschen sollte Teil der Habsburgermonarchie bleiben, dazu kam ein Teil der unteren Stände von Bohumín aus dem ursprünglichen Ratiboř-Gebiet, sowie der größte Teil der Fürstentümer Opava und Krnov, ein kleinerer Teil des Fürstentums Nisko-Grotkov und im Grunde alle sogenannten mährischen Enklaven in Schlesien. Der Anteil Österreichs an der Gesamtfläche Schlesiens betrug somit weniger als 14 %. Der Name der neu geschaffenen territorialen Einheit wurde als Herzogtum Schlesien, später Herzogtum Ober- und Niederschlesien, als Reminiszenz an den vorherigen Staat und als Ausdruck des staatlichen und landesherrlichen Prestiges angenommen. Das Gebiet wurde jedoch allgemein als Österreichisch-Schlesien bezeichnet.
Die Demarkation der Grenze direkt an den betreffenden Orten begann am 22. September 1742 an der Grenze von Těšín und Pštinsk am Zusammenfluss von Bela und Weichsel in der Nähe des Dorfes Dědice. Die Grenze in diesem Gebiet wurde durch die Weichsel bis zur Stadt Strumen definiert, aber weiter westlich verlief sie durch offenes Land, was dazu führte, dass eine Reihe von Streitigkeiten zwischen Grundbesitzern auf beiden Seiten der Grenzlinie gelöst werden mussten. Auf der Teschener Schlesien Seite bestand die Grenze aus den Gütern Zbytkov, Bonkov, Rychuld und Žibřidovice, wo die Grenze auf der preußischen Seite auf das untere Gut Vladislav zulaufend begann. Die Staatsgrenze folgte dann dem Verlauf des Flusses Petrůvka bis zu seinem Zusammenfluss mit der Olše. Sie folgte dem Verlauf dieses Flusses in nordwestlicher Richtung bis zur Mündung in die Oder beim Dorf Kopytov. Die einzige bedeutende Ausnahme war das Gebiet in der Nähe von Věřňovice, wo die Kommissare die Notwendigkeit respektierten, die Unversehrtheit des Anwesens zu bewahren, das ein Teil der unteren Herrschaft von Německá Lutyně war. Die Grenze verlief weiter flussaufwärts der Oder bis zur Einmündung in die Opava bei Třebovice. In der Folge wurde die untere Herrschaft Bohumín in zwei Teile geteilt, von denen die Stadt selbst und die Dörfer Kopytov, Pudlov und Šunychl an die Österreicher fielen, während auf der preußischen Seite die Burg Bohumín mit dem Alten Hof und die Dörfer Zábylkov, Odra, Olza, Velké Hořice und Belšnice lagen.
Im Fürstentum Opava bildete der Fluss Opava die Grenze zu seinem Provinzzentrum. Das Gebiet am rechten Flussufer, d.h. Ratibořské Předměstí, das Dorf Kateřinky und die zur Stadt gehörenden Ackerflächen, blieben Teil der Hauptstadt von Österreichisch-Schlesiens. Nicht weit dahinter, im Nordwesten, kehrte die Grenze bei dem Dorf Vávrovice zum Lauf der Opava zurück, die gegen den Strom bis zur Stadt Krnov verlief. Genau wie im Fall von Opava blieb die Vorstadt am rechten Ufer Teil des österreichischen Gebietes.
Die Grenzlinie verlief dann weiter entlang des Flusses Opavice und teilte mehrere Herrschaften und Güter. Ähnlich verhielt es sich bei der Festlegung der Grenzen der sogenannten mährischen Enklaven, die jedoch größtenteils bei der Habsburgermonarchie verblieben. Etwas komplizierter war die Situation im Fürstentum Nisza, wo die Kommissare nicht wie in den anderen betroffenen Territorien auf natürliche Hindernisse zurückgreifen konnten und daher gezwungen waren, dem Verlauf der lokalen Straßen, kleinen Wasserläufe und anderen landschaftlichen Orientierungspunkten zu folgen, wobei sie in erster Linie die Grenzen der einzelnen Landgüter des Adels berücksichtigen mussten. Dies war jedoch nicht immer möglich. Die neuen Grenzen betrafen am deutlichsten die Güter Velké Kunětice und Bílá Voda. Die anschließenden Streitigkeiten, die zwischen den Besitzern der Herrschaften beiderseits der Grenze aufflammten, mussten auch nach der Beendigung der Grenzkommission, deren letzte Sitzung am 20. Oktober 1742 in Bílá Voda stattfand, teilweise beigelegt werden.

Bei der Grenzziehung sollten die Kommissare und ihre bevollmächtigten Mitarbeiter Holzpfähle im Feld setzen, wo die Grenzlinie verlaufen sollte. Insgesamt wurden 138 davon auf österreichischer Seite gesetzt. Zu den Pfählen gehörten auch Schilder, auf denen die Königskrone aufgemalt war, aus der ein roter, mit Hermelin gefütterter Königsmantel hervorging. Der Mantel trug die goldene Initialen: M.T.R.I.H.B.R, eine Abkürzung für den Namen und den Titel des Monarchen in der lateinischen Version. Die Übersetzung lautet: Maria Theresia, Kaiserin von Rom und Königin von Böhmen. Die Holzpfosten hielten der Witterung jedoch nicht lange stand und wurden daher durch Grenzsteine ersetzt. Sie trugen jeweils eine numerische Ordnungsbezeichnung und im oberen Teil das Emblem der Kaiserkrone oder des preußischen Adlers oder eine Kombination aus beidem. Ihr Standort wurde auf speziellen Karten verzeichnet. Allein im Bereich der Grenze des Fürstentums Teschen wurden etwa 50 davon aufgestellt, von denen etwa zwanzig bis heute als Erinnerung an die längst untergegangene Grenzlinie erhalten geblieben sind.
Die im Herbst 1742 festgelegte Grenze blieb bis zum Ende der Monarchie im Jahr 1918 in Kraft.
1.4 Entwicklung der Staatsgrenze seit 1918
Am Ende des Ersten Weltkrieges, als die zerfallende österreichisch-ungarische Monarchie begann, neue staatliche Einheiten zu bilden, war es notwendig, den Verlauf der Staatsgrenze auf dem Gebiet des verschwindenden Österreichisch-Schlesien zu klären. Die territorialen Forderungen der Vertreter der Tschechen, Deutschen, Polen und Schlesier stützten sich auf Argumente der historischen Rechte, der nationalen und ethnographischen Verhältnisse und der wirtschaftlichen Interessen. Ein langwieriger Streit um das Territorium der historischen Länder, die sich seit dem Hochmittelalter als eigenständige Fürstentümer konstituiert und zum Teil entwickelt hatten, musste erst durch das Eingreifen der Schlichtungsmächte beendet werden.
Die tschechoslowakische Regierung forderte jedoch die Annexion des linksufrigen Gebietes am Fluss Opava. Dies war der südliche Teil der Ratiboř-Region - die sogenannte Hlučín-Region - wo etwa 50.000 Einwohner auf fast 316 km2 lebten. Die Angliederung an die Tschechoslowakei wurde durch den Friedensvertrag mit Deutschland in Versailles am 28. Juni 1919 festgelegt. Trotz der offensichtlichen Ablehnung der Mehrheit der örtlichen Bevölkerung wurde Hlučínsko am 4. Februar 1920 ohne Volksabstimmung mit dem tschechoslowakischen Territorium vereint. Die Arbeit der Entgrenzungskommission dauerte bis 1923, als zusätzlich die Dörfer Hata und Píšt' annektiert wurden und das Dorf Ovsiště an Deutschland zurückgegeben wurde.
Am kompliziertesten war die Situation in Těšín. Vertreter eines Teiles der polnischen Vertretung gründeten am 19. Oktober 1918 in Těšín eine eigene Gruppe unter dem Namen "Nationalrat des Teschener Fürstentums", der in seiner Erklärung vom 30. Oktober 1918, den Anschluss von ganz Teschen in seinen historischen Grenzen zum wiederhergestellten Polen forderte. Am selben Tag starteten die Tschechen die Organisation des Landesnationalausschusses für Schlesien und am 1. November vereinbarten sie im polnischen Ostrava die Übernahme der Regierung des gesamten schlesischen Gebietes. Die vorläufige Demarkationslinie, deren endgültige Form von den Regierungen beider Staaten beschlossen werden sollte, wurde am 5. November 1918 entsprechend der nationalen Zusammensetzung der Gemeinderäte festgelegt. Nachdem die polnische Regierung Ende November 1918 Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung angekündigt hatte, die nach dem Willen des Nationalrates am 26. Januar 1919 auch auf dem Gebiet von Teschen stattfinden sollten, widersetzte sich die tschechoslowakische Regierung diesem Schritt vehement und besetzte Ende Januar 1919 einen Teil von Teschen bis zum Oberlauf der Weichsel militärisch. Nach der Intervention der Vereinbarungsmächte und langwierigen Verhandlungen beschloss der Botschafterrat in Spa am 28. Juli 1920, dass Teschen wie folgt aufgeteilt wird - die Tschechoslowakei erhält nach ihrem Mindestbedarf den Bezirk Ostrava-Karviná und die Bahnstrecke Košice-Bohumín, d.h. vom historischen Territorium des Fürstentums ca. 1.270 km, auf dem etwa 300.000 Einwohner lebten. 1 012 km mit 140 000 Einwohnern wurde an Polen angegliedert. Die Verwaltung der annektierten Teile von Teschen wurde am 10. August 1920 an die tschechoslowakische und polnische Regierung übergeben. Vier Jahre später wurde die Grenze zusätzlich angepasst, als die Siedlung Hrčava an die Tschechoslowakei angegliedert wurde.
Die neu gezogenen Grenzen wurden mit Grenzsteinen markiert, in die die Abkürzungen der Bundesländer und das Jahr der Verlegung eingemeißelt wurden. Darüber hinaus wurden in den Jahren 1925-1926 an den Grenzübergängen in der gesamten Tschechoslowakei insgesamt 232 Grenzorientierungspfosten aus gepresstem Stahlblech, bemalt in Form einer stilisierten Nationalflagge und zwei gusseisernen Schilden mit einem Löwen aus einem kleinen Staatswappen aufgestellt. Fünfundvierzig von ihnen wurden an Grenzübergängen auf dem Gebiet des tschechoslowakischen Schlesiens installiert.

Die polnische Regierung nutzte auch die politischen Spannungen, die 1938 in dem Diktat Hitlerdeutschlands gipfelten, das tschechoslowakische Grenzgebiet abzutreten. In mehreren diplomatischen Noten forderte sie die sofortige Räumung des tschechoslowakischen Teiles von Těšín, wo die polnische Minderheit am zahlreichsten war, und die Übergabe dieses Gebietes an den polnischen Staat. Die Beschlagnahme umfasste die gesamten politischen Bezirke Český Těšín und Fryštát und betraf teilweise drei Dörfer im Bezirk Frýdek (Šenov, Vojkovice und Žermanice) und später weitere kleinere Teile des Bezirkes Moravská Ostrava (Hrušov, Heřmanice, Michálkovice, Radvanice und Slezská Ostrava), während Morávka am 10. Dezember 1938 als Teil des politischen Bezirks Frýdek in die Zweite Republik eingegliedert wurde, die sich ab 16. März 1939 als Teil des historischen Schlesiens im Protektorat Böhmen und Mähren wiederfand. Die Fläche des von der polnischen Besatzung betroffenen Gebietes betrug ca. 830 km2.
Westschlesien wurde aufgrund eines von der Tschechoslowakei und Deutschland unterzeichneten Protokolls am 20. November 1938 dem Deutschen Reich angeschlossen. Der Regierungsbezirk Opava wurde Teil des Sudetenlandes, während die Region Hlučín ab Oktober 1938 zum Ratiboř-Kreis des Regierungsbezirkes Opole der Provinz Schlesien (ab 1941 Oberschlesien) gehörte.
Der unter polnischer Besatzung stehende Teil von Těšín wurde am ersten Tag des Zweiten Weltkriegs, d.h. am 1. September 1939, von der deutschen Armee besetzt und als Teil des Regierungsbezirkes Kattowitz dem Reich einverleibt.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die polnischen Gebietsansprüche nicht akzeptiert; nach der Intervention der Sowjetunion waren beide Seiten gezwungen, am 10. März 1947 den Alliierten Vertrag zu unterzeichnen. Eine endgültige Entscheidung über die Form der Staatsgrenze wurde erst mit der Unterzeichnung des tschechoslowakisch-polnischen Vertrages in Warschau am 13. Juni 1958 getroffen, der von der Nationalversammlung der Tschechoslowakischen Republik auf ihrer Sitzung am 18. September desselben Jahres angenommen wurde. In Schlesien wurden insgesamt 43 Änderungen vorgenommen, die bedeutendsten in der Nähe von Krnov am Zusammenfluss von Opavice und Opava.
1.5 Entwicklung der internen Verwaltungsstruktur 1742-1918
Seit 1743 wurde Österreichisch-Schlesien vom Königlichen Amt in Opava verwaltet, das 1749 in Königliche Vertretung und Kammer und 1763 wieder in Königliches Amt umbenannt wurde. In den Jahren 1783-1783 wurde Österreichisch-Schlesien mit Mähren zusammengelegt und von einem gemeinsamen mährisch-schlesischen Gouvernement mit Sitz in Brünn verwaltet. Gleichzeitig wurde es in zwei Regionen mit Sitz in Těšín und Opava geteilt. Nach der Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahr 1848 hörten die Landesbehörden auf zu funktionieren und Schlesien wurde in sieben politische Bezirke aufgeteilt. Diese wurden 1855 abgeschafft und ein Teil ihrer Zuständigkeit wurde auf die gemischten Bezirksämter übertragen. Im Jahr 1868 wurden die politischen Bezirke neu festgelegt. Ab 1849 war die übergeordnete Behörde dieser Kreise das Gouvernement, das 1853 zur schlesischen Landesregierung wurde.
Mit der Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahr 1848 wurden die Herrschaften abgeschafft und durch staatliche Verwaltungsstellen ersetzt. Auf der untersten Ebene wurden Gemeinden als lokale Selbstverwaltungsorgane eingerichtet, die von Bezirksgouverneuren beaufsichtigt wurden, die die sogenannten politischen Bezirke verwalteten. Die einzige schlesische Stadt, die einen besonderen Status erhielt, die statutarische Stadt Opava, hatte auch die Aufgaben einer Bezirkshauptmannschaft. Die Justiz wurde von der politischen Verwaltung getrennt, so dass jeder politische Bezirk weiter in mehrere Gerichtsbezirke unterteilt wurde. Die Gebietskörperschaften wurden abgeschafft und in Österreichisch-Schlesien wurden sie nicht wie in Mähren und Böhmen durch Landesregierungen (politische Verwaltungsorgane) ersetzt. An der Spitze der Provinzverwaltung stand das Gouvernement, an dessen Spitze der Gouverneur stand. In Österreichisch-Schlesien hatte der Gouverneur in Ermangelung einer Landesregierung auch das Amt des Regierungspräsidenten inne und war der direkte Vorgesetzte des Bezirkshauptmanns. Der mährisch-schlesische Staat wurde geteilt und Schlesien wurde wieder als selbständiger Staat vertreten, der auf der Ebene der staatlichen Verwaltung durch das Gouvernement mit Sitz in Opava repräsentiert wurde. Es gab auch noch einen gewähltenn ein Selbstverwaltungsorgan - der Schlesische Konvent (ab 1861 Schlesischer Provinziallandtag genannt).
Da das Gouvernement ein staatliches Verwaltungsorgan war und die Bezirksregierungen als Selbstverwaltungsorgane tagten, wurde das Gouvernement 1853 durch die schlesische Landesregierung in Opava ersetzt, die die Kompetenzen und Aufgaben der Landesregierung und des Gouvernements vereinigte. Die schlesische Landesregierung diente bis zum Ende der Existenz von Österreichisch–Schlesien als oberste Verwaltungsbehörde. Im Jahre 1860 wurde es abgeschafft und Schlesien wurde mit Mähren zusammengelegt, aber diese Änderung dauerte nur ein Jahr und ab 1861 existierte Schlesien wieder als selbständiges Land mit einer Landesregierung. Sie wurde von einem Provinzpräsidenten geleitet.
Im Jahr 1849 wurden in Österreichisch-Schlesien sieben politische Bezirke eingerichtet - Bruntál, Frývaldov (Jeseník), Krnov, Opava, Frýdek, Těšín und Bílsko. Es gab 22 Gerichtsbezirke - Bílsko, Skočov, Strumeň, Jablunkov, Těšín, Fryštát, Bohumín, Frýdek, Bílovec, Klimkovice, Odry, Opava, Vítkov, Albrechtice, Krnov, Osoblaha, Bruntál, Horní Benešov, Zuckmantl (Zlaté Hory), Frývaldov (Jeseník), Javorník und Vidnava. Bei einer weiteren Verwaltungsreform im Jahre 1855 wurden die politischen Bezirke abgeschafft, ein Teil ihrer Kompetenzen wurde an die Provinzregierung übertragen und ein Teil an diese Gerichtsbezirke, die nun von gemischten Bezirksämtern verwaltet wurden. Sie wurden von Distrikt-Gouverneuren geleitet.
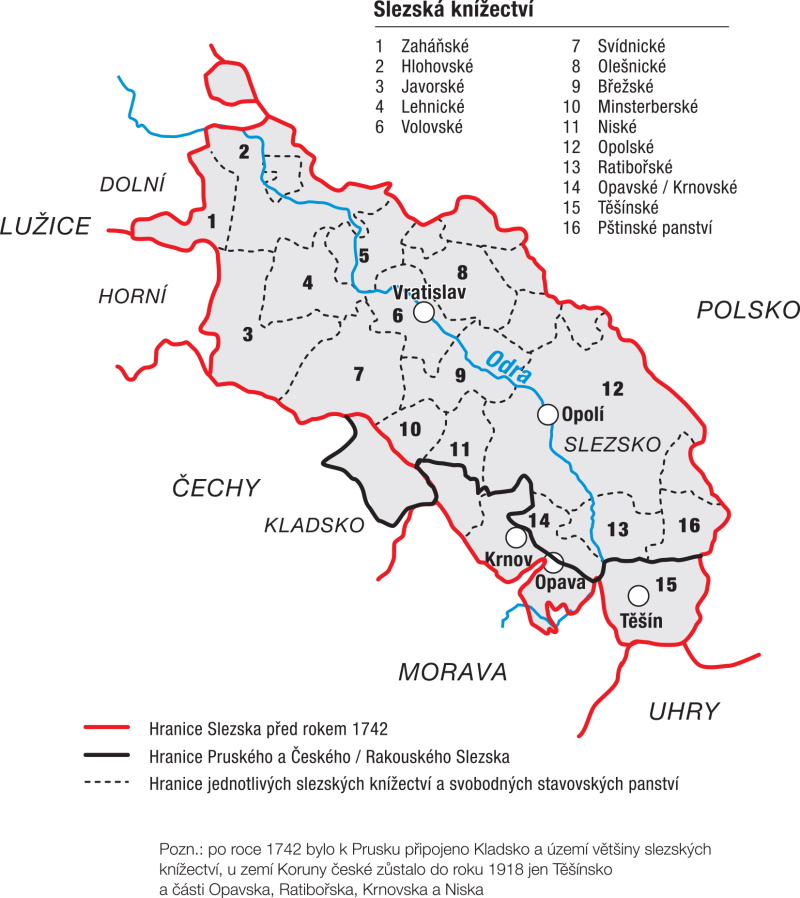
Im Jahr 1868 wurde die gerichtliche und politische Verwaltung wieder getrennt. Die Gerichtsbezirke blieben gleich, nur in 1869 kam ein weiterer Gerichtsbezirk Vrbno (aus Bruntál), 1873 Jindřichov (aus Osoblaha) und 1904 Polská Ostrava (aus Bohumín) hinzu. Für die politische Verwaltung wurden wieder Bezirksgouvernements mit Bezirksgouverneuren an der Spitze eingerichtet. Österreichisch-Schlesien wurde in sieben politische Bezirke aufgeteilt, die aber nicht mehr ganz dieselben waren wie vor 1855 - Bruntál, Frý- valdov (Jeseník), Krnov, Opava, Fryštát, Těšín und Bílsko. Opava hatte als statutarische Stadt die Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaften, und die Städte Bílsko und Frýdek bekamen später einen besonderen Status. Damit wurde eine dreistufige Staatsverwaltung (Bezirksgouvernement - Provinzregierung - Staat) geschaffen. Dieses Verwaltungssystem dauerte bis zum Ende der Monarchie, erst im Laufe der Zeit entstand die Notwendigkeit, die Verwaltungseinheiten rationeller aufzuteilen, und so entstand 1896 der politische Bezirk Bílovec, der vom Bezirk Opava abgeteilt wurde, und 1901 der politische Bezirk Frýdek, der vom Bezirk Těšín abgeteilt wurde. Er bestand aus einem einzigen Gerichtsbezirk - Frýdek, aber im Jahr 1904 wurde ihm der Gerichtsbezirk Polská Ostrava hinzugefügt.
Die lokale Regierung hatte auch drei Instanzen. Auf der untersten Ebene war sie durch Gemeindevorstände, auf der mittleren Ebene ab 1898 durch Kreisstraßenausschüsse und auf der Landesebene durch den Schlesischen Landtag vertreten.
1.6 Entwicklung der internen Verwaltungsstruktur seit 1918
Nach der Gründung der Tschechoslowakei wurde das Verwaltungssystem von Österreich-Ungarn übernommen. Erst 1928 kam es zu einer Reform der Verwaltung, die das Mährisch-Schlesische Land begründete. Es wurden ein Bezirksamt mit Sitz in Brünn und Bezirksämter als Selbstverwaltungsorgane gegründet. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der westliche Teil Schlesiens dem Sudetenland und der größte Teil Teschens der Provinz Schlesien, später Oberschlesien, mit Regierungssitz in Kattowitz zugeschrieben. Nur der Bezirk Frýdek blieb in der sogenannten zweiten Republik und später im Protektorat. Nach dem Krieg wurden auf allen Ebenen nationale Komitees gegründet und mit der Reform von 1949 wurden Regionen geschaffen. Der größte Teil Schlesiens fiel unter den Bezirk Ostrau und ab 1960 ganz Schlesien unter den Nordmährischen Bezirk. Die Regionen wurden 1990 abgeschafft, aber im Jahr 2000 wieder eingeführt; der größte Teil Schlesiens gehört zur Mährisch-Schlesischen Region, nur der Bezirk Jeseník gehört zur Region Olomouc.
Nationale Ausschüsse wurden auch auf der Ebene der Bezirke und Gemeinden gebildet und übernahmen für kurze Zeit die staatliche Verwaltung. Ansonsten wurden die politischen Bezirke Frývaldov (Jeseník), Bruntál, Krnov, Opava, Bílovec, Fryštát und Český Těšín (nach der Trennung eines Teiles von Těšín), die statutarischen Städte Opava und Frýdek sowie der Bezirk Hlučín neu in diese Struktur aufgenommen. Die politischen Bezirke wurden weiter in die ursprünglichen Gerichtsbezirke eingeteilt, von denen es im tschechoslowakischen Schlesien 23 gab.
Im Jahr 1928 wurde eine Verwaltungsreform auf der Grundlage des sog. Organisationsgesetzes durchgeführt, wonach der Staat in vier Länder aufgeteilt wurde - das tschechische, mährisch-schlesische, slowakische und unterkarpatische. Schlesien wurde mit Mähren zusammengelegt und Brünn wurde zum Sitz der regionalen Behörden. Die schlesische Landesregierung hörte damit auf zu existieren. Verwaltung und Selbstverwaltung wurden auf Provinz-, Kreis- und Gemeindeebene zusammengelegt. In Brünn wurde eine Landesbehörde mit Zuständigkeit auch für Schlesien eingerichtet, an deren Spitze ein Landespräsident stand, dem ein Rat, ein Ausschuss und Kommissionen zur Verfügung standen. Die Bezirksverwaltungen waren in gleicher Weise aufgeteilt, so dass der Bezirkshauptmann an der Spitze stand und einen Rat, ein Komitee und Kommissionen zu seiner Verfügung hatte. Die Bezirke waren identisch mit den bisherigen politischen Bezirken. Auf kommunaler Ebene gab es einen Bürgermeister, einen Gemeinderat, einen Gemeindevorstand und Kommissionen.
Nach dem Münchner Abkommen wurde ein großer Teil des tschechoslowakischen Schlesiens an das Reich angegliedert und Teil des Sudetenlandes. Es gehörte zum Regierungsbezirk Opava, der in 15 Landkreise mit Landräten an der Spitze und den Stadtkreis Opava mit einem Bürgermeister an der Spitze unterteilt war. Insgesamt gab es sechs schlesische Bezirke - Bílovec, Bruntál, Frývaldov (Jeseník), Krnov und Opava (Stadt und Land). Die Region Hlučín wurde direkt dem Reich angeschlossen und Teil des Kreises Ratiboř. Nach der Eroberung des sogenannten Zaolzie durch die Polen entstanden die Kreise Cieszyn und Frysztat, die zur schlesischen Woiwodschaft mit Sitz in Katovice gehörten. Nach der Besetzung dieses Gebietes durch die deutschen Truppen wurden die beiden Kreise zu einem Kreis Teschen zusammengelegt, der zum Regierungsbezirk Kattowitz der Provinz Schlesien mit Sitz in Wrocław gehörte, an dessen Spitze der Oberpräsident stand. Im Jahr 1941 wurde die schlesische Provinz unterteilt und es entstand die Provinz Oberschlesien mit dem Regierungspräsidenten in Kattowitz. Innerhalb der sog. Zweiten Republik blieb nur der Rumpfbezirk Frýdek übrig, dem einige Gemeinden des ehemaligen Bezirkes Český Těšín hinzugefügt wurden. Der politische Bezirk Frýdek wurde im Jahr 1942 aufgelöst und in den Bezirk Místek eingegliedert. Das Gebiet unterstand dem Oberlandrat in Moravská Ostrava.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die administrative Aufteilung aus der Zeit vor 1938 wiederhergestellt, aber die Verwaltung wurde von den nationalen Ausschüsse anstelle der früheren Behörden auf der Grundlage des Regierungsprogramms von Košice übernommen. Aus der Besatzungszeit blieb die Eingliederung des Bezirks Frýdek in den Bezirk Místek und die Existenz der statutarischen Stadt Ostrava (der Bezirk Moravská Ostrava wurde aufgehoben). In Gebieten mit überwiegend deutscher Bevölkerung wurden Kreis- und Ortsverwaltungskommissionen eingesetzt. Auf Provinzebene wurde Schlesien vom Mährisch-Schlesischen Provinzausschuss in Ostrava verwaltet. Die Verfassung vom 9. Mai 1948 sprach jedoch nicht von nationalen Landesausschüsse, sondern teilte die nationalen Ausschüsse in Orts-, Bezirks- und Regionalausschüsse auf. Am 1. Januar 1949 wurden regionale Ausschüsse gegründet, deren Exekutivorgane waren: der Rat, der Vorsitzende (und seine Stellvertreter), Sekretäre und Kommissionen. Die Gebiete der Regionen hielten sich nicht an die Landesgrenzen. Die Region Ostrava umfasste die schlesischen Kreise Bílovec, Český Těšín, Fryštát, Hlučín, Krnov, Opava, Ostrava und Vítkov. Die Bezirke Bruntál und Jeseník wurden in die Region Olomouc eingegliedert.
Im Jahr 1960 fand eine weitere Verwaltungsreform statt, die das regionale System beibehielt, aber die Einteilung der Regionen änderte und die Anzahl der Regionen und Bezirke reduzierte. Das tschechoslowakische Schlesien wurde zusammen mit den angrenzenden Teilen Mährens zu einem einzigen nordmährischen Kreis, der in 10 Bezirke gegliedert war, von denen die Bezirke Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Bruntál und Šumperk in Schlesien lagen oder sich mit diesem überschnitten. Diese Bezirke existierten auch nach 1990 weiter, als die Regionen abgeschafft wurden und die Hauptverwaltung von den Bezirksbehörden durchgeführt wurde. Im Jahr 1994 wurde der Bezirk Jeseník hinzugefügt. Im Jahr 1997 wurde ein Gesetz über die Schaffung von höheren territorialen Selbstverwaltungseinheiten verabschiedet, die Regionen mit regionalen Büros waren. Die Bezirke wurden im Jahr 2000 eingerichtet, wobei der größte Teil von Böhmisch-Schlesien zum Mährisch-Schlesischen Kreis gehörte, nur der Kreis Jeseník zum Olmützer Kreis. Im Jahr 2002 wurden im Rahmen der zweiten Phase der territorialen Verwaltungsreform die Bezirksämter abgeschafft und die territorialen Einheiten - Bezirke - blieben bestehen. Die Zuständigkeit wurde teilweise auf regionale Behörden und teilweise auf Gemeinden mit erweiterter Zuständigkeit übertragen.
1.7 Die Entwicklung der Gebäude auf dem Gebiet von Tschechish-Schlesien
Das Gebiet von Nordmähren und Tschechish-Schlesien hat in den letzten zweihundert Jahren rasante Bevölkerungsveränderungen erlebt, die sich auch in der Entwicklung der bebauten Fläche niedergeschlagen haben. Diese Veränderungen sind sowohl in den Städten als auch auf dem Land zu beobachten. Einige Siedlungen haben ihre Bevölkerung vervielfacht, während anderswo die Bevölkerung nur noch ein Bruchteil dessen ist, was sie vor einem Jahrhundert war. Viele Dörfer sind zu Städten geworden, während einige Städte aufgrund des Bevölkerungsrückganges zu Dörfern geworden sind.
Das älteste Siedlungsgebiet ist das Gebiet der Niederungen, wie die Schlesische Tiefebene (Opava, Hlučín und Osoblažský výběžek). Sie zeichnen sich durch relativ kompakte, konzentrierte Dörfer aus. In der Regel stehen die Häuser dicht aneinandergereiht entlang der Straße oder des Dorfplatzes. Der Innenbereich ist durch Gartenzäune und Straßen deutlich von den Feldern getrennt. Die Felder, bzw. das Ackerland, sind in Blöcke - Linien aufgeteilt, die wiederum in schmale Streifen unterteilt sind. Felder in verschiedenen Zeilen können zum selben Gebäude gehören.
Die Region Jeseníky ist ein jüngeres Gebiet, das vor allem in der Zeit der hoch- und spätmittelalterlichen (deutschen) Kolonisation besiedelt wurde. Es gibt geplante, meist langgestreckte Terrassendörfer und Walddörfer. Die Häuser sind locker entlang einer Straße oder eines Baches angeordnet, ihr Abstand richtet sich nach der Breite des Ackerstreifens (Pflugland), der sich hinter der Scheune eines jeden Hofes erstreckt.
Im Gebiet östlich von Ostrava, wie auch in Podbeskydí, ist der planmäßige Charakter der Terrassendörfer weniger ausgeprägt als in den Walddörfern; die Gehöfte sind in unregelmäßigen Grenzen entlang der Straße angeordnet. Dieser Übergangstyp wird als Kettendorf bezeichnet. In den bergigen Gebieten der Beskiden haben die Dörfer der jüngsten Siedlung einen eher locker gruppierten Massenplan. Sie sind ein Übergangstyp zwischen Dörfern und isolierten Dörfern.
Die größeren Straßendörfer in den Regionen Fryštát (Karviná) und Těšín zeichnen sich durch unregelmäßige Bebauung entlang der Straßen aus. Die zersplitterte schlesische Entwicklung hängt hier mit der Änderung der Lebensweise und dem Bevölkerungswachstum zusammen, das bis zum Ende des 18.Jahrhunderts zurückreicht.
Neben den oben genannten ländlichen Siedlungstypen finden sich auf dem Gebiet von Nordmähren und Schlesien auch Übergangsformen von Siedlungen, die die Merkmale mehrerer Typen tragen. Es ist zu betonen, dass sich der Charakter der Siedlung im Laufe der Zeit verändert hat, Siedlungen entstanden und verschwanden, der ursprüngliche Charakter der Siedlung wurde von einer "neuen Schicht" überdeckt. Grundtypen von Städten.
Die Städte auf dem Gebiet von Nordmähren und Schlesien lassen sich nach dem Typ in die folgenden Gruppen einteilen: die ältesten Entwicklungsstädte, vorkolonial, mit unregelmäßigem Boden (Opava, Krnov), planmäßig gegründete Städte in der Kolonisationsphase des Hochmittelalters, die sich durch einen rechteckigen Grundriss ihres Kerns und eine quadratische (Bruntál, Horní Benešov, Hlučín) oder rechteckige (Osoblaha, Bílovec, Klimkovice) Form des Platzes auszeichnen, aus Dörfern gebildete Städte, ohne einen zentralen Marktplatz mit städtischem Charakter (Město Albrechtice, Slezská Ostrava, Rychvald), moderne Städte, deren urbane Funktion im Zusammenhang mit der Industrialisierung entstanden ist (Třinec), und Städte, die teilweise oder ganz nach einem modernen Regulierungsplan geplant wurden (Český Těšín, Havířov, Nový Bohumín, teilweise "neues" Karviná und "neues" Orlová).
Entwicklung nach Bereichen. Grundlage für die Untersuchung der Entwicklung des bebauten Gebietes sind Karten von stabilen. Katastern aus den Jahren 1830-1840, preußische Militärkarten aus dem Jahr 1877, Luftbildaufnahmen aus dem Jahr 1955 und regelmäßig eingescannte farbige Luftbildkarten aus der Zeit nach 2000.
Jesenicko. Die Landschaft von Jeseníky (Altvatergebirge) ist vom Beginn der Industrialisierung nicht sehr betroffen, neue Produktionsstätten befinden sich hauptsächlich in den Städten. Krnov wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Industrie- und Handelszentrum der Region. Von grundlegender Bedeutung für die Stadt waren die Anlage einer neuen Straße nach Osoblaha und der Bau eines Eisenbahnknotens im Jahr 1872. Neben den Fabriken entstanden auf allen Seiten der Innenstadt neue Wohnviertel. Leider wurde die Stadt am Ende des Zweiten Weltkrieges schwer beschädigt. Vom historischen Kern blieb nur ein Torso übrig, das Werk der Zerstörung wurde durch die sozialistische Expansion vollendet. Die äußeren Wohnviertel waren weniger zerstört, aber die Plattenbauten folgten nicht dem Straßennetz der Vorkriegszeit. Andere Städte wurden am Ende des Zweiten Weltkrieges in ähnlicher Weise zerstört, vielleicht am meisten Osoblaha. Der Abriss historischer Kerne und unsensible Neubauten haben die Siedlungen irreversibel geschädigt. In vielen von ihnen verschwand der zentrale Platz und wurde durch eine Straßenkreuzung ersetzt (Andělská Hora), andere verloren aufgrund des Bevölkerungsrückganges ihren Stadtstatus (Osoblaha).
Mit dem Beginn der Industrialisierung zieht die Landbevölkerung auf der Suche nach Arbeit in die Industriezentren und ihre Zahl beginnt zu sinken. Ende des 19. Jahrhunderts waren in Jeseniky die Dörfer mit einer ungünstigen Bevölkerungsbilanz in der Überzahl. Den stärksten Rückgang gab es in den Grenzbezirken, wobei nur Krnovsko eine positive Entwicklung verzeichnete. Die ländliche Bevölkerung hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Der Wendepunkt kam mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit der Vertreibung der damals überwiegend deutschen Bevölkerung. Eine dauerhafte Wiederbesiedlung mit Neuankömmlingen aus anderen Landesteilen und dem Ausland (Rumänien, Ukraine) war nicht möglich; die Häuser verfielen, einige Dörfer verschwanden, andere blieben mit einer viel geringeren Einwohnerzahl bestehen. Verlassene Hütten werden für Erholungszwecke genutzt, und der Bau von Hütten und betrieblichen Erholungseinrichtungen wird gefördert. Die intensive Landwirtschaft wird an Orten mit ungünstigeren Bedingungen durch Weideviehhaltung ersetzt und abfallende Felder werden mit Bäumen überwuchert. Trotzdem behalten kleinere und abgelegenere Siedlungen ihren ursprünglichen visuellen Charakter, die Aufteilung der Felder ist immer noch klar, und Talorte bleiben Talorte (Holčovice, Heřmanovice). Dagegen breiten sich Dörfer mit einer guten Verkehrsanbindung an Pendlerzentren mit flächendeckenden Neubauten in die Landschaft aus.
Opava. Die landwirtschaftlich geprägte Region der Schlesischen Tiefebene wurde zunehmend durch Opava als wichtiges regionales Zentrum beeinflusst. Obwohl Opava zur Zeit des Beginns der Industrialisierung wirtschaftlich hinter Krnov zurücklag, war es das Verwaltungszentrum von Österreichisch-Schlesien und eine Stadt der Schulen. Die städtebauliche Entwicklung erreichte an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt, als u.a. repräsentative Mietshausviertel entstanden. In den 1920er Jahren setzte sich die Entwicklung der Stadt mit dem Bau von Wohnvierteln fort. Die Region Opava litt jedoch stark unter den Kämpfen der sog. Ostrauer Operation am Ende des Zweiten Weltkrieges und die Stadt Opava wurde zu 70% zerstört. Der radikale Plan, der die Sanierung des restlichen historischen Kerns vorsah, wurde glücklicherweise nicht umgesetzt, aber viele Häuser, vor allem Jugendstilhäuser, wurden in den folgenden Jahren abgerissen. Die Urbanisierung der Nachkriegszeit respektierte den historischen Kontext nicht und in den 1970er und 1980er Jahren wurden hauptsächlich Plattenbausiedlungen gebaut. Auch die Vororte bzw. das ehemals eigenständige Dorf Kateřinky wurden mit Neubauten überlagert.
Auch die Region Opava ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts von Stagnation und Bevölkerungsrückgang geprägt, wenn auch in geringerem Maße als Jesenicko. Die Dörfer behielten jedoch in den 1950er Jahren noch ihren landwirtschaftlichen Charakter und die charakteristischen Merkmale von konzentrierten Dörfern mit in dünne Streifen unterteilten Feldern. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts änderte sich durch die Kollektivierung der Landwirtschaft der Charakter der Landschaft von einer Reihe schmaler Felder zu großen Feldern. Die ehemals ordentlichen, kompakten Dörfer in der Nähe von Opava begannen in die Landschaft zu wachsen (Otice, Slavkov, Kylešovice). Die Suburbanisierungstendenzen haben sich seit dem Jahr 2000 verstärkt, aber die weiter entfernten Dörfer haben noch immer ihren ursprünglichen Charakter behalten (Brumovice, Loděnice, Tábor).

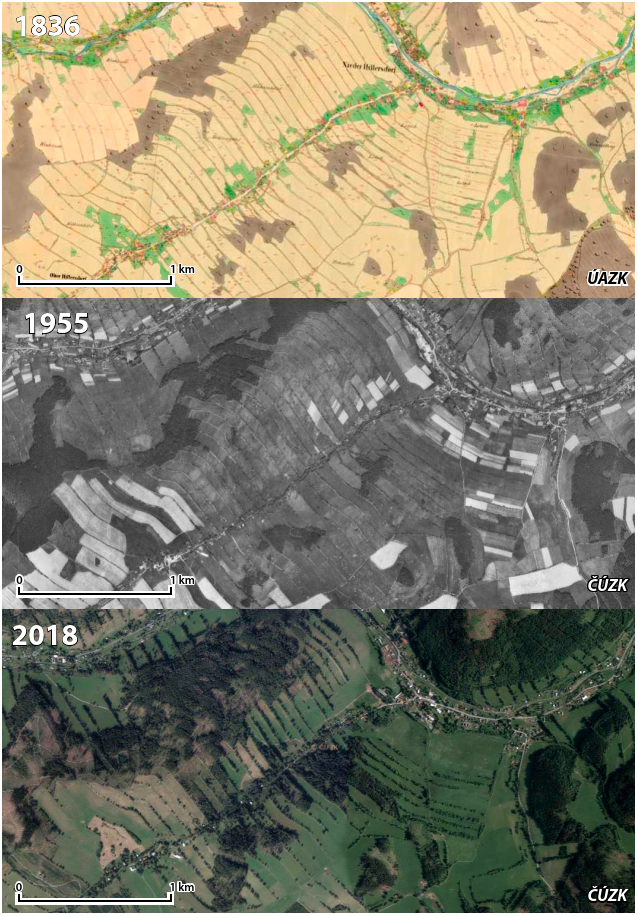
Fryštát (Karviná) und Těšín. Der östliche Teil von Tschechish-Schlesien hat seit Beginn der Industrialisierung die schnellste Entwicklung durchgemacht, die vor allem mit dem Kohlebergbau und der Schwerindustrie verbunden ist. In den Regionen Ostrava, Bohumín und Fryštát haben zwei Drittel der Dörfer ein explosives Wachstum erfahren, unter anderem dank der Zuwanderung aus Halych. Neben den Städten nimmt auch in den Dörfern in Reichweite der Arbeitsmöglichkeiten die Bevölkerungsanzahl zu. Unregelmäßige Kettendörfer und verstreute Wohnsiedlungen beginnen sich zu verdichten. Die Möglichkeit, sich anders zu vergnügen als durch die Arbeit auf den Feldern, hat die landwirtschaftliche Tradition und die soziale Struktur umgeworfen. Es kam zu einer bis dahin undenkbaren Teilung der Felder, da der Ertrag aus der Ernte nur eine Ergänzung zum Familieneinkommen war. Die Verteilung der Gehöfte erfolgte meist spontan und war an lokale Straßen gebunden. Dennoch lassen sich auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den meisten großen Industriegebieten noch erhebliche Unterschiede in der Wohndichte beobachten, vor allem in der Nähe von Bergwerken, wo Bergbaukolonien entstanden sind (Rychvald, Petřvald, Orlová-Poruba) und an abgelegeneren Orten, wo die Bebauung noch relativ spärlich ist (Střítež, Návsí, Vendryně). Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verdichtet sich die Wohnbebauung auch außerhalb der Industriezentren und verliert im größten Teil des Gebietes ihren ursprünglichen Charakter der Streusiedlung und der großen Abstände zwischen den einzelnen Gehöften und bedeckt nach und nach fast das gesamte Kataster.
Die Landschaft von Karviná hat sich am meisten verändert. Infolge der Bergbautätigkeit und ihrer Folgen sind Teile von Siedlungen (Orlová) oder ganze Siedlungen (die ursprüngliche Karviná) verschwunden. Das neue Karviná begann als erste der neuen Siedlungen von Ostrava bereits 1947 zu entstehen, als nördlich von Fryštát die Satellitenstadt Stalingrad, später Nové Město genannt, mit einem axialen Boulevard, der Allee der Befreiung gegründet wurde. Infolgedessen stieg die Bevölkerung zwischen 1950 und 1961 von etwa 8.500 auf etwa 27.800. Im Rahmen der kontrollierten Entwicklung der Brennstoffbasis begannen die ersten Siedlungen mit sogenannten zweistöckigen Häusern in erreichbarer Entfernung von den Gruben zu entstehen. Im Jahr 1955 wurde beschlossen, dass die Siedlungen in Šumbark und Dolní Bludovice zu einer neuen Stadt zusammengelegt werden, für die der Name Havířov gewählt wurde. Die Achse der städtebaulichen Komposition wurde der Boulevard Hlavní třída, früher die Těšín-Straße.
Nach einem durchdachten Stadtplan, entstand viel früher, in den 1920er und 1930er Jahren des 20. Jahrhunderts Český Těšín, nachdem Těšín durch die Staatsgrenze geteilt wurde und sein historisches Zentrum auf der polnischen Seite blieb. Das Stadtzentrum wurde gebaut. Die Hauptstraße und der rechteckige Hauptplatz mit dem Rathaus (1929) wurden zur Grundlage der Zusammensetzung der Stadt, die zwischen der Eisenbahn und dem Fluss Olše liegt. Der zentrale Teil der Stadt wurde im Süden durch die heutige Střelniční Straße begrenzt, aber eine lockerere Vorstadtbebauung setzte sich weiter südlich zwischen der Eisenbahn und dem Fluss und auch westlich der Eisenbahn fort. Dieser Teil der Stadt ist durch den Dreizack der Straßen Ostravská, Frýdecká und Jablunkovská gekennzeichnet, später ergänzt durch die Straße nach Fryštát. Ein Beispiel für ein Dorf, das 1930 zu einer Stadt wurde, ist Třinec. Die Bedeutung der Siedlung wuchs dank der Errichtung eines Hütten- und Eisenwerkskomplexes in den späten 1840er Jahren, aus dem später die Třinec-Hütte hervorging.
2. RÄUMLICH-GEOGRAFISCHER KONTEXT
INHALT DES KAPITELS
2.1 Geologie
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
2.2 Geomorphologie
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
2.3 Gewässer
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
2.4 Klima
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
2.5 Vegetation
Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D. (SZM)
2.6 Vegetation - nicht heimische und invasive Pflanzen
Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D. (SZM)
2.7 Begleitende (synanthrope) Tiere
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
2.8 Invasive Arten
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
2.9 Gefährdete und seltene Tiere
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
2.10 Einwanderer
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
2.11 Kuriositäten und Raritäten
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
2.12 Rückkehrer und Verschwundene
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
2.2 Geomorphologie
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
2.3 Gewässer
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
2.4 Klima
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
2.5 Vegetation
Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D. (SZM)
2.6 Vegetation - nicht heimische und invasive Pflanzen
Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D. (SZM)
2.7 Begleitende (synanthrope) Tiere
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
2.8 Invasive Arten
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
2.9 Gefährdete und seltene Tiere
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
2.10 Einwanderer
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
2.11 Kuriositäten und Raritäten
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
2.12 Rückkehrer und Verschwundene
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
2.1 Geologie
Schlesien zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Vielfalt der geologischen Struktur aus, da sich hier zwei große geologische Einheiten - das Böhmische Massiv und die Westkarpaten - überschneiden. Dies hängt mit den geologischen und mineralogischen Bedingungen zusammen. Von grundlegender Bedeutung für die geologische Entwicklung des Böhmischen Massivs war der herzynische oder variszische Gebirgsbildungszug, der vor etwa 380 bis 300 Millionen Jahren vom Oberdevon bis zum Unterperm stattfand. Das am besten erhaltene Überbleibsel des variszischen Gebirges ist das Böhmische Massiv. Die variszischen gebirgsbildenden Prozesse formten es zu einer festen Einheit, die später nicht mehr gefaltet wurde und allmählich von mesozoischen und tertiären Sedimenten überlagert wurde. Seine heutige Form erhielt es im Quartär, hauptsächlich durch die Vergletscherung und die anschließende Bildung des Flussnetzes.
Proterozoikum (Urgebirge). Zu dieser ältesten geologischen Periode gehören die variszische Orogenese mit stark überarbeiteten Gesteinen in den Kernen der Gewölbekonstruktionen oder Fachwerke im metamorphen Schlesien im Groben Jeseník (Desen- und Keprinisches Gewölbe).
Paläozoikum (Frühgeschichte). In der mährisch-schlesischen Region sind devonische Gebirge weit verbreitet, die in zahlreichen Oberflächenaufschlüssen im Rauen und Niederen Jeseník aufgeschlossen sind. Eine interessante devonische Fauna kommt aus Chabičov und Horní Benešov.
Im Unterkarbon überwiegen vollständig marine Sedimente (Kulm-Fazies), während im Oberkarbon Süßwassersedimente vorherrschen, was klimatische Veränderungen und die Auswirkungen der gebirgsbildenden Bewegungen der variszischen Faltung widerspiegelt. Die Ablagerungen des Unterkarbons haben ihre größte Ausdehnung im Niederen Jeseník, wo sie vor allem im Schiefer und Kies oder in der Kulm-Formation entwickelt sind. Das Meer war in unserer Gegend im Unterkarbon vor etwa 340 Millionen Jahren vorhanden. Marine Die Fauna ist relativ artenarm und hat an vielen Stellen (Zálužné, Nové Těchanovice, Lhotka) eine ähnliche Zusammensetzung. Im Oberkarbon, vor etwa 320 Millionen Jahren, wurde das Gebiet von Mähren und Schlesien trocken. Es bildete sich eine riesige Hochebene, die wir heute als Oberschlesisches Becken bezeichnen. Damals befand sich das Gebiet in der Nähe oder direkt am Äquator, das Klima war feucht und warm und die Hochebene war von Vegetation überwuchert. Es entstand der Karbonwald, eines der bemerkenswertesten terrestrischen Ökosysteme in der Geschichte der Erde. Dank des warmen und feuchten Klimas entstand aus der Masse der Karbonpflanzen schwarze Holzkohle mit einer Fülle von Pflanzen- und Tierfossilien.
Mesozoikum (Erdmittelalter). Eine bemerkenswerte Periode des Mesozoikums war der Oberjura, vor 150 Millionen Jahren entwickelte sich in einem flachen tropischen Meer ein organogenes Riff, das aus massiven, aufgerollten Muschelschalen und Korallen bestand (Kotouč bei Štramberk).
Drei Stacheln. Das Meer, das zuletzt im jüngeren Tertiär durch Mähren und Schlesien strömte, hinterließ nach seinem Rückzug vor 14-13 Millionen Jahren in den Tonsedimentschichten der Opava-Bucht Fossilien verschiedener Mollusken, vor allem aber vollständige Fischskelette. Durch die Ausfällung von Mineralsalzen aus übersättigtem Meerwasser entstanden Gipslagerstätten (Opava-Kateřinky, Kobeřice).

Im zentralen Teil des Niederen Jeseník liegt eine Gruppe von Vulkanen, die an der Grenze zwischen dem Tertiär und Quartär aktiv waren. Die Entstehung der Vulkankörper im Tertiär und Quartär steht im Zusammenhang mit der intensiven gebirgsbildenden Tätigkeit der Alpenfaltung in Süd- und Osteuropa. Die Vulkane haben den Charakter von Stratovulkanen, d.h. von Mischvulkanen (Velký Roudný, Uhlířský vrch, Mezina).
Das Quartär begann vor etwa 1,8 Millionen Jahren und dauert noch an. Im älteren Quartär (Pleistozän) wechselten sich Perioden warmen Klimas mit Perioden globaler Abkühlung ab. Während der Eiszeiten (Glaziale) dehnten sich die Kontinental- und Gebirgsgletscher aus und schmolzen in den Warmzeiten (Interglaziale) wieder ab. In Schlesien und Nordmähren griffen die Kontinentalgletscher während zweier Eiszeiten in das Gebiet ein, die dem Mittelpleistozän zugeordnet werden.
In Schlesien gibt es Minerale von Eruptivgesteinen und Begleitminerale, die aus heißen Lösungen entstanden sind (hydrothermale Minerale), Minerale von umgewandelten (metamorphisierten) Gesteinen, Minerale in Sedimentgesteinen und rezente Minerale, d.h. in der Gegenwart entstandene Minerale. Die Meteoreisen von Opava gelten als einzigartig in der Welt; ihre Einzigartigkeit liegt darin, dass sie 1925 im Kontext einer 18.000 Jahre alten paläolithischen Siedlung gefunden wurden. Einzigartig ist auch der Fund mehrerer Fragmente eines Steinmeteoriten in der Gemeinde Morávka im Jahr 2000.
2.2 Geomorphologie
Die Landschaft Schlesiens und der angrenzenden Teile Nordmährens ist äußerst vielfältig und weist unterschiedliche geologische Reliefs auf, die von Ebenen und Tieflandhügeln bis zu den Hochebenen des Hrubý Jeseník-Gebirges und der Mährisch-Schlesischen Beskiden reichen. Hier treffen drei geomorphologische Provinzen aufeinander: das Böhmische Mittelgebirge im Nordwesten und die Westkarpaten im Südosten, wobei im Norden ein relativ kleiner Ausläufer des Mitteleuropäischen Tieflandes dazwischen liegt.
Neben den tektonischen Bewegungen trug auch die vulkanische Tätigkeit an der Grenze zwischen Tertiär und Quartär wesentlich zur Entwicklung des Reliefs der schlesischen Landschaft bei. Aus Sicht der Geomorphologie war die quartäre Vergletscherung entscheidend für die heutige Landschaft Schlesiens und trug wesentlich zur Modellierung des Geländes sowie zur späteren Bildung des Flussnetzes bei. Die kontinentale Vergletscherung betraf Schlesien und Nordmähren während des Mittelpleistozäns. Nach seinem Rückzug blieben mächtige Lehm-, Sand- und Kiesschichten zurück, die sowohl kleinere Stücke nordischer Gesteine als auch vom Gletscher über unterschiedliche Entfernungen transportierte Streublöcke enthalten. Infolge der intensiven Frostverwitterung im Gletschervorland während der Eiszeit bildeten sich im Jeseník Gebirge markante Felsdominanten, die sog. Frostsäulen (Peterssteine, Vozka, Riesenfelsen und der Gipfel des Keprník). Das frostige Klima trug auch zur Entstehung spezifischer Landformen wie Steinmeere (Břidličná, Ztracené kameny, Suchý vrch) oder frostsortierter Böden auf den Hügeln bei. Durch die direkte Einwirkung des Gebirgsgletschers entstand der Karst des Großen Beckens, ein einzigartiger Ort, an dem noch heute Lawinen abgehen und die Schneereste stellenweise bis in den Juli hinein liegen bleiben. Wegen der Undurchlässigkeit des Grundgesteins entstanden in der Nacheiszeit auf dem Rejvíz und zwischen Keprník und Vozka Torfmoore.
Neben dem Frost haben zahlreiche Prozesse - Wasser- und Winderosion, Überschwemmungen, Erdrutsche und andere - zur Bildung des Georeliefs beigetragen. Neben den Formen, die sich im gegenwärtigen Klima gebildet haben, sind auch Formen erhalten geblieben, die unter verschiedenen Bedingungen vergangener geologischer Zeiten entstanden sind. Das Relief ist also das Ergebnis des Zusammenwirkens von endogenen und exogenen geologischen Prozessen in Raum und Zeit. In den letzten Jahrhunderten wurde das ursprüngliche Relief jedoch zunehmend durch menschliche Aktivitäten verändert, wobei der Einfluss des Menschen stetig zunahm. Seit Beginn des Holozäns hat der Mensch die natürlichen Bedingungen der Relief- und Landschaftsentwicklung zunehmend verändert. Seine Aktivitäten haben die Landschaft beeinflusst, indem er direkt oder indirekt natürliche geomorphologische Prozesse beeinflusste, indem er unbeabsichtigt Oberflächenformen und bewusst neue Formen schuf. Indirekte Auswirkungen entstehen durch die Störung des Gleichgewichtes der Geosysteme als Folge unangemessener wirtschaftlicher Aktivitäten (Abholzung, Holzeinschlag und Anbau, Landgewinnung). Zu den direkten Auswirkungen des Menschen auf das Georelief gehören vor allem Formen, die mit seiner bergbaulichen, industriellen und landwirtschaftlichen Tätigkeit verbunden sind (Halden, Abraumhalden, Steinbrüche, Senkungsmulden).

Die schlesische Landschaft bietet dem Besucher eine Vielzahl von unterschiedlichen geomorphologischen Formen, von denen viele beliebte touristische Ziele sind. Im Zusammenhang mit der geomorphologischen Entwicklung des Gebietes ist das Vorhandensein von Karsterscheinungen zu erwähnen - Höhlen sind eine der häufig besuchten Naturattraktionen. In den kristallinen Kalksteinen am nordöstlichen Rand des Hornolipovský Hochlandes haben sich bedeutende Karsterscheinungen entwickelt. Die Höhle Na Pomezí mit ihrem reichen Tropfsteinaufschluss und der schroffen Modellierung ist die größte Karsthöhle im kristallinen Kalkstein in der Tschechischen Republik. Der bemerkenswerte Marmorkarst mit der Höhle Na Špičák befindet sich in der Nähe der Gemeinden Písečná und Supíkovice in der Region Jeseniky. Obwohl der Tropfsteinschmuck der Höhle lange vor der Erschließung der Höhle zerstört wurde, haben die Höhlengänge ein typisches herzförmiges Profil, das durch das Schmelzwasser des Kontinentalgletschers entstanden ist. Bemerkenswert sind auch die Pseudokarsterscheinungen, die in einem kleinen Gebiet in der Nähe des Dorfes Matějovice oberhalb des Baches Hrozová (Matějovice-Höhlen) auftreten. Andererseits ist der Pseudokarst der Beskiden einer der größten der Welt in der Kategorie Sandstein (Kněhyňská jeskyně, Ondrášošovy díry). Wasserfälle bilden sich oft in den tiefen Tälern von Wasserläufen. Zu den schönsten gehören die Rešov-Wasserfälle am Fluss Huntava, die Wasserfälle der Weißen Opava (einschließlich des künstlichen Wasserfalls in Karlova Studánka), der jetzt teilweise hohe Wasserfall am Studené potok oder die Nýznerov-Wasserfälle im Tal des Stříbrný potok. Der Charakter einiger Täler wurde grundlegend durch den Bau von großen Stauseen verändert. Die Landschaft des Hrubý Jeseník wurde durch den Bau des Pumpspeicherwerkes Dlouhé Stráně auf außergewöhnliche Weise verändert.
2.3 Gewässer
Wasser ist in der Landschaft extrem wichtig, und das Relief der Landschaft wurde auch durch den wesentlichen Beitrag von fließendem Wasser geschaffen. Die Flusslandschaft ist eine Gesamtheit von Ökosystemen, deren Funktionieren direkt durch das Vorhandensein des Flusses in der Landschaft bestimmt wird; auch die menschliche Besiedlung war in der Vergangenheit hauptsächlich entlang von Wasserläufen konzentriert. Schon früh begann der Mensch, sich die Energie des Wassers zunutze zu machen. Mit der Entwicklung der Industrie und besonders während der Industrialisierung im 20. Jahrhundert wurden die Flüsse oft verschmutzt. Dies hat verständlicherweise große Auswirkungen auf das Ökosystem der Fließgewässer, die artenreiche Lebensgemeinschaften bilden, die jedoch sehr empfindlich auf Wasserverschmutzung und andere unsachgemäße Eingriffe reagieren. In Anbetracht der Bedeutung des Wassers in der Landschaft wird nun darauf geachtet, es zu schützen.
Der Fluss Ostravice entsteht durch den Zusammenschluss des weißen und schwarzen Ostravice. Die Weiße Ostravice, die als Quelle gilt, entspringt in der Ortschaft Bílá-Hlavatá. Ab der Einmündung in die Schwarze Ostravice fliest der Fluss unter dem Namen Ostravice weiter. Vor dem Bau der Dämme war die Ostravice einer der am stärksten geteilten Bäche in der Tschechischen Republik und der Verlauf von Hochwassern war hier oft katastrophal. Der Fluss Opava entspringt aus dem Zusammenfluss der Mittleren und Schwarzen Opava in Vrbno pod Pradědem, wobei die Bílá Opava ein weiterer Quellfluss ist. Die Opava hat viel stabilere Bedingungen als vergleichbare Bäche im Gebiet der Beskiden. Die Moravice entspringt im Großen Becken im Nationalpark Praděd und hat fast auf ihrer gesamten Länge den Charakter eines Gebirgsbaches. Sein Hauptzufluss ist der Fluss Hvozdnice. Der Fluss Olše entspringt als einziger der fünf Hauptströme des Einzugsgebietes nicht auf tschechischem Staatsgebiet, sondern auf dem Gebiet der benachbarten Republik Polen; er tritt in der Nähe des Dorfes Bukovec in die Tschechische Republik ein.
Auch in Schlesien wurden künstliche Wasserreservoirs angelegt. Zunächst Teiche oder ganze Teichsysteme (Jistebnice-Teiche, Polanec-Teiche und Svinov-Teiche), später kleinere Stauseen und große Wasserwerke (Kružberk und Slezská Harta an der Moravice, Morávka an der Morávka, Šance an der Ostravica, Žermanice an der Lučina, Olešná an der Olešná und Těrlicko an der Stonávka). Die Stauseen beeinflussen wesentlich den Charakter des Baches, an dem sie liegen, sowohl oberhalb als auch besonders unterhalb des Stausees. Bestimmte Gewässer sind Standorte, die dem Bergbau unterliegen (künstliche Wasserseen, geflutete Dolinen und geflutete Steinbrüche).

In Überschwemmungsgebieten von Flüssen und Bachauen oder an Stellen mit beeinträchtigtem Abfluss und erhöhtem Grundwasserspiegel entstehen Flachwasserspeicher und Tümpel. Typische Übergangslebensräume zwischen aquatischen und terrestrischen Ökosystemen sind Feuchtgebiete, d.h. Flächen, deren Boden ständig oder für eine bestimmte Zeit des Jahres mit Wasser gesättigt oder überflutet ist. Ein wichtiges Projekt, das der schlesischen Landschaft zuvor durch Landgewinnung degradierte Flächen und Feuchtgebiete zurückgegeben hat, sind die Kosmischen Vogelwiesen. Torfmoore sind ein spezieller Typ von Feuchtgebieten, die auf abgestorbenen Schichten von Moosen basieren, insbesondere Torfmoore (Rejvíz).
Quellen (sowohl einfache als auch mineralische), Bäche und ihre Auen sowie Feuchtgebiete sind ökologisch, geomorphologisch und ästhetisch wertvolle Bestandteile der Landschaft, prägen ihr typisches Erscheinungsbild und tragen zur Erhaltung ihrer Stabilität bei. Viele Fließgewässer haben zumindest einen Teil ihres ursprünglichen Charakters behalten und sind zur Heimat geschützter und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten geworden. Der Mensch ist nicht immer verantwortungsvoll mit dem Ökosystem Fluss umgegangen und in der Vergangenheit wurden in vielen Bächen unangemessene Eingriffe vorgenommen. Glücklicherweise fand in den letzten Jahren auch eine durchdachte Revitalisierung der Bäche und ihrer Ökosysteme statt.
2.4 Klima
Unter dem Begriff Klima oder Witterung versteht man allgemein das langfristige charakteristische Regime der atmosphärischen Zirkulation. Sie wird durch die Durchschnittswerte der Klimavariablen (Temperatur, Niederschlag usw.), den Grad ihrer Streuung und Variabilität und andere statistische Daten beschrieben. Das Klima der Tschechischen Republik ist durch das seltene Durchdringen und Vermischen von ozeanischen und kontinentalen Einflüssen gekennzeichnet. Der Küsteneinfluss manifestiert sich vor allem in Böhmen, während in Mähren und Schlesien zunehmend kontinentale Klimaeinflüsse zu beobachten sind. Da das Klima insbesondere für die Pflanzenproduktion von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist, ist die Überwachung seiner Entwicklung für die gesamte Gesellschaft wichtig.
Lufttemperatur. Die nördlichen Randgebiete und das Ostrauer Becken sind die wärmsten in Tschechisch-Schlesien. Die Jahresdurchschnittstemperaturen liegen hier bei 8-9 °C. Am kältesten sind die oberen Teile des Hrubý Jeseník-Gebirges, wo die Jahresdurchschnittstemperatur unter 2 °C (Praděd 1,1 °C) fällt. Eine einfache kontinentale Welle ist typisch für das Jahresmuster, mit der höchsten Durchschnittstemperatur im Juli und der niedrigsten im Januar, wobei der August den absolut höchsten Monatsdurchschnitt aufweist. Der Niederschlag ist durch eine erhebliche räumliche und zeitliche Variabilität gekennzeichnet. Dies ist auf die Wechselwirkung zwischen den physikalischen Prozessen ihrer Entstehung, der atmosphärischen Zirkulation und den geografischen Eigenschaften des Gebiets zurückzuführen. Die Intensität der Niederschläge ist im Sommer generell höher als im Winter. Was die geographische Verteilung der Niederschläge betrifft, so sind die höchsten Monats-, Saison- und Jahressummen in den oberen Teilen der Mährisch-Schlesischen Beskiden und des Hrubý Jeseník-Gebirges zu finden. Hier kommt es zu einer sogenannten orographischen Niederschlagsintensivierung, bei der sich die abfließenden Luftströmungen beim Überströmen der Gebirge verstärken und unter den richtigen Bedingungen mehr Niederschlag produziert wird. Aus diesem Grund ist Lysá hora der regenreichste Ort in Mähren und Schlesien. Die Windverhältnisse in Schlesien werden durch seine Lage im Bereich der vorherrschenden Westströmung bestimmt. Die Richtung und Geschwindigkeit der Strömung wird durch die Form des Reliefs beeinflusst. Die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten während des Jahres sind im Allgemeinen im Dezember und Januar oder März und April am höchsten, wobei die Geschwindigkeiten von Oktober bis April höher sind als in den anderen Monaten.
Die meteorologischen und hydrologischen Stationen in Schlesien werden von der Zweigstelle des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts in Ostrava verwaltet, die auch die Ergebnisse ihrer Beobachtungen archiviert. Auf dem Lysá hora werden seit 1897 Messungen durchgeführt. Die meteorologischen Beobachtungen haben im Jeseníky-Gebirge eine lange Tradition. Die ersten klassischen meteorologischen Messungen wurden auf Berghütten (Rabštejn-Hütte, Alfréd-Hütte) durchgeführt. Im Gebiet des Praděd begann die erste kontinuierliche Beobachtung 1933 in Ovčárna und dauerte bis 1938. In den Jahren 1941-1951 (mit Ausnahme eines Jahres) wurde die Beobachtung am Steinturm des Aussichtsturms auf dem Gipfel des Praděd durchgeführt, in späteren Jahren an einer separaten meteorologischen Station. Allerdings beeinflusste der Gebäudekomplex hier die Messergebnisse negativ, so dass die ursprüngliche meteorologische Station auf dem Praděd im Jahr 2004 durch die Station Šerák ersetzt wurde.


Die weitere Entwicklung des Klimas, einschließlich der hydrometeorologischen und geomorphologischen Extreme in Schlesien, wird natürlich wesentlich von der Entwicklung des Erdklimas beeinflusst. Im Zusammenhang mit dem Prozess der globalen Erwärmung können wir eine signifikante Zunahme von extremen hydrometeorologische Phänomene verzeichnen.
2.5 Vegetation
Die potenzielle natürliche Vegetation auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien besteht vor allem aus Laubwäldern verschiedener Arten, insbesondere aus blühenden Buchenwäldern, säurehaltigen Buchenwäldern, Tannenwäldern und feuchten Eichen-Buchenwäldern auf dem Gebiet von Ostrava. In der Region Opava überwiegen Eichenwälder und Lindenwälder. Zu den weniger häufigen Gemeinschaften gehören auch schattenlose Eichenwälder und noch seltener sind Stier- oder Tannen-Eichenwälder. In den Beskiden und im Gesenke handelt es sich bei den potentiellen Naturgemeinschaften vor allem um Klimax- und feuchte Fichtenwälder mit kleineren Torfmooren. In den höchsten Teilen des Gesenkes handelt es sich um subalpine und alpine Gemeinschaften. Entlang der Wasserläufe sind Auenwälder aus Eschen und Ulmen-Eichenwäldern potenziell natürliche Lebensgemeinschaften.
Erwärmung gegeben, die mit dem Rückzug des Gletschers verbunden ist. Dies war natürlich mit der Einwanderung von Pflanzenarten verbunden, die nach und nach Teil unserer Flora wurden und es immer noch sind. Darüber hinaus wurde die natürliche Entwicklung von Lebensgemeinschaften in der Vergangenheit und auch heute in hohem Maße von anthropogenen Aktivitäten beeinflusst, was das Vorkommen von Pflanzengemeinschaften, die ohne menschlichen Einfluss in der Landschaft nicht vorhanden gewesen wären, stark beeinflusst hat. Dies geht Hand in Hand mit der Ausbreitung nicht heimischer und invasiver Arten, die zu einem Verlust der Artenvielfalt oder zu Problemen bei ihrer Ausrottung führen können. Andererseits ist es aber auch das Vorhandensein von z.B. Grünland, das einer Reihe von seltenen Arten einen geeigneten Lebensraum bietet.
Um die wertvollsten territorialen Komponenten der Pflanzengesellschaften in Tschechisch-Schlesien aufzulisten, reicht es daher aus, wenn wir uns an die Liste der Landschaftsschutzgebiete, Schutzgebiete Jeseníky, Beskydy und Poodří halten. Dann können wir für kleinere Einheiten von Schutzgebieten weitermachen. Unter den wichtigsten können wir zum Beispiel Radhošt', Mionší, Polanská Niva, Skalická Morávka, Rejvíz, Landek, Hněvošický háj und andere nennen.
Das Landschaftsschutzgebiet der Beskiden ist größtenteils mit Waldvegetation bedeckt, aber leider auch mit überwachsener Kulturvegetation. Natürliche Bestände blühender Buchen sind nur sporadisch in höheren Lagen in Mazák, Radhošt' und Mazácké Grúnik erhalten. Die nicht aus Wäldern bestehende Vegetation besteht dann meist aus Wiesen- und Feuchtgebietsgemeinschaften, Haferwiesen in tieferen Lagen und ehemaligen Weiden in höheren Lagen.
Die Entwicklung der Flora im Landschaftsschutzgebiet Gesenke wurde stark von der letzten Eiszeit beeinflusst, als sich die Gletscher ausdehnten und wieder zurückzogen. Obwohl sich die Gletscher zurückgezogen haben, haben die große Höhe und die niedrigen Temperaturen Gesenke die Erhaltung vieler reliktischer Pflanzenarten ermöglicht, die auch heute noch überleben. An Stellen, an denen Buchenwälder vorkommen sollten, überwiegen jedoch immer noch sekundäre Fichtenwälder.
Den Hauptteil des Landschaftsschutzgebietes Poodří bildet der unregulierte Teil des Flusses Odra mit seinen Mäandern, blinden Armen und kleinen Inseln. Der größte Teil des Gebietes ist von Feuchtbiotopen bedeckt, aber auch Auenwälder sind eine potentielle Vegetationsquelle.
2.6 Vegetation - nicht heimische und invasive Pflanzen
Nicht heimische und invasive Pflanzenarten begleiten die menschliche Spezies seit Tausenden von Jahren, aber heutzutage, da wir um die Welt reisen, kommt es viel häufiger vor, dass Pflanzen, die von sich aus nicht in der Lage wären, geografische und andere Barrieren zu überwinden, neue Gebiete besetzen, die ihnen vorher unzugänglich waren. Was die Besiedlung des Territoriums der Tschechischen Republik betrifft, so wurde und wird sie wesentlich durch die Lage im Zentrum Europas beeinflusst, wo eine Reihe von natürlichen und vom Menschen geschaffenen Migrationsrouten verlaufen, die ihre Ausbreitung erleichtern können. Andererseits muss man auch hinzufügen, dass die Tschechische Republik, wie der Rest Europas, eher eine Quelle für die Ausbreitung nicht heimischer Pflanzen ist als ein Empfänger derselben.
Nicht heimische Arten in unserer Flora können weiter in Archäophyten und Neophyten unterteilt werden. Erstere, die Archäophyten, werden oft nicht einmal mehr als nicht heimisch angesehen; zu ihnen gehören sogar die Brennnessel (Urtica urens) oder der Mohn (Papaver rhoeas), von denen nur wenige sagen würden, dass sie nicht in unser Land gehören. Mehr noch: Einige dieser Arten gelten heute sogar als selten, wie zum Beispiel der Ackerschwanz (Agrostemma githago). Archäophyten werden hauptsächlich mit Feldfrüchten und der Ausbreitung von Pflanzen durch Bauern aus dem Nahen Osten und dem Mittelmeerraum in Verbindung gebracht. Im Gegensatz zu Neophyten handelt es sich dabei um Pflanzen, die vor der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus eingeführt wurden (der Zeitraum bis 1500 wird vereinfachend als Grenze genommen), und, wie bereits erwähnt, würde man oft nicht einmal sagen, dass Archäophyten nicht heimische Pflanzen sind, da sie in der Regel schon so lange in der Natur vertreten sind, dass sie ihren Platz darin gefunden haben. Neophyten hingegen sind oft Pflanzen, die invasiv sind, viel Schaden anrichten können und sich auch unkontrolliert ausbreiten und heimische Arten verdrängen können. Oft handelt es sich dabei um Pflanzen, die absichtlich eingeführt wurden, wie Heracleum mantegazzianum oder Reynotruia. Dieser Prozess findet fast ständig statt, und es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Pflanzen aus den Gärten der Menschen ausbreiten, wo sie gepflanzt wurden, weil sie oft leicht zu züchten sind, den Winter überstehen und auch leicht zu vermehren sind. Bei besonders gefährlichen Invasionen kann sich die Art so unkontrolliert ausbreiten, dass sie ganze Gemeinschaften und Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringt und zu weitreichenden ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen oder gesundheitlichen Schäden führt. Die Ausbreitung nicht heimischer Arten stellt auch ein Risiko für die Erhaltung der biologischen Vielfalt dar, sowohl auf der Ebene der Arten als auch auf der Ebene ganzer Gemeinschaften.
Als am stärksten bedrohte Orte in der Landschaft gelten solche, die von menschlichen Aktivitäten beeinflusst werden: Straßenränder, Eisenbahnkorridore, Städte oder Orte, die allgemein in irgendeiner Weise gestört sind. Häufig verbreiten sich diese Arten entlang von Flussbetten und Bächen, die als gute Verbreitungswege für einige Arten von invasiven Pflanzen dienen. Was die schlesische Landschaft betrifft, so treffen wir auf verschiedene Spezifika. Zunächst einmal gibt es Phänomene wie von Bergbauaktivitäten betroffene Orte, Abraumhalden, Bodensenkungen oder Halden.

Nach Angaben der Agentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik können von den insgesamt 1.454 in der Tschechischen Republik vorkommenden nicht heimischen Pflanzenarten 61 als invasiv angesehen werden, wobei 20 Arten die wichtigsten sind. Im Einzelnen sind dies das Beifussblättrige Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia), der Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum), die Weymouth-Kiefer (Pinus strobus), der Eschen-Ahorn (Acer negundo), der Böhmische Staudenknöterich (Reynoutria bohemiana), der Japanische Staudenknöterich (Reynoutria japonica), der Sachalin Staudenknöterich (Reynoutria sachalinen-sis, der Gemeine Bocksdorn (Lycium barbarum), der Zurückgebogene Amarant (Amaranthus retroflexus), das Kleine Springkraut (Impatiens parviflora), das Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera), der Götterbaum (Ailanthus altissima), das Kleinblütige Knopfkraut (Galinsoga parviflora), die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina), Topinambur (Helianthus tuberosus), die Gewöhnliche Rubinie (Robinia pseudacacia), der Schlitzblättrige Sonnenhut (Rudbeckia laciniata), die Vielblättrige Lupine (Lupinus polyphyllus), die Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) und die Riesen-Goldrute (Solidago gigantea). Für die ausgewählten invasiven Pflanzen führen wir deren Vorkommen basierend auf Daten aus der Funddatenbank (AOPK 2018) dar.
2.7 Begleitende (synanthrope) Tiere
Seit dem Ende der letzten Eiszeit greift der Mensch in die Entwicklung der natürlichen Gegebenheiten ein. Die Erwärmung hat einen Übergang zur Schaf- und Landwirtschaft ermöglicht, die die Landschaft verändert haben. Die bedeutendste Veränderung ist die Abholzung der Wälder. Mit den Bauern kamen die ersten Synanthropen. In den folgenden Jahrhunderten entwickelten sich allmählich der Transport und die anschließende Verbreitung anderer Arten. Synanthrope Arten sind solche, die menschliche Siedlungen für ihren gesamten oder einen Teil ihres Lebenszyklus nutzen.
2.8 Invasive Arten
Invasive Arten sind vom Menschen eingeführte nicht heimische Arten, die in der Mischung mit nicht heimischen Arten so erfolgreich sind, dass sie ganze heimische Ökosysteme stören oder das Überleben von Populationen heimischer Arten bedrohen. Ihre Verbreitung kann sowohl absichtlich als auch unabsichtlich durch sogenannte Einschleppungen erfolgen. Sie stehen auf der gegenüberliegenden Seite des Schutzspektrums von gefährdeten Arten und sind für die Natur gefährlich.
2.9 Gefährdete und seltene Tiere
Der gravierendste Faktor, der derzeit die Existenz vieler Wirbeltierarten bedroht, ist der Einfluss des Menschen. Die Störung der ursprünglichen Umwelt hat die schwerwiegendsten Folgen für stenöke Arten, die sich perfekt an das Leben in spezifischen Lebensraumbedingungen angepasst haben. Darüber hinaus sind große, langlebige und sich langsam fortpflanzende Arten (sogenannte K-Strategen) und Arten, die selten oder endemisch sind, verstärkt bedroht.
2.10 Einwanderer
Nicht heimische Arten sind solche, die sich außerhalb ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes ausbreiten. Dies kann auf natürliche Weise oder mit Hilfe des Menschen geschehen. Die künstliche Ausbreitung wird als Einführung bezeichnet. Der Mensch verbreitet nicht heimische Arten entweder absichtlich oder unabsichtlich (sogenannte Einschleppung). Viele absichtlich eingeführte Arten sind vom Menschen gezüchtete Arten. Bei Pflanzen sprechen wir von kultivierten Arten, bei Tieren von domestizierten Arten.
2.11 Kuriositäten und Raritäten
Aufgrund seiner Lage ist Schlesien für viele interessante Tiere ein wichtiger Migrationsknotenpunkt. Das Gebiet ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der Mittelpolnischen Tiefebene und dem Westpannonischen Becken. Tausende von Jahren Geschichte, wechselnde Epochen, Eiszeiten mit Interglazialen und menschliche Aktivitäten haben eine Umwelt geschaffen, die von einer Reihe einzigartiger Arten bewohnt wird. Einige von ihnen haben hier ihre größten tschechischen Populationen, andere sind nirgendwo sonst in der Tschechischen Republik zu finden.
2.12 Rückkehrer und Verschwundene
Viele Pflanzen- und Tierarten wurden bereits in der Vergangenheit durch menschliche Aktivitäten ausgerottet und dieser Prozess hält leider auch heute noch an. Immer mehr Arten verschwinden von der Oberfläche unseres Planeten. Obwohl Aussterbevorgänge (sog. Extinktionen) in der Erdgeschichte auch früher schon ohne Zutun des Menschen stattgefunden haben, ist es dem Menschen zu verdanken, dass die Zahl der betroffenen Arten rapide zugenommen hat und vor allem die Prozesse des Aussterbens sich ins Unermessliche beschleunigt haben.
3. LANDSCHAFT
INHALT DES KAPITELS
3.1 Natürliche Landschaft
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
3.2 Tschechish-Schlesien bei der 1., 2. und 3. Militärkartierung
RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.3 Digitales Modell des Reliefs des Untersuchungsgebietes
RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.4 Typologie der Kulturlandschaft von Tschechish-Schlesien und ihrer Elemente
RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU), Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D., Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
3.5 Charakter der Besiedlung von Tschechisch-Schlesien
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.6 Die Entstehung der Agglomeration Ostrava
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.7 Kriegsspuren in der schlesischen Landschaft
Mgr. Jana Horáková (SZM)
3.8 Das stählerne Herz der Republik 1948-1989
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.9 Die verlorene Identität des Siedlungsgebietes im 20. Jahrhundert
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU), Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
3.10 Schlesische Landschaft
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU), Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
3.11 Wiesen und Weiden
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.12 Gärten und Obstplantagen
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.13 Waldlandschaft
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.14 Forstwirtschaftliche Landschaft
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.15 Wälder in Gefahr
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.16 Stadtparks
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (SZM)
3.17 Schlossparks
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (SZM)
3.18 Baumreihen, Alleen und Gedenkbäume
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.19 Wasser und Mensch
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
3.20 Mineralwasser
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
3.21 Stauseen in Schlesien
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (SZM)
3.22 Industrielle und post-industrielle Landschaft
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.23 Industrielandschaft - Modellbeispiel Vítkovice
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.24 Steinabbau
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU), RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.25 Erzabbau
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU), RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.26 Steinkohlenbergbau
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka,Ph.D. (OU), RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.27 Die untergrabene Landschaft
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU), RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.28 Untergrabene Landschaft - Rekultivierung
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU), RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.29 Verkehrsentwicklung - Straßennetz
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.30 Verkehrsentwicklung - Eisenbahnen
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.31 Verkehrsentwicklung - Luftfahrt
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (SZM)
3.32 Natürliche Extreme und ihre Auswirkungen
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
3.33 Aktuelle natürliche und anthropogene Prozesse in der Landschaft
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.34 Zurück zur Natur - Bergwandern
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.35 Zurück zur Natur - Erholung und Sport
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
3.2 Tschechish-Schlesien bei der 1., 2. und 3. Militärkartierung
RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.3 Digitales Modell des Reliefs des Untersuchungsgebietes
RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.4 Typologie der Kulturlandschaft von Tschechish-Schlesien und ihrer Elemente
RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU), Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D., Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)
3.5 Charakter der Besiedlung von Tschechisch-Schlesien
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.6 Die Entstehung der Agglomeration Ostrava
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.7 Kriegsspuren in der schlesischen Landschaft
Mgr. Jana Horáková (SZM)
3.8 Das stählerne Herz der Republik 1948-1989
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.9 Die verlorene Identität des Siedlungsgebietes im 20. Jahrhundert
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU), Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
3.10 Schlesische Landschaft
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU), Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
3.11 Wiesen und Weiden
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.12 Gärten und Obstplantagen
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.13 Waldlandschaft
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.14 Forstwirtschaftliche Landschaft
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.15 Wälder in Gefahr
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.16 Stadtparks
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (SZM)
3.17 Schlossparks
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (SZM)
3.18 Baumreihen, Alleen und Gedenkbäume
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.19 Wasser und Mensch
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
3.20 Mineralwasser
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
3.21 Stauseen in Schlesien
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (SZM)
3.22 Industrielle und post-industrielle Landschaft
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.23 Industrielandschaft - Modellbeispiel Vítkovice
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.24 Steinabbau
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU), RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.25 Erzabbau
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU), RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.26 Steinkohlenbergbau
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka,Ph.D. (OU), RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.27 Die untergrabene Landschaft
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU), RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.28 Untergrabene Landschaft - Rekultivierung
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU), RNDr. Renata Popelková, Ph.D. (OU)
3.29 Verkehrsentwicklung - Straßennetz
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.30 Verkehrsentwicklung - Eisenbahnen
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.31 Verkehrsentwicklung - Luftfahrt
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (SZM)
3.32 Natürliche Extreme und ihre Auswirkungen
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)
3.33 Aktuelle natürliche und anthropogene Prozesse in der Landschaft
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.34 Zurück zur Natur - Bergwandern
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.35 Zurück zur Natur - Erholung und Sport
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM), doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
3.1 Natürliche Landschaft
Die natürliche Landschaft ist in unserem Land im Grunde nicht mehr vorhanden. Gebiete ohne sichtbare menschliche Präsenz sind selbst auf der Welt sehr selten. Landschaftsschutzgebiete sind den natürlichen Landschaften am nächsten. Der Zweck eines Landschaftsschutzgebietes ist es, die Landschaft, ihr Erscheinungsbild und ihre typischen Merkmale zu schützen, damit diese Werte eine ausgewogene Umwelt schaffen und das Naturerbe in bestmöglichem Zustand an künftige Generationen weitergegeben werden kann. In Schlesien gibt es drei solcher Gebiete - das Landschaftsschutzgebiet Beskiden, das Landschaftsschutzgebiet Gesenke und das Landschaftsschutzgebiet Poodří.
Das Landschaftsschutzgebiet Poodří besteht aus einem 34 km langen Streifen Schwemm- und Hügelland um den Fluss Oder im Oder-Teil der Mährischen Pforte. Dieses Gebiet ist vor allem wegen der Erhaltung des Wasserregimes außergewöhnlich. Die Oder bildet hier Mäander, die ständig geschlossen werden und neue Mäander entstehen. So entsteht ein einzigartiges Netzwerk aus alten Armen und Mäandern, ergänzt durch ein System aus Teichen und Entwässerungsgräben. Die Odertalaue ist auch ein natürlicher Überschwemmungsschutz des bebauten Gebietes, vor allem durch die Verlangsamung des Abflusses im mäandrierenden Bach und das Auslaufen in die unbebaute Aue. Die Hydrologie der Oder beeinflusst auf natürliche Weise die Feuchtgebietsökosysteme mit seltenen, für Feuchtgebietsbiotope spezifischen Wirbellosen- und Wirbeltiergemeinschaften. Trotz der Verschmutzung der Oder aus dem Einzugsgebiet kann sie mit ihrem hohen Selbstreinigungsvermögen noch relativ gut umgehen. Natürlich wurde und wird der Landschaftscharakter aller drei Schutzgebiete durch die direkte oder indirekte menschliche Nutzung, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, den Abbau und die Verarbeitung von Bodenschätzen, das Bauwesen, Freizeit- und Sportaktivitäten usw. beeinflusst. Der Schutz des Natur- und Kulturerbes dieser schönen Gebiete Schlesiens ist immer noch sehr aktiv.
Altvatergebirge, das den Kern des Landschaftsschutzgebietes Gesenke bildet, ist einer der drei Gebirgszüge in der Tschechischen Republik, die Höhen oberhalb der oberen Waldgrenze erreichen (sog. Hochgebirgswaldlosigkeit), und zugleich das waldreichste Landschaftsschutzgebiet im Lande. Die Waldbedeckung erreicht hier 80 % und neben Fichtenwäldern sind auch Fragmente von Buchenwäldern erhalten. Das Gesenke war ursprünglich nicht bewaldet, wodurch sich eine einzigartige Grenze, die an eine Parkanlage erinnert, gebildet hat.

Wasser spielt eine wichtige Rolle in der Landschaft. Obwohl die Wasserflächen nur einen kleinen Teil der Fläche des Landschaftsschutzgebietes Gesenke ausmachen, wurde das gesamte Gebiet zum Schutzgebiet der natürlichen Wasseransammlung erklärt. Es gibt viele Torfmoore in Naturschutzgebieten (Rejvíz, Skřítek), und aus Wasserquellen sind traditionelle Kurorte entstanden (Karlova Studánka, Jeseník, Lipová-lázně). Der Bau des Pumpspeicherkraftwerkes Dlouhé Stráně hatte einen großen Einfluss auf die lokale Landschaft. Die wertvollsten Flächen des Landschaftsschutzgebietes sind in 4 nationalen Naturschutzgebieten (Praděd, Šerák-Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek), 1 nationalen Naturdenkmal (Javorový vrch), 19 Naturschutzgebieten und 7 Naturdenkmalen geschützt. Hier gibt es seltene Pflanzen- und Tierarten, neben eiszeitlichen Relikten auch einige endemische Arten, die nur im Gesenke vorkommen. Eine einzigartige Stätte von europäischer Bedeutung ist das Große Becken im Praděd-Nationalpark. Auf dem Gebiet des Landschaftsschutzgebietes befinden sich auch historische Bergbauüberreste, verlassene Stollen sind ein technisches Denkmal und dienen auch als Winterquartier für Fledermäuse. Die Aufgabe des Landschaftsschutzgebietes Gesenke ist auch der Schutz des kulturellen Erbes, einschließlich der Volksarchitektur. Infolge des historischen Zusammenlebens des Menschen mit dieser Landschaft ziehen ihr ästhetischer Wert und ihre Vielfalt auch Erholungssuchende an.
3.2 Tschechish-Schlesien bei der 1., 2. und 3. Militärkartierung
Für die Erforschung der Landschaft in der Vergangenheit stehen eine Reihe von typologisch
unterschiedlichen historischen Quellen zur Verfügung. Zu den wertvollsten gehören zweifelsohne die
militärischen Kartierungen des 18. und 19. Jahrhunderts. Das tragische Scheitern der
Habsburgermonarchie in den Schlesischen Kriegen leitete eine systematische Kartierung in der Monarchie
ein, die für militärische Zwecke genutzt werden konnte. Die sogenannte erste militärische Kartierung
wurde in ihrer ersten Phase zwischen 1763 und 1768 durchgeführt, wobei das strategisch wichtige Gebiet
des österreichischen Schlesiens am frühesten und besten in den Jahren 1763-1764 kartiert wurde. Daraus
entstanden 40 Blätter mit Militärkarten. Fehler bei der Zusammenfügung der Kartenausschnitte und die
angeblich unbefriedigende Darstellung des Geländes erzwangen jedoch eine größere Revision, bei der
zwischen 1780 und 1783 dreißig neue Kartenblätter entstanden, während die verbliebenen zehn
ursprünglichen Ausschnitte korrigiert wurden. Das Ergebnis war eine Militärkarte im Maßstab 1 : 28 800
(für Schlesien ist der Maßstab der neuen Kartenblätter allerdings mit 1 : 30 746 angegeben) mit
wertvollen Kommentaren. Diese charakterisieren die Landschaft im Hinblick auf ihre militärische Nutzung
näher (z.B. Angaben zu Straßen, Gewässerquerungen, aber auch zu Unterkunfts- und
Versorgungsmöglichkeiten). Für die Kartenausschnitte von Schlesien sind, im Gegensatz zu Böhmen und
Mähren, nur tabellarische Zusammenfassungen ohne zusammenhängenden Kommentar bekannt. Die
Originale der handgefertigten Kartenausschnitte der ersten Militärkartierung sind im Österreichischen
Staatsarchiv Wien deponiert, während Kopien der Karten, die sich auf die böhmischen Länder beziehen,
im Nationalarchiv in Prag archiviert werden.
Doch schon bald, Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, entsprachen die ersten militärischen Kartierungen nicht mehr den zeitgenössischen Anforderungen an die Genauigkeit der Landesaufnahme. Deshalb wurden 1806 auf Anordnung von Franz I. astronomische und geodätische Messungen mit dem Ziel begonnen, ein trigonometrisches Netz aufzubauen. Bei den anschließenden Vermessungsarbeiten entstanden sowohl sehr detaillierte Katasterkarten im Maßstab 1 : 2 880 als auch in der Folgezeit Karten der so genannten zweiten militärischen Vermessung (die so genannte Francis-Kartierung) im Maßstab 1 : 28800. Militärisch sensible Orte (insbesondere die Umgebung von Großstädten) wurden wieder im doppelten Maßstab (1 : 14.400) kartiert. Die militärische Kartierung der böhmischen Länder fand erst in den 30. und 40. Jahren des 19. Jahrhunderts bereits auf der Basis von trigonometrischen Katasternetzen statt. Das Gebiet von Mähren und Schlesien wurde in den Jahren 1836-1840 auf diese Weise kartiert. Unter dem Gesichtspunkt der Überwachung der Landschaftsentwicklung ist die zweite Militärkartierung aus mehreren Gründen sehr geeignet. Sie entspricht sowohl was den Umfang als auch die Genauigkeit betrifft. Außerdem zeigt die zweite militärische Kartierung (wie auch die kaiserlichen Kartendrucke des stabilen Katasters) die Landschaft zu Beginn der industriellen Revolution und der strukturellen Veränderung der gesamten Gesellschaft.
Die Kriegserfahrungen aus dem Preußisch-Österreichischen Krieg von 1866, als zum Teil mehrere Jahrzehnte alte Karten zur Verfügung standen, gaben Anlass zur Anschaffung einer aktualisierten und genaueren Karte von Wien. Im Jahr 1869 wurde die dritte militärische Kartierung begonnen, deren Ergebnisse bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts die einzige kontinuierliche topographische Arbeit auf unserem Gebiet darstellten. Das Gebiet von Schlesien und Ostmähren wurde 1876 neu kartiert, der Rest der böhmischen Länder 1879. Für die Kartierung wurde der sogenannte einfache Maßstab im dekadischen System (unter der Annahme der frühen Einführung des metrischen Maßes) mit einem Verkleinerungsverhältnis von 1 : 25.000 gewählt, für militärisch sensible Orte wurde der doppelte Maßstab gewählt. Die grafische Positionierungsgrundlage war eine verkleinerte Zeichnung von Katasterkarten im Maßstab 1 : 2 880 bis 1 : 25 000.
Auf Grund des Vertrages von Saint-Germain wurden alle ursprünglichen topographischen Schnitte für das Gebiet der Tschechoslowakei dem Militärgeographischen Institut in Prag übergeben. Lange Zeit waren die Karten verloren, bis in den 1990er Jahren ein großer Teil der Sammlung vom Laboratorium für Geoinformatik der J. E. Purkyně Universität mit Hilfe der Anwendung Zoomify entdeckt, digitalisiert und auf die Webseite gestellt wurde. Die Karten der dritten Militärkartierung blieben nach dem Zweiten Weltkrieg die offiziellen Karten der Tschechoslowakei und wurden erst 1956 durch neue militärische topographische Karten ersetzt. Die Karten der dritten Militärischen Kartierung ermöglichen die Identifikation von maßstabsgerechten Landschaftsmerkmalen und den entsprechenden Vergleich.
Nach der Gründung der Tschechoslowakei wurde im Ministerium für Nationale Verteidigung der Tschechoslowakei ein militärischer topographischer Dienst eingerichtet. Im Oktober 1919 wurde in Prag das Tschechoslowakische Militärgeographische Institut gegründet. Diese Einheiten übernahmen vom Militärgeographischen Institut in Wien die Grundlagen aller topographischen Karten vom Gebiet der Tschechoslowakei und begannen sofort mit deren Pflege und Erneuerung. Im Jahr 1926 wurde die Arbeit an der Erstellung eines neuen topographischen Werkes, das die Karten der dritten Militärkartierung ersetzen sollte. Die Neukartierung ging jedoch nur sehr langsam voran, und bis 1938 waren nur 3 % des Territoriums der Tschechoslowakei bearbeitet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg (1947) beschloss das Ministerium für Landesverteidigung, endgültig von Spezialkarten 1 : 75 000 auf topographische Karten im Maßstab 1 : 50 000 umzustellen. Im Jahr 1953 wurde die Herstellung und Herausgabe der sogenannten provisorischen topographischen Karten in den Maßstäben 1 : 50 000 und 1 : 100 000 abgeschlossen. Die neue topografische Kartierung, deren Ergebnisse noch heute verwendet werden, fand zwischen 1953 und 1957 statt. Dieser herausragende Erfolg wurde vor allem durch den maximalen Einsatz der Luftbildmessung und die Zusammenarbeit der militärischen und zivilen Vermessungsdienste erreicht. Insgesamt wurden damals 1.736 Kartenblätter im Maßstab 1 : 25.000 erstellt und veröffentlicht. Es wurde der Markierungsschlüssel verwendet, der innerhalb des Warschauer Paktes einheitlich eingeführt wurde. An die Bearbeitung dieser topographischen Karten schloss sich nahtlos die Bearbeitung von topographischen Karten kleinerer Maßstäbe an, die durch kartographische Generalisierung daraus abgeleitet wurden. Dies waren Karten in den Maßstäben 1 : 50000, 1 : 100 000 (erschienen bis 1960) und 1 : 200 000 (erschienen bis 1965).
Diese Militärkarten liefern eine Fülle von Informationen über die Landschaft in der Vergangenheit, mit dem Vorteil der Vergleichbarkeit. Die erste militärische Kartierung eignet sich besonders für die visuelle Interpretation, da sie nicht mit ausreichender Genauigkeit für die GIS-Analyse verwendet werden kann. Die zweite und dritte Militärkartierung sowie die topographischen Karten aus den 1950er Jahren können dagegen sehr genau ausgewertet werden. So können wir genau herausfinden, was in den letzten zwei Jahrhunderten mit der schlesischen Landschaft passiert ist.



3.3 Digitales Modell des Reliefs des Untersuchungsgebietes
ie Verwendung von digitalen Modellen der Reliefe (DMR) ist derzeit recht umfangreich. Sie dienen als Basis für verschiedene thematische Schichten. Oft handelt es sich um ein Substrat unter teilweise transparenten Luft- oder Satellitenbildern. Das digitale Höhenmodell wird auch im Bereich der Landschaftspflege und des Naturschutzes, für die Raumplanung (z. B. Planung von Neubauten) usw. eingesetzt. Der Einsatz von DMR ist auch bei der Modellierung oder Simulation von anthropogenen und natürlichen Phänomenen (z.B. Hochwasser) wichtig. Eine qualitativ gute und gut ausgeführte DMR-Visualisierung ist ein geeignetes Instrument für verschiedene Landschaftsentscheidungen.
Nachdem das digitale Höhenmodell des Interessensgebietes erstellt wurde, ist es notwendig, eine Überprüfung durchzuführen. Die erkannten Fehler werden durch Bearbeiten des DMR beseitigt. Der generierte DMR kann weiter analysiert werden und eine Vielzahl von notwendigen Informationen kann gewonnen werden. Volumetrische Berechnungen werden z. B. verwendet, um das Wasservolumen in einem Reservoir, das Volumen einer Mülldeponie oder das Volumen einer Minerallagerstätte zu berechnen. Sichtbarkeitsanalysen verfolgen den Bereich, der von einem bestimmten Standort aus sichtbar ist, den Bereich der Signalabdeckung eines Senders, usw. Bei der Untersuchung der Landschaft sollte die DMR vor allem in zerklüfteten Gebieten mit großen Höhenunterschieden eingesetzt werden. Neben der Nutzung der Land- oder Landschaftsbedeckung (z. B. in der Landschaftsplanung) werden DMRs häufig zur Erfassung verschiedener Geländemerkmale (z. B. Hanglänge, Hangneigung, Orientierung) eingesetzt. Mit DMRs ist es auch möglich, Überschwemmungen, Hangverformungen, Erdrutsche, Wassererosion usw. zu modellieren.
Eine geeignete Visualisierung des erstellten DMR spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung in der Landschaft (z.B. in der Landschaftsplanung, im Naturschutz und im Landschaftsmanagement). Eine gängige Art der Visualisierung ist die Darstellung eines DMR, das entsprechend der Höhe eingefärbt ist (z. B. eine Farbskala von grün für niedrige Höhenwerte über gelb und braun bis hin zu weiß für Berggipfel). Um eine realistische Darstellung des Geländes zu erzeugen, kann ein schattiertes Reliefverfahren verwendet werden, das häufig als Hintergrund verwendet wird (z. B. dargestellt unter einem teiltransparenten, nach Höhe gefärbten DMR oder unter teiltransparenten Luft- oder Satellitenbildern). Ein schattiertes Relief wird erzeugt, indem das Relief hypothetisch von Nordwesten beleuchtet wird, um einen Schatten hinter ein Objekt (z. B. einen Berg) zu werfen. Bei der Verwendung einer schattierten Reliefdarstellung nehmen wir das erstellte Modell plastisch wahr. Bei der Erstellung des DMR von Tschechish-Schlesien wurden beide oben genannten Techniken (die nach Höhen eingefärbte DMR-Darstellung und die Methode des schattierten Reliefs) verwendet.
Für die Erstellung der DMR-Karte von Tschechisch-Schlesien wurden Daten aus dem digitalen Reliefmodell der Tschechischen Republik, 5. Generation (DMR 5G) verwendet. Das DMR 5G ist eine digitale Darstellung der natürlichen oder künstlichen Erdoberfläche in Form von Höhen diskreter Punkte in einem unregelmäßigen dreieckigen Netz von Punkten mit X-, Y- und H-Koordinaten, wobei H die Höhe im Balt-Höhenreferenzsystem nach Nivellement (Bpv) mit einem vollen mittleren Höhenfehler von 0,18 m im exponierten Gelände und 0,3 m im bewaldeten Gelände darstellt. Das Modell wurde aus den Daten erstellt, die mit der Methode des Laserscannings aus der Luft in der Tschechischen Republik zwischen 2009 und 2013 gewonnen wurden. Es wurde zum 30. Juni 2016 auf dem gesamten Gebiet der Tschechischen Republik abgeschlossen. Das Laserscanning aus der Luft ist eine moderne Methode zur massenhaften Erfassung hochgenauer dreidimensionaler Daten über Objekte und Phänomene auf der Erdoberfläche. Große Mengen der so gewonnenen Punkte werden als "Punktwolken" bezeichnet. Zur Erstellung des DMR 5G wurden die erfassten Daten automatisch gefiltert und manuell detailliert geprüft und bearbeitet.
Zusätzlich zum DMR ist es möglich, ein digitales Oberflächenmodell für den ausgewählten Bereich zu erstellen, das andere dreidimensionale Objekte enthält, die auf dem Relief platziert sind (z. B. Häuser, Bäume usw.).


Auf der erstellten Karte mit dem DMR von Tschechisch-Schlesien ist das vertikale Relief des Gebietes deutlich sichtbar. Das dominierende Gebirge von Tschechish-Schlesien ist das Altvatergebirge (im westlichen Teil der Region) mit dem höchsten Berg Praděd (1491 m ü. M.). Südöstlich vom Altvatergebirge schließt es an das etwas weniger höhenreiche Niederes Gesenke an. Im Südosten von Tschechish -Schlesien ragen auch die Gipfel der Beskiden mit dem höchsten Lysá hora (1323 m über dem Meeresspiegel) heraus. Das DMR zeigt auch sehr deutlich die Niederungen, die im Bezirk Karviná, im nördlichen Teil der Bezirke Opava und Jeseník und auch im Ausläufer Osoblažský výběžek vorherrschen.
3.4 Typologie der Kulturlandschaft von Tschechish-Schlesien und ihrer Elemente
Die Landschaft ist ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens. Die aktuelle Landschaftsstruktur ist das Ergebnis natürlicher Faktoren und menschlicher Aktivitäten, die die Landschaft maßgeblich beeinflussen und oft ihre ökologische Stabilität bedrohen. Seit der Antike hat der Mensch versucht, die Natur zu verstehen, um zu überleben. Er hat die Natur an seine eigenen Bedürfnisse angepasst oder versucht, sie anzupassen, was zu einer breiten Palette von Landschaften führt, von natürlichen bis hin zu kulturellen (mehr oder weniger anthropogen transformierten). Die Ergebnisse dieser Prozesse können über Jahrhunderte oder Jahrtausende in der Landschaft verbleiben oder im Laufe der Zeit durch andere Landschaftsstrukturen ersetzt werden. Der Mensch verursacht in der Regel kurzfristige und dynamische Veränderungen in der Landschaft. Anthropogene Einflüsse treten am häufigsten in Gebieten auf, die vom Menschen intensiv genutzt (z. B. Erzabbau) oder an seine Bedürfnisse angepasst werden können (z. B. Landwirtschaft oder Neubaugebiete).
Die Kulturlandschaft Tschechish-Schlesiens lässt sich z. B. nach der Struktur der Landnutzung (von Natur- über Kultur- bis zu Transformationslandschaften) charakterisieren. In Tschechish-Schlesien finden wir sechs allgemeine Landnutzungstypen: Agrarlandschaften, Wald-Agrar-Landschaften, Waldlandschaften, Teichlandschaften, Berglandschaften (in geringem Umfang) und städtische Landschaften.
Heute sind die einzelnen Kulturlandschaften miteinander verbunden und bilden ein komplexes Netzwerk, die sogenannte Landschaftssphäre. Die Agrarlandschaft ist ein Landschaftstyp, der durch menschliche Bewirtschaftung stark verändert wurde. Der größte Teil des Gebietes besteht aus Feldern und Dauergrünland. Es ist ein offenes System mit vielen komplexen Verbindungen, die zu seiner Stabilität beitragen. Die Agrarlandschaft von Tschechish -Schlesien besteht aus Ackerland, Wiesen, Weiden und Obstgärten. Auf den Feldern wird am häufigsten Getreide angebaut, daneben Mais und Hackfrüchte, Hülsenfrüchte, Ölsaaten und Pflanzen für die Textilindustrie. Ein interessantes Merkmal der Felder sind die spezifischen Pilze. Die hier gefundenen Tiere sind meist steppenartigen Ursprungs. Sie sind oft in der Lage, sich extrem schnell zu vermehren und mehrere Generationen hervorzubringen, bevor der Bestand verschwindet. Was Insekten und andere wirbellose Tiere betrifft, so ist die Fauna am reichsten in Beständen von mehrjährigem Futter und Getreide und am ärmsten in Ackerkulturen, insbesondere Mais und Raps. Viele der Tiere, die auf den Feldern leben, sind Schädlinge der Feldfrüchte. Von den Wirbeltieren sind kleine Säugetiere am häufigsten vertreten, vor allem Nagetiere, die in der Lage sind, unterirdische Unterschlüpfe zu bauen. Ihre Populationen ziehen dann viele Raubtiere (kleine Fleischfresser und Raubvögel) an. Obwohl die Flora und Fauna der Felder extrem artenarm ist, kann die Anzahl der Individuen beträchtlich sein. Das Hauptproblem mit diesem Lebensraum ist die schnelle Veränderung seines Charakters nach der Ernte, wenn sowohl Unterschlupf als auch Nahrungsangebot für die Tiere verschwinden. Chemische Spritzmittel, verschiedene Düngungsmethoden und andere agrotechnische Eingriffe haben einen erheblichen Einfluss auf die Felder und die umgebende Landschaft. Typische landwirtschaftliche Gebiete in Tschechish-Schlesien sind Opava, Osoblažsko, Javornicko und Vidnavsko.
Ein Übergangslandschaftstyp ist die Wald-Agrar-Landschaft, die durch den Wechsel von Wald- und Nicht-Wald-Lebensräumen gekennzeichnet ist. Der Anteil der Flächen, die von bewaldeter Vegetation bedeckt sind, variiert zwischen 10 % und 70 %. Die Landschaften sind überwiegend halboffen.
Waldlandschaften sind eine weniger veränderte Art von Landschaft. Sie zeichnen sich durch eine große Dominanz der Waldbedeckung aus (mindestens 70 % der Fläche). Sie haben einen geschlossenen Charakter in Bezug auf die Ansichten. Heute wird der Wald nicht mehr nur als Holzquelle gesehen, sondern es werden auch die Funktionen und Bedürfnisse dieses besonderen Lebensraumes respektiert. Die Nutz-, Schutz- und Regenerationsfunktionen des Waldes werden gleichermaßen berücksichtigt. Eine nachhaltige Entwicklung ist auf struktur- und artenreiche, gesunde und stabile Wälder ausgerichtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem umweltverträglichen Holzeinschlag. In den letzten Jahren hat die Borkenkäferplage auch die Fichtenwälder in Schlesien betroffen, und die Ernte des befallenen Holzes in einigen Gebieten hat die Landschaft erheblich verändert (Gesenke, Beskiden). Während einige Waldökosysteme reiche und interessante Tiergemeinschaften beherbergen, ist dies bei bewirtschafteten Wäldern, insbesondere bei Fichtenwäldern, nicht der Fall. Die geringe Umweltvielfalt und das begrenzte Nahrungsangebot lassen die Artenvielfalt solcher Wälder verarmen. Die meisten Tiere sind am Waldrand, auf Lichtungen oder entlang von Wegen zu finden.
Teichlandschaften zeichnen sich durch eine signifikante räumliche Repräsentation von Flachwasserkörpern aus. In Tschechisch-Schlesien kommen sie in Verbindung mit erhaltenen Teichnetzen (z.B. Poodří) und Wasserreservoirs vor.
Die Landschaften der Bergstöcke treten in Tschechisch-Schlesien sporadisch im Gesenke (Praděd, Šerák und Keprník) auf. Sie umfassen seltene Territorien, die in hohen Bergfragmenten oberhalb der oberen Waldgrenze liegen.
Der am stärksten vom Menschen beeinflusste Typ sind urbanisierte Landschaften. Sie zeichnen sich durch eine Dominanz von Gebäuden und gepflasterten Flächen aus. Je nach vorherrschender Nutzungsart kann man im Einzelnen von Siedlungslandschaften, Bergbaulandschaften oder Industrielandschaften sprechen.
Die Siedlungslandschaft ist ein Landschaftstyp, der intensiv vom Menschen beeinflusst wird. Die natürlichen Bestandteile der Landschaft sind durch die Bebauung bereits stark verändert. Dies gilt insbesondere für urbane Landschaften. Der Hauptgrund für die allmähliche Vergrößerung der bebauten Flächen war und ist das Bevölkerungswachstum. Auch der Bau von landwirtschaftlichen und industriellen Gebäuden hat eine wichtige Rolle gespielt. Die innerstädtischen Gebiete weisen aus biologischer Sicht einige bedeutende Besonderheiten auf. Die erste ist der Wärmeinseleffekt, gefolgt vom Treibhauseffekt, Smog, Veränderungen der Luftströmung durch die Anwesenheit von Gebäuden, leichte Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und umgekehrt wenig Schutz. Städte sind oft Zentren für die Ausbreitung nicht-heimischer Pflanzen- und Tierarten. Unter den Pflanzen finden wir vor allem Arten, die sich schnell ausbreiten und mit extremen Bedingungen gut zurechtkommen. Unter den Tieren gibt es so genannte synanthrope Arten, die den Menschen permanent begleiten, sekundär verwilderte, domestizierte Arten, vom Menschen eingeführte oder eingebrachte Arten, an urbane Bedingungen angepasste Arten aus der Wildnis, Arten, die nur für kurze Zeit in Städten präsent sind, und schließlich vom Menschen in Gefangenschaft gezüchtete Arten.

Die Bergbaulandschaft ist durch den über- oder unterirdischen Mineralabbau stark gestört. Der Einfluss des Bergbaus auf die Landschaft von Tschechisch-Schlesien begann sich bereits im Mittelalter im Zusammenhang mit dem Erzabbau zu manifestieren. Viele Spuren dieses historischen Bergbaus sind auch heute noch in der Landschaft zu sehen, allerdings handelt es sich um relativ kleinräumige Eingriffe. Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der Bergbau noch wenig sichtbar war, war Schlesien eine Agroforstlandschaft, bestehend aus einem Mosaik von Feldern, Wiesen, Weiden, menschlichen Siedlungen, Wäldern und zahlreichen Teichen. Besonders in den letzten zwei Jahrhunderten hat sich die Landschaft durch den Kohleabbau und die Gewinnung anderer Mineralien stark verändert. In der Region Ostrava-Karviná führte der Kohleabbau zur Entstehung völlig neuer anthropogener Landformen (z.B. Halden oder Senkungsbecken, die oft geflutet werden), zur Entstehung von Schlammteichen, Bergbau- und damit verbundenen Industriekomplexen und den zu ihnen führenden Straßen und Eisenbahnstrecken. Der Bergbau beeinflusste das Aussehen der Landschaft nicht nur durch Gruben und Halden, sondern auch durch den Bau zahlreicher Bergbaukolonien und späterer Siedlungen (Ostrava-Poruba).
Der Bergbau hat im 20. Jahrhundert auch zu einem Verlust von Wasser in der Landschaft und zur Degradierung zahlreicher aquatischer Lebensräume geführt. Zu den Folgen des Bergbaus gehören Veränderungen des Wasserhaushaltes in der Landschaft. Die Landschaft wurde auch durch Landerwerb und Degradierung, methanreiche Grubengasemissionen, Grubenerschütterungen, Umweltverschmutzung, Landschaftszerkluftung usw. beeinträchtigt. Obwohl Eingriffe des Bergbaus in die Landschaft oft eher negativ wahrgenommen wurden und werden, zeigen die Ergebnisse verschiedener Studien, eine starke Anpassungsfähigkeit der Natur. Viele und oft sehr seltene Arten von Pflanzen und Tieren finden in der Bergbaulandschaft einen idealen Lebensraum. Einige überflutete Senkungsbecken sowie sanierte oder nicht sanierte Schlammteiche beherbergen z.B. den Spitzenfleck, den Europäischen Sumpfkrebs und die Große Teichmuschel. Es handelt sich um besonders geschützte, stark gefährdete Arten. Bis vor kurzem galt der Spitzenfleck in der Tschechischen Republik sogar als ausgestorbene Art. Es überrascht nicht, dass sich die spontane Sukzession (natürlich wachsende Halden und Steinbrüche) als der beste Weg zur Wiederherstellung von Bergbaulandschaften erweist. Die Ausbreitung der synanthropen Vegetation ist tendenziell ein Problem. Diese kann sich zwar leicht an vom Bergbau betroffene Flächen anpassen und diese sogar effektiv verfestigen, breitet sich aber oft unkontrolliert in Gebiete aus, aus denen sie einheimische Arten verdrängt. In Tschechisch-Schlesien sind die typischen vom Bergbau betroffenen Gebiete vor allem der Bezirk Ostrava-Karviná (Steinkohle), die Bezirke Zlatohorsko, Hornobenešovsko und Rýmařovsko (Erze), Jesenicko (Granit) und das Gebiet Nieder-Jeseník (Schiefer).
Industrielandschaften treten besonders intensiv seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auf und stehen im Zusammenhang mit dem Beginn der Industriellen Revolution und der nachfolgenden Industrialisierung. Wirbeltiere sind in der Industrielandschaft selten, und bei den wirbellosen Tieren handelt es sich hauptsächlich um Insekten. Vögel sind durch Spatzen, Elstern, verwilderte Tauben, Rotschwänze, Amseln, Türkentauben vertreten. Es gibt nur wenige Arten von Säugetieren und die meisten von ihnen leben ziemlich versteckt. Dabei handelt es sich meist um Nagetiere oder anpassungsfähige Tierarten. Von den Huftieren ist das Wildschwein am besten an diese Umgebung angepasst. Auch das Reh, das Wildkaninchen und der Feldhase sind in der verwilderten Industrielandschaft zu finden. Nach ein paar Jahrzehnten können auch die anspruchsloseren Reptilien und Amphibien auftreten. Die langfristige Gesundheit der Tiere wird hier durch den Mangel an Unterschlupf und Nahrung sowie durch die Ablagerung von Schadstoffen im Körper beeinträchtigt.
Je nach dem Zeitpunkt der Entstehung der Siedlungslandschaft in der Tschechischen Republik wurden die Rahmensiedlungslandschaftstypen definiert. Die alte Siedlungslandschaft ist seit dem Neolithikum kontinuierlich besiedelt. Die hochmittelalterliche Siedlungslandschaft ist seit dem Hochmittelalter (13. bis 14. Jahrhundert) kontinuierlich besiedelt, die spätmittelalterliche Siedlungslandschaft erst seit dem Spätmittelalter (d.h. seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts). Die moderne Siedlungslandschaft wurde erst in der Neuzeit, d.h. frühestens ab dem 16. Jahrhundert besiedelt.
3.5 Charakter der Besiedlung von Tschechisch-Schlesien
Tschechisch-Schlesien und der von ihm umschlossene Keil Nordostmährens ist größtenteils eine künstliche Formation, die heute zur Mährisch-Schlesische Region und im westlichen Teil (der Region Jesenicko) zur Region Olomouc gehört. Tschechisch-Schlesien besteht aus den Resten von vier historischen Gebietseinheiten: dem Fürstentum Opava (einschließlich der sog. Mährischen Enklaven) und dem Fürstentum Těšín, sowie kleinen Resten des Fürstentums Nisko (Jesenicko, Javornicko und Vidnavsko) und des Fürstentums Ratiboř (Status minor Bohumín). Im Nordosten Mährens wächst der Mährische Keil, der vor allem aus den Gemeinden Ostrava, aber auch Místecky, Brušperk, Příbor und Novojice besteht, in die schlesische Formation hinein.
Einen Wendepunkt in Bezug auf die Besiedlung des untersuchten Gebietes brachten die Wellen der mittelalterlichen Kolonisation, die während des 12., 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts die Grundlage für die Siedlungsstruktur gebildet haben. Die Kolonisation führte auch im Vorgebirge zu einem raschen Anstieg der Zahl der ländlichen Dörfer, zum Wachstum der Bevölkerung und zur Gründung von Städten, die eine unersetzliche wirtschaftliche und kulturelle Rolle spielten. Einige städtische Zentren bauten auf den älteren Siedlungen auf (Opava, Těšín, Moravská Ostrava), in einigen Fällen wurde der städtische Kern verlegt (Frýdek) und andere wurden auf der grünen Wiese gegründet (z.B. Horní Benešov oder Brušperk). Langfristig hatte die mittelalterliche Besiedlung nicht nur einen großen Einfluss auf die Siedlungsstruktur, sondern auch auf die innere Anlage der Siedlungen und der Ebene. Während die Siedlungsstruktur durch die Hussitenkriege nicht wesentlich beeinträchtigt wurde, war die Situation während der böhmisch-ungarischen Kriege in den 1560er und 1570er Jahren anders, als allein in den Regionen Opava und Krnov Hunderte von Dörfern verwüstet wurden. Im Laufe des 16. Jahrhunderts entstand vor allem in Westschlesien im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bergbaus eine Welle neuer Siedlungen (z. B. Andělská Hora oder Vrbno pod Pradědem); gleichzeitig begann in der Region Těšín die sog. walachische Kolonisation, deren Hauptphase in das 17. Jahrhundert zurückreicht und die Besiedlung der Berggebiete Beskiden und Javorníky verursachte.
Die grundlegende Bereicherung der bestehenden Siedlungsstruktur war im 18. Jahrhundert vor allem mit der Parzellierung der Höfe verbunden. Das vom Staat und der Oberschicht initiierte Prinzip der Parzellierung der vorhandenen Hofflächen an Bauern in langfristiger Pacht sollte zur Rationalisierung des Oberschichtbetriebes führen. In der Folge entstanden Dutzende von neuen Siedlungen, vor allem in Westschlesien. Zum Beispiel wurden in der Region Jeseníky in der Zeit ab der zweiten Hälfte der 1880er Jahre bis zum ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts mehr als zwanzig sogenannte Kolonien gegründet. Zum Beispiel wurden Dětřichov, Rožmitál, Ramzová, Rejvíz, Bělá und später das berühmte Gräfenberg gegründet. Diese letzte Besiedlungswelle erreichte die Grenzen der Landnutzung vor dem Aufkommen der modernen Technik.
Neue, sehr starke Impulse, die zur Transformation der bestehenden Siedlungsstruktur führten, wurden durch die Revolution und die nachfolgenden Industrialisierungswellen ausgelöst. Die Veränderungen der Energiequellen und der Technologie im 19. Jahrhundert brachten Veränderungen der Siedlungsmuster mit sich. Erstens können wir eine Zunahme der Bedeutung der traditionellen Textilzentren beobachten, die sich auf eine moderne industrielle Textilproduktion umstellen und deren Bevölkerung wächst (Krnov, Bruntál, Frýdek, Místek, Nový Jičín usw.). Diese traditionellen Zentren wurden jedoch bald von der massiven Entwicklung der modernen Schwerindustrie (Kohlebergbau, Metallurgie, chemische Industrie) überschattet, was ein explosionsartiges Wachstum der Bevölkerung dieser neuen Industrialisierungszentren mit sich brachte, wo sich oft völlig unbedeutende Dörfer und Kleinstädte in kurzer Zeit in Siedlungen mit zehntausend Einwohnern verwandelten (Vítkovice, Přívoz, Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Karviná, Orlová usw.). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es durch die Entstehung neuer Industrialisierungszentren und den allmählichen Niedergang der traditionellen Handwerksstädte zu einer weiteren Differenzierung des Siedlungsnetzes, da sich die peripheren und wirtschaftlich allmählich zurückgebliebenen Berg- und Vorgebirgsgebiete (Jesenicko, Bruntál, Pobeskydí) zu entvölkern begannen und auf der Suche nach einem Auskommen in wirtschaftlich vorteilhaftere Zentren abwanderten, wobei die daraus resultierende Urbanisierungswelle vor allem die Industrieregionen Ostrava und Karviná betraf. Seit der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts erlangten viele der hiesigen bevölkerungsreichen Dörfer den Stadtstatus (z.B. 1900 Přívoz, 1907 Mariánské Hory, 1908 Vítkovice, 1920 Slezská Ostrava, 1922 Orlová, 1923 Karviná). Der Agglomerationsprozess intensivierte sich dann nach dem Ersten Weltkrieg, als das Projekt des sog. Großraums Ostrau diskutiert und schließlich in begrenztem Umfang realisiert wurde. So entstand Anfang 1924 durch den Zusammenschluss von sieben mährischen Gemeinden die drittbevölkerungsreichste Stadt der Zwischenkriegstschechoslowakei.

Den letzten bedeutenden Eingriff in die Siedlungsstruktur des untersuchten Gebietes brachte der Zweite Weltkrieg bzw. seine Folgen. Nicht nur die direkten Kriegsschäden, die im Bezug auf die Siedlungsform vor allem die Region Opava betrafen, sondern vor allem die Vertreibung der deutschen Bevölkerung in den Jahren 1945-1948 haben die Gebiete, in denen die deutsche Mehrheit lebte (vor allem Jesenicko, Bruntál, Krnovsko, Osoblažsko und die Region Opava), dauerhaft geschädigt. Die anschließende Umsiedlung der Vertriebenen wurde sowohl aus den Agrargebieten der böhmischen Länder als auch in Form einer kontrollierten Rückwanderung (vor allem aus Rumänien und Wolyn) und der Ansiedlung von griechischen Flüchtlingen organisiert. Viele der verdrängten Dörfer waren jedoch für die Neuankömmlinge nicht attraktiv, was das rasche Verschwinden Dutzender meist kleiner und peripher gelegener Dörfer und die langfristige Stagnation ganzer Regionen bedeutete. Allein im Bezirk Jeseník verschwanden nach dem Zweiten Weltkrieg fast zwei Dutzend kleine Dörfer (z. B. Hřibová, Hraničky, Annín, Johanka) vollständig, mehrere Dutzend weitere wurden nie richtig umgesiedelt und nach und nach in Erholungsgebiete verwandelt.
Andererseits bewirkten die sozialistische Industrialisierung und die Bevorzugung der Schwerindustrie einen weiteren starken Anstieg der Bevölkerung im Bezirk Ostrava-Karviná. So kam es ab den 1950er Jahren zu einer raschen Urbanisierung des ausgedehnten industriellen Hinterlandes, die die Entstehung neuer Siedlungseinheiten mit sich brachte (Ostrau-Poruba, Ostrauer Südstadt, Havířov usw.). Diese neuen Kapazitäten sollten u.a. durch den Bergbau verwüstete Flächen (vor allem in der Region Karviná) ersetzen. Die Phase des Bevölkerungswachstums in der industriellen Agglomeration endete mit dem rapiden Rückgang der Bergbautätigkeit in der ersten Hälfte der 1990er Jahre und der Umstrukturierung der Industrie unter den Bedingungen der Marktwirtschaft.
3.6 Die Entstehung der Agglomeration Ostrava
Die heutige statutarische Stadt Ostrava ist die drittgrößte Stadt in der Tschechischen Republik, sowohl in Bezug auf die Fläche (214 km2) als auch auf die Einwohnerzahl (283.316 Personen, Stand 1. Januar 2021). Die gesamte Agglomeration Ostrava hat fast eine Million Einwohner und ist nach Prag die zweitgrößte Agglomeration in der Tschechischen Republik. Der Prozess der Entstehung der Agglomeration Ostrava wurde historisch durch die Entstehung des Industriegebietes Ostrava bedingt.
Der kristallisierende Kern der ganzen Agglomeration war Moravská Ostrava und die umliegenden Gemeinden, sowohl auf dem historischen Gebiet von Mähren als auch von Schlesien. Auf dem Gebiet der heutigen statutarischen Stadt, das ursprünglich aus 34 Einzelgemeinden bestand, lebten 1840 nur 18.700 Einwohner, 1900 waren es 146.155 und 1950 216.289. Die höchste Einwohnerzahl wurde bei der Volkszählung 1991 erreicht, als die Bevölkerung 327.371 erreichte. Seitdem gehen die Bevölkerungszahlen ständig zurück. Die überschnelle Industrialisierung von Ostrava sorgte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für einen großen Zustrom von Einwohnern aus der weiteren Umgebung sowie aus weiter entfernten Orten (Westschlesien, Pobeskydí, Galizien). Die Ostrauer Dörfer entwickelten sich zu dieser Zeit spontan und die entsprechenden öffentlichen Einrichtungen wurden erst sehr spät geschaffen. Erst um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden weitere wichtige Kultur- und Verwaltungseinrichtungen gegründet (1895 Stadttheater, 1896 Turnhalle, 1900 Bezirkshauptmannschaft, 1904 Stadtmuseum). An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde die Regulierungspläne für die großen Gemeinden des Ballungsraumes erstellt und neue große öffentliche Gebäude errichtet. Das Gleiche gilt für die Erhebung der bevölkerungsreichen und wirtschaftlich bedeutenden Gemeinden des Ballungsraumes zu Gemeinden (1879 Polská Ostrava; 1907 Michálkovice; 1908 Hrušov) oder Städten (Přívoz 1900; Mariánské Hory 1907; Vítkovice 1908; Slezská Ostrava 1920; Svinov 1936).
Moravská Ostrava war schon vor dem Ersten Weltkrieg de facto eine Stadt mit umliegenden Dörfern, eine strukturell zusammenhängende Einheit, die durch eine hohe Konzentration von Einwohnern und industrieller Produktion gekennzeichnet war. Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese natürlichen Verbindungen durch die Schaffung einer einzigen Verwaltungseinheit formalisiert wurden. Schon vor dem Ersten Weltkrieg (1913) war die Rede davon, die drei wichtigsten Orte zusammenzulegen: Moravská Ostrava, Přívoz und Vítkovice, jedoch erfolglos. Nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich die Situation deutlich, vor allem weil die lokalen Selbstverwaltungen der einzelnen
Gemeinden anstelle der ursprünglichen Gemeindeausschüsse neue Verwaltungskommissionen gebildet wurden, die von Tschechen dominiert wurden, die für die Umsetzung des sogenannten Groß-Ostrau-Projektes waren. Dieser Plan, der vor allem vom Verwaltungskommissar von Mährisch-Ostrau, Jan Prokes, vorangetrieben wurde, sah den Zusammenschluss von fünfzehn Ostrauer Gemeinden vor, sowohl auf mährischem als auch auf schlesischem Gebiet. Der Fusionsplan wurde jedoch durch vier Probleme erschwert: 1. die ungeklärte staatliche Zugehörigkeit der Region Těšín, zu der alle betroffenen schlesischen Gemeinden außer Svinov gehörten; 2. die Frage der Provinzzugehörigkeit der entstehenden Stadt;
3. die Gesetzgebung, die sich erst 1920 mit der Frage der Änderung der Gemeindegrenzen befasste, was eine Änderung der Grenzen der historischen Gebiete zur Folge gehabt hätte; 4. die Tatsache, dass einige Gemeinden, vor allem Vítkovice, lange Zeit zögerten, sich Mährisch-Ostrau anzuschließen. Die langwierigen Verhandlungen führten dazu, dass die Regierung schließlich am 20. Dezember 1923 den Zusammenschluss mit Wirkung zum Jahresbeginn 1924 genehmigte, der sich auf sieben mährische Gemeinden (Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves, Zábřeh nad Odrou) beschränkte. Obwohl die Größe des neuen Moravská Ostrava nur halb so groß war wie im ursprünglichen Plan vorgesehen, war es mit fast 114.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt der Tschechoslowakei.
In dieser Form blieb die Verwaltung bis 1941, als Mährisch Ostrau durch die Regierungsverordnung Nr. 236 vom 29. Mai um acht weitere schlesische Gemeinden aus dem Kreis Frýdek (Heřmanice, Hrušov, Kunčice, Kunčičky, Michálkovice, Muglinov, Radvanice, Slezská Ostrava) und vier Gemeinden aus dem Kreis Mährisch Ostrau (Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Výškovice) erweitert wurde. Die so vergrößerte Stadt wurde zu einer statutarischen Stadt erhoben, d.h. ihre Gemeinde erhielt den Status der ersten Instanz der politischen Verwaltung und wurde dem Landesamt in Brünn unterstellt. Diese Änderungen aus der Besatzungszeit wurden dann durch den Präsidialerlass Nr. 121 vom 27. Oktober 1945 bestätigt, und durch einen Erlass des Innenministeriums vom 28. Juni 1946 wurde der offizielle Name der Stadt in Ostrava geändert. In den folgenden Jahrzehnten wuchs Ostrava mit den neu eingegliederten Gemeinden in mehreren Wellen: Ende der 1950er Jahre (1957 Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice; 1960 Bartovice und Martinov), Mitte der 1970er Jahre (1975 Proskovice; 1976 Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Krásné Pole, Lhotka, Petřkovice, Plesná, Polanka) und 1984 Dubina. Damit war der räumliche Geltungsbereich der heutigen statutarischen Stadt abgeschlossen.
In dieser Form blieb die Verwaltung bis 1941, als Mährisch Ostrau durch die Regierungsverordnung Nr. 236 vom 29. Mai um acht weitere schlesische Gemeinden aus dem Kreis Frýdek (Heřmanice, Hrušov, Kunčice, Kunčičky, Michálkovice, Muglinov, Radvanice, Slezská Ostrava) und vier Gemeinden aus dem Kreis Mährisch Ostrau (Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Výškovice) erweitert wurde. Die so vergrößerte Stadt wurde zu einer statutarischen Stadt erhoben, d.h. ihre Gemeinde erhielt den Status der ersten Instanz der politischen Verwaltung und wurde dem Landesamt in Brünn unterstellt. Diese Änderungen aus der Besatzungszeit wurden dann durch den Präsidialerlass Nr. 121 vom 27. Oktober 1945 bestätigt, und durch einen Erlass des Innenministeriums vom 28. Juni 1946 wurde der offizielle Name der Stadt in Ostrava geändert. In den folgenden Jahrzehnten wuchs Ostrava mit den neu eingegliederten Gemeinden in mehreren Wellen: Ende der 1950er Jahre (1957 Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice; 1960 Bartovice und Martinov), Mitte der 1970er Jahre (1975 Proskovice; 1976 Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Krásné Pole, Lhotka, Petřkovice, Plesná, Polanka) und 1984 Dubina. Damit war der räumliche Geltungsbereich der heutigen statutarischen Stadt abgeschlossen.
3.7 Kriegsspuren in der schlesischen Landschaft
Die Region Opava und Ostrava war nach dem Zweiten Weltkrieg eine der am stärksten verwüsteten Regionen der ehemaligen Tschechoslowakei. Die heftigen Kämpfe, die Fülle an schwerem Gerät und Hunderttausende von Soldaten auf beiden Seiten des Konflikts bedeuteten nicht nur große Verluste an Menschenleben, sondern auch zerstörte Städte und Dörfer und ein ruinierte Infrastruktur. Spuren des Krieges finden sich noch heute an vielen Orten in der schlesischen Region, von Opava und Ostrava bis Bruntál und Jeseník, sowie auf dem Gebiet von Schlesien.
Die Operation Ostrava-Opava, die, wie der Name schon sagt, auf dem Gebiet des mährisch-schlesischen Raumes am Ende des Zweiten Weltkrieges stattfand, war die zweitgrößte Kriegsoperation auf dem Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei und dauerte vom 10. März bis 5. Mai 1945. Ab dem 15. April, als die Armee in das tschechoslowakische Gebiet im Raum Rohov-Sudice eindrang, wurden mit schwerem Kriegsgerät und Luftwaffe heftige Kämpfe um jedes Dorf und jede Stadt in den Regionen Opava und Ostrava geführt. Die Taktik der "verbrannten Erde" sollte auf das Gebiet angewendet werden, das das letzte industrielle Zentrum war, in dem die Kriegsindustrie noch funktionierte. Die deutschen Truppen wehrten sich bis zuletzt heftig, und in den Dörfern auf dem Weg nach Ostrau war jedes Haus umkämpft. Deshalb war Schlesien die am meisten verwüstete Region in der ehemaligen Tschechoslowakei. Opava, zum Beispiel, wurde zu 90 % zerstört, ebenso wie viele der umliegenden Dörfer.
Die Überreste dieser Schlachten sind noch heute mehr oder weniger in der Landschaft sichtbar - Krater von Bombardierungen, Reste von Verteidigungsstellungen und Schützengräben, Soldatenfriedhöfe, Gräber der Gefallenen, Denkmäler und Gedenkstätten, die in fast jedem schlesischen Dorf und jeder Stadt zu finden sind. Hunderte, vielleicht Tausende von gefallenen deutschen Soldaten und Tonnen von Munition liegen noch heute im Land.

Zu den Folgen der Kriegsereignisse gehörte auch die Vertreibung der ursprünglichen deutschen Bevölkerung aus den Grenzbezirken an der Staatsgrenze zu Polen, Deutschland und Österreich. Die ersten, so genannten wilden Umzüge fanden unmittelbar nach der Befreiung statt, die nächsten, bereits organisierten Umzüge fanden 1946-1947 statt. Gleichzeitig mit den Aussiedlungen siedelte sich die tschechische Bevölkerung aus dem Inneren der Tschechischen Republik in den Grenzgebieten an. Viele der Neuankömmlinge kamen mit der Aussicht, reich zu werden, viele von ihnen waren nicht auf das Leben in den Bergdörfern und abgelegenen, oft schlecht zugänglichen Orten vorbereitet, und die Menschen waren nicht auf die landwirtschaftliche Arbeit vorbereitet. Allmählich verließen sie die umgesiedelten Orte und gingen in die Städte, um in den sich entwickelnden Industriezentren zu arbeiten, viele Dörfer sind verfallen oder mussten strategischen Bauten weichen (z.B. wurden die Dörfer Kerhartice und Medlice teilweise durch den Stausee überflutet). Viele Friedhöfe, Dörfer, Bergwerke, kleine Fabriken und kleine religiöse Gebäude blieben in der verlassenen Landschaft. Ihre Spuren sind heute in den Regionen Opava, Bruntál, Vítkov und Jeseník zu finden.
3.8 Das stählerne Herz der Republik 1948-1989
Nach dem kommunistischen Putsch im Februar 1948 wurde die Tschechoslowakei de facto zu einem Satellitenstaat der UdSSR, die sich, wie der gesamte Ostblock, auf einen neuen kriegerischen Konflikt - den Dritten Weltkrieg - vorbereitete. Damit einher ging das Konzept der Bevorzugung der Schwerindustrie mit dem Schwerpunkt der Rüstungsproduktion. Das Problem für die Tschechoslowakei war, dass sie als einziges Land im gesamten Ostblock über eine entwickelte Basis für diese Industrien verfügte. Die tschechoslowakische Wirtschaft erfuhr in kurzer Zeit einen großen strukturellen Umbau, dessen Richtung nicht aus einer natürlichen Entwicklung vorgegeben wurde und nicht dem Charakter, den Bedürfnissen und Möglichkeiten des Landes entsprach. Der Eckpfeiler des neuen Systems war die totale Verstaatlichung der Industrie und die staatliche Planung. Darin spielte die Förderung der makroökonomischen Indikatoren eine entscheidende Rolle, wobei ein enormer Wert auf eine stetige Steigerung des Produktionsvolumens gelegt wurde, insbesondere in den Sektoren, die der Aufrüstung dienten. Innerhalb der Tschechoslowakei war dies vor allem in Ostrava der Fall, dem die Rolle des wichtigsten Zentrums der Kohle-, Metallurgie- und Schwerindustrie zukam. Ostrau wurde so als "stählernes Herz der Republik" wahrgenommen.
Eine ähnlich hektische Entwicklung erlebte das Revier Ostrava-Karviná in der zweiten Fünfjahresperiode (1956-1960), in der ein konstantes jährliches Wachstum der Kohleförderung um mehr als eine Million Tonnen zu beobachten ist. So überstieg 1960 die Fördermenge im Revier zum ersten Mal in der Geschichte 20 Millionen Tonnen. Die vollständige Inbetriebnahme der neuen großen Minen und die Verlangsamung der Entwicklung in der Schwerindustrie brachten der Mine jedoch letztlich eine Entlastung des Aufwärtsdrucks auf die Produktion. Dies ermöglichte die temporäre Stabilisierung, den Wiederaufbau eines großen Teils der kleinen und mitteltiefen Minen, den Bau neuer Minen (Grube 9. Mai, Grube der Tschechoslowakischen Jugend), die Erhöhung der technischen Reife und die Mechanisierung der Arbeit. Die Betonung liegt auf der weiteren Entwicklung der Bergwerke Ostrava-Karviná, die in der ersten Hälfte des Jahres 1960 Jahre etwa 37 % der gesamten Koksproduktion der Europäischen Volksdemokratischen Staaten produzierten. Damals wurde zum ersten Mal der Bedarf an Kohle in der Volkswirtschaft mit ihren Ressourcen abgeglichen. Die erste Hälfte der 1960er Jahre war geprägt von der Gründung neuer Bergwerke (1960 Grube Paskov, 1961 Grube ČSM, 1964 Grube Staříč), die für eine weitere Steigerung der Produktion sorgen sollten. Nach 1965 gab es jedoch eine scharfe Trendwende. Im Zusammenhang mit den tschechoslowakischen Wirtschaftsreformen verringerte sich das Entwicklungstempo der Schwerindustrie und es kam zu Rationalisierungen, die in ungewöhnlich kurzer Zeit zu einer erheblichen Senkung des Bedarfes an Hochofenkoks in der Hüttenproduktion führten. Dadurch entstand wiederum in kurzer Zeit das Problem des Kohleabsatzes. Nach vielen Jahren der Verfolgung des Anstieges der Kohleproduktion kam es zu einem scharfen Umschwung, der die Unklarheit im Konzept der Entwicklung der Kohleindustrie zeigte.
Nach 1968 katapultierten der Zusammenbruch der tschechoslowakischen Wirtschaftsreform und der erneute Druck der Sowjetunion den Bezirk Ostrava-Karviná wieder auf den Pfad der wachsenden Kohleversorgung, was neue Probleme mit sich brachte. In diesem Zusammenhang wurde ein neues Konzept für die langfristige Entwicklung des Stadtteiles entwickelt, das auf der Idee der Produktionsmaximierung basiert. Das Konzept zeigte, dass das Bergwerk in der Lage ist, kurzfristig und unter Nutzung aller verfügbaren Investitionsmöglichkeiten und technischen Möglichkeiten maximal 23,5-24 Mio. Tonnen Kohle zu liefern. In den Folgejahren wurde jedoch über dieses Maximum hinaus abgebaut, was nur durch wirtschaftlich ungünstige und improvisierte Eingriffe möglich war. Darüber hinaus traten bei einigen Minen Beeinträchtigungen auf, die den weiteren Abbau einschränkten oder unmöglich machten. Mitte der 1970er Jahre stammte bereits ein Drittel der Minenproduktion aus Flözen, die von Grubenerschütterungen bedroht und anfällig für Gesteins- oder Gasbrüche waren.
Mitte der 1970er Jahre befand sich der Bezirk Ostrava-Karviná in einer widersprüchlichen Situation. Einerseits erfüllte sie noch die von der Zentralwirtschaft vorgegebenen Aufgaben, andererseits legte sie immer wieder Analysen vor, die auf die langfristige Unhaltbarkeit dieses Zustandes hinwiesen. Eine weitere Steigerung der Produktion war angesichts der Kapazitätsmöglichkeiten unrealistisch. Die Entwicklung in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre zeigte, dass der Bezirk Ostrava-Karviná unweigerlich das Ende seines Potenzials erreicht hatte. Die sich verschlechternden geologischen Bedingungen spiegelten sich in einem unvermeidlichen und allmählichen Rückgang der Leistung des Revieres wieder. Trotzdem erzielte das Revier beeindruckende Ergebnisse: Die Jahresproduktion übersteigt regelmäßig 24 Millionen Tonnen. Seine Rolle in der tschechoslowakischen Wirtschaft war immer noch außergewöhnlich.
Die 1980er Jahre waren im Bezirk Ostrava-Karviná bereits von einer unumkehrbaren Stagnation geprägt. Alle Prognosen, die erstellt worden waren, beschrieben die Notwendigkeit, den Bergbau zu reduzieren. Charakteristisch für die erste Hälfte der 1980er Jahre war ein stetiger Rückgang der Jahresproduktion. Im Jahr 1985 erreichte die Produktion nicht einmal 23 Millionen Tonnen, was angesichts des objektiven Zustandes des Bezirkes weit über der tatsächlichen Kapazität lag. Viele der alten Gruben arbeiteten nur noch mit alternden Reserven und die Entwicklung neuer Abbaukapazitäten war nicht in Sicht. Die gesamten 1980er Jahre wurden so zu einer Zeit der permanenten Suche nach einem Entwicklungskonzept, das es dem Bergwerk ermöglichen sollte, seinen Betrieb zu stabilisieren.
Der rasante Bergbau, die Entwicklung der Schwerindustrie und die Massenbebauung haben zu schnellen und dramatischen Veränderungen der Landschaft und des Gesamtzustandes der Umwelt geführt. Aufgrund der noch nie dagewesenen Intensität der Ausnutzung des wirtschaftlichen Potenzials des Gebietes ist das Tempo des Wandels deutlich dynamischer als in früheren Jahrzehnten.
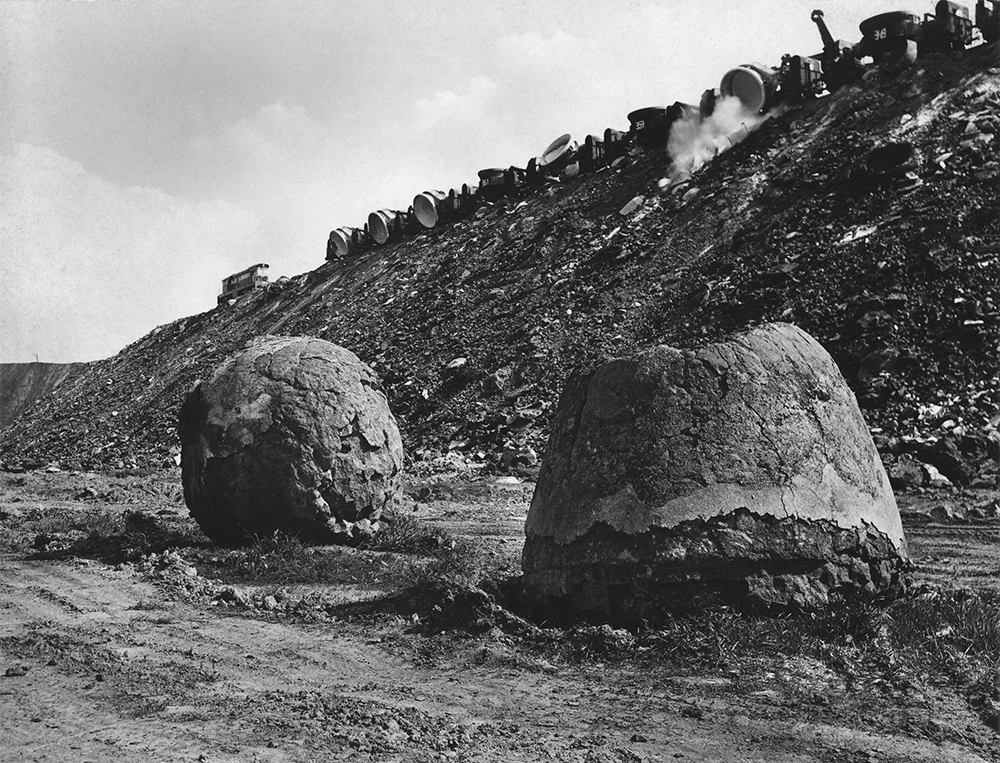

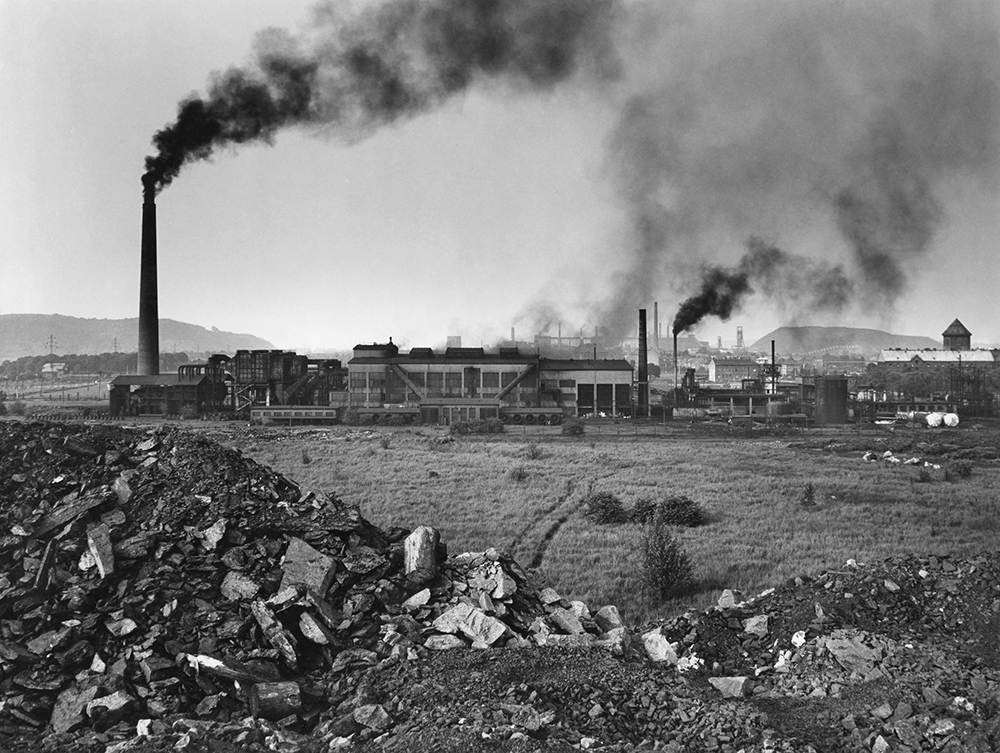
3.9 Die verlorene Identität des Siedlungsgebietes im 20. Jahrhundert
Die turbulenten Ereignisse des 20. Jahrhunderts prägten die schlesische Landschaft in vielerlei Hinsicht. Es war keineswegs nur eine Änderung der Bewirtschaftungsweise, die den Charakter der Felder, Wiesen und Wälder dauerhaft prägte. Die Ereignisse des letzten Jahrhunderts hatten auch einen bedeutenden Einfluss auf die Besiedlung Schlesiens, mit dem Verschwinden von Dutzenden von Dörfern und einer grundlegenden Veränderung des Charakters von vielen von ihnen. Insgesamt verschwanden zwischen 1945 und 1989 in Mähren und Schlesien mehr als 70 Städte, Dörfer und Siedlungen. Aus Sicht der Besiedlung hatten der Zweite Weltkrieg und seine Folgen und in der Folge die wirtschaftlichen Aktivitäten der Gesellschaft (in der untersuchten Region vor allem der Bergbau und der Bau von Wasserwerken) den größten Einfluss auf die Siedlungslandschaft im 20.
Die Regionen Krnov, Bruntál und Osoblaha waren nach dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls sehr negativ betroffen. Das letztgenannte Gebiet wurde von den letzten Schlachten des Zweiten Weltkrieges stark in Mitleidenschaft gezogen, Osoblaha wurde völlig verwüstet (90 % der Häuser in der Stadt wurden zerstört) und in den 1950er Jahren wurde es mit fadenscheinigen Gebäuden neu bebaut. Der Ort, der 1930 mehr als 2.200 Einwohner hatte, beherbergte 1947 nur noch 421 Menschen und verlor 1960 seinen Stadtstatus. Zurzeit hat es etwa 1100 Einwohner und ist das Zentrum der Mikroregion Osoblažsko. Auch einige kleine Dörfer in der Nähe der Staatsgrenze sind verschwunden (z. B. Studnice, Pelhřimovy).
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde auch die Siedlungsstruktur der schlesischen Landschaft durch die wirtschaftlichen Aktivitäten des Menschen beeinflusst. Am ausgeprägtesten waren diese im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten und dem Bau von großen Wasserwerken. Das offensichtlichste Beispiel für das Verschwinden einer Siedlung aufgrund von Bergbauaktivitäten ist das Schicksal der alten Karviná. Die Industriestadt, die 1930 mehr als 22 000 Einwohner hatte, litt bald unter Bergschäden. In den 1950er Jahren - einer Zeit, in der der Kohleabbau im Vordergrund stand - wurde das alte Karviná unterhöhlt, einschließlich des repräsentativen Schlosses Larisch-Mönnich in Karviná-Solc. Die meisten ursprünglichen Gebäude, von denen nur die durch die Unterspülung leicht gekippte Kirche des Hl. Petrus von Alcantara überlebte, wurden zerstört, ebenso wie das ehemalige Dorf Darkov (mit Ausnahme des Jodbrom Kurbades) oder die meisten ursprünglichen Gebäude des Dorfes Louky nad Olší.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Dörfer, die dem Bau von großen Stauseen im Weg standen einfach ausgesiedelt. In der überwachten Region geschah dies im Fall des Stausees Kružberk (Dörfer Kerhartice, Medlice und Lesy), der Talsperre Žermanice (Horní und Dolní Soběšovice und Dolní Domaslavice) und der Talsperre Těrlicka (Horní und Dolní Těrlicko), Šance (Überflutung eines Teiles des Dorfes Staré Hamry und einer Reihe von Einöden im Tal der Ostravice) und Slezská Harta (Überflutung von Karlovec, dem größten Teil von Nová Pláň und der unteren Teile von Leskovec nad Moravicí, Roudno und Razová). Derzeit wird auf der Grundlage eines Regierungsbeschlusses aus dem Jahr 2008 der Bau des Hochwasserschutzdamms Nové Heřminovy am Oberlauf des Flusses Opava vorbereitet, der den unteren Teil der gleichnamigen Gemeinde überfluten soll.
3.10 Schlesische Landschaft
Die Definition des ländlichen Raums kann variieren, aber die soziologische Definition des ländlichen Raums kann als die geeignetste angesehen werden: Ein bewohntes Gebiet außerhalb städtischer Lagen, das traditionell durch eine Ausrichtung auf die Landwirtschaft und eine geringere Bevölkerungsdichte, aber auch durch eine andere, naturverbundenere Lebensweise und eine andere Sozialstruktur als in der Stadt gekennzeichnet ist. Die typische ländliche Siedlungseinheit ist das Dorf (die beiden Begriffe sind in vielerlei Hinsicht synonym). Aus soziologischer Sicht zeichnet sich der ländliche Raum vor allem durch einen spezifischen Gesellschaftstypus, die sogenannte Landgemeinde, aus, die sich im Gegensatz zur Stadtgemeinde meist durch folgende Merkmale definiert: 1. ein höheres Maß an sozialer Interdependenz; 2. eine geringere Variation der beruflichen Möglichkeiten; 3. eine geringere soziale Differenzierung und auch ein engerer Raum für soziale Mobilität; 4. eine stärkere Bindung an die Tradition und eine geringere Neigung zum sozialen Wandel; 5. eine stärkere Determination durch die natürliche Umwelt.
Das Dorf wurde von dem führenden tschechischen Historiker František Kutnar als eine Siedlungseinheit definiert, in der die grundlegende und ursprüngliche Funktion die landwirtschaftliche Produktion war. Trotz der Entwicklung der nichtlandwirtschaftlichen handwerklichen Produktion auf dem Land blieb die landwirtschaftliche Tätigkeit bis in das 20. Jahrhundert das Hauptmerkmal der Dorfbevölkerung, was nicht nur eine spezifische Sozialstruktur, sondern auch eine charakteristische ländliche Mentalität mit sich brachte (den für das Land charakteristischen Traditionalismus, die Verbundenheit der Landbevölkerung mit der landwirtschaftlichen Arbeit und der Natur sowie die Ablehnung oder das Misstrauen gegenüber der städtischen Umwelt und den oberen Gesellschaftsschichten).
Wie dichotomisch auch immer der Begriff "ländlich" in Bezug auf "städtisch" definiert wird, es ist wirklich nur hypothetisch, ländlich von städtisch zu trennen. Obwohl die Landstädte einen Stadtstatus hatten, grundlegende städtische Funktionen erfüllten (Verwaltungs- und Marktzentren, Sitze höherer als elementarer Bildung, Sitze größerer Pfarren oder Dekanate usw.) und ihre Bewohner (Stadtbewohner) sich in Bezug auf die Landbevölkerung definieren konnten, blieben sie funktional stark mit ihrer landwirtschaftlichen Umgebung verbunden und die Landwirtschaft war für die Funktion dieser Städte weiterhin von zentraler Bedeutung. Ländliche Städte können daher zu Recht als integraler Bestandteil des ländlichen Raumes angesehen werden.
Eine klare Trennlinie zwischen Stadt und Land gibt es kaum und kann es auch nicht geben. Sicherlich ist nicht er rechtliche Status oder die Einwohnerzahl entscheidend - nicht wenige Dörfer mit dem Status von Städten waren und sind kleiner als größere Dörfer (z.B. Janov, Bezirk Bruntál, Andělská Hora, Žulová) und hatten nicht viel mehr wirtschaftliche Bedeutung. Im Zeitalter der Industrialisierung hingegen begegnet uns das Phänomen von sehr bevölkerungsreichen Industriedörfern, die lange Zeit ohne den Stadtstatus existierten. Eine Reihe solcher Dörfer findet man im Kohlerevier Ostrava-Karviná (z. B. Slezská Ostrava, Vítkovice, Mariánské Hory). Es gab auch Dörfer, in denen die Mehrheit oder zumindest ein bedeutender Teil der Bevölkerung immer noch hauptsächlich von der Landwirtschaft lebte, aber die Entfernung von nur wenigen Kilometern zum industriellen Zentrum erlaubte es einem Teil der Bevölkerung, im sekundären Sektor oder im Bergbau zu arbeiten.
Die Übergangslinie zwischen ländlicher und städtischer Umgebung kann grob durch die soziologisch-professionelle Struktur der Bevölkerung und die Konzentration von Institutionen (staatlich, religiös und weitere öffentliche Einrichtungen) markiert werden. Wir sind der Meinung, dass die imaginäre Grenze, die die überwiegend ländliche von der überwiegend städtischen Umgebung trennt, nicht zwischen dem Dorf und der Stadt liegt, sondern zwischen den Städten der dritten und zweiten Reihe, wobei die erste Reihe nur aus den wichtigsten Städten in den böhmischen Ländern bestand. Diese Übergangslinie liegt etwa zwischen der Ebene der politischen Bezirkssiedlungen und der Ebene der Gerichtsbezirkssiedlungen (in Schlesien z. B. solche, die noch sehr landesnah waren und einen integralen Bestandteil der Landschaft bildeten).
Der Grundcharakter der ländlichen Landschaft ist daher mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit verbunden. Der Hauptfaktor, der den Charakter der Landwirtschaft in Schlesien bestimmt, sind die natürlichen Bedingungen. Diese sind, wie wir in den vorherigen Kapiteln gezeigt haben, in der untersuchten Region sehr unterschiedlich. Die schlesische Landschaft zeichnet sich durch die Nutzung überwiegend weniger fruchtbarer Böden aus (mehr als die Hälfte der Fläche Schlesiens besteht aus Hügeln, ein Fünftel des Vorgebirges mit einer Höhe von 500-750 m über dem Meeresspiegel und ein Zehntel der Berggebiete mit Höhen über 750 m über dem Meeresspiegel). Nur 14 % der Fläche wurde von fruchtbarem Tiefland eingenommen. Diese befinden sich hauptsächlich in den Regionen Javorníkský výběžek, Osoblažsko und Opava. Dies waren auch die einzigen Gebiete, die eine wirklich intensive landwirtschaftliche Nutzung zuließen.
Die Landschaft Schlesiens nimmt also unterschiedliche Formen an, während in Gebieten mit geringerer Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung bis heute bemerkenswerte Reste menschlicher Tätigkeit erhalten geblieben sind. Sehr auffällig ist zum Beispiel die erhaltene historische Struktur der Landschaft in Form von Schwemmebenen. Diese Strukturen sind besonders gut erhalten, zum Beispiel in Holčovice, aber auch an anderen Orten.
Zu den charakteristischen Elementen der Landschaftsstruktur der alten landwirtschaftlichen Gebiete in Tschechisch-Schlesien gehören Ackerhügel, Ackerhaufen und Ackerterrassen. Diese Formen des anthropogenen Reliefs wurden durch die landwirtschaftliche Tätigkeit des Menschen geschaffen, entweder absichtlich oder spontan, mit dem Ziel, die produktiven Eigenschaften der Landschaft zu erhöhen. Gleichzeitig wurden sie in der Regel so gebaut, dass sie möglichst wenig landwirtschaftliche Nutzfläche beanspruchten, und entstanden daher vor allem in Randgebieten und unfruchtbaren Flächen. Nur dort, wo es viel Stein gab, wurden auch inmitten von Parzellen Ackerhügel errichtet. Die auf den Feldern gesammelten Steine wurden auch für den Bau anderer Landschaftselemente verwendet (Steinstützmauern und Steinböschungen für Feldwege, Ackerrandstreifen, Grundstückseingänge, unterirdische Entwässerung, Steinställe usw.). Aufgrund ihrer steinigen Beschaffenheit stellen diese Formen einen spezifischen Lebensraum in der Landschaft für Pflanzen- und Tiergemeinschaften dar. Die Vegetation dieser Agrarformen wurde in letzter Zeit intensiv untersucht, insbesondere in Gesenke und anderen Gebieten, in denen die Intensität der landwirtschaftlichen Tätigkeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückging und sich die Vegetation fast ungestört entwickeln konnte. Agrarlandschaften gestalten das natürlich-anthropogene Relief mit, erhöhen die Geodiversität, sind spezifische Refugien für vielfältige Pflanzen- und Tiergemeinschaften und geben Auskunft über die Gesteinsumgebung eines bestimmten Ortes. Sie erfüllen eine erosionshemmende Funktion, erhöhen die Hangstabilität, stellen einen materiellen Beweis für menschliche Arbeit dar und repräsentieren heute einen gewissen ästhetischen Wert der Landschaft.


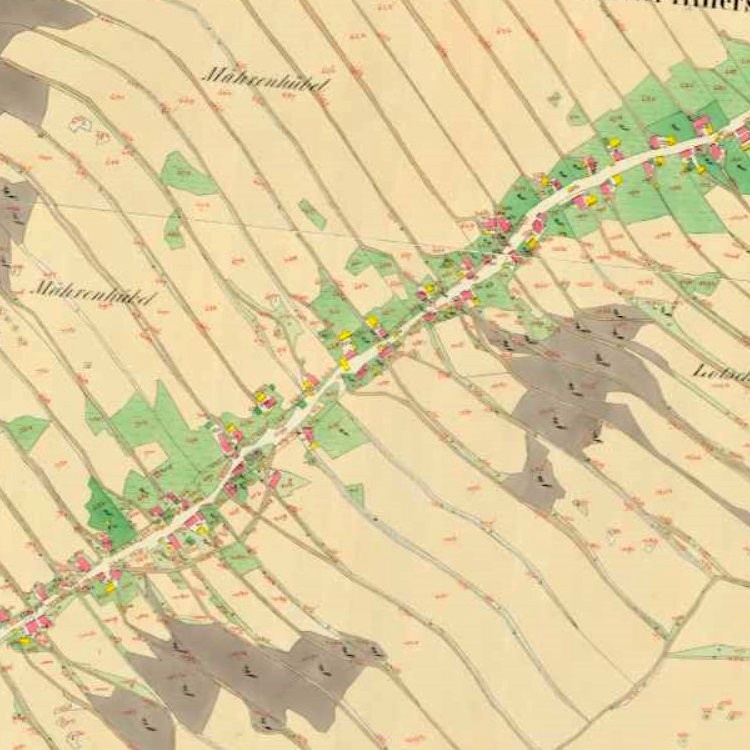

3.11 Wiesen und Weiden
Wiesen waren ursprünglich nur an Berghängen und -kämmen, in Flusstälern oder als Steppenformationen zu finden. Erst mit der Entwicklung der Landwirtschaft verdrängten sie einen Großteil des Waldes in der europäischen Landschaft. Wiesen sind in der Regel frei von Holzgewächsen und die Krautschicht wird von Gräsern oder ähnlicher Vegetation dominiert. Diese wird ein- oder mehrmals im Jahr durch Mähen oder, im Falle von Weiden, durch Beweidung entfernt. Wenn man Wiesen und Weiden ihrer natürlichen Entwicklung überlässt, kehren sie durch allmähliche Sukzession in den Waldzustand zurück, weshalb wir sie in der Regel als anthropogene, d.h. rein vom Menschen geschaffene Lebensgemeinschaft betrachten. Wiesen und Weiden sind für die Agrarwirtschaft von grundlegender Bedeutung: Sie erhalten deren Vielfalt, erhöhen die Wassermenge und -qualität, verbessern die Bodenqualität, fangen unerwünschten Abfluss auf und reduzieren Wasser- und Winderosion.
Unter unseren Bedingungen sind Wiesen und Weiden der natürliche Lebensraum mit der höchsten Anzahl an Pflanzenarten, und auch die Anzahl der Insektenarten und Bodenmikroorganismen ist hoch. Viele Arten kommen nur zum Fressen hierher. Zu den Säugetieren, die häufiger auf Wiesen zu finden sind, gehören der Feldhase, die Feldmaus, die Spitzmaus und der Maulwurf. Vögel sind durch Greifvögel (Mäusebussard und Turmfalke), Singvögel (Feldlerche, Feldsperling, Braunkehlchen, Neuntöter, Sumpfrohrsänger, Goldammer, Saatkrähe) vertreten. In der Vergangenheit waren auch Vertreter der Hühnervögel (Wachtel, Rebhuhn und Fasan) reichlich vorhanden, aber heute sind sie selten zu sehen. Häufiges Mähen begünstigt lichtliebende Pflanzenarten mit der Fähigkeit, sich schnell zu regenerieren, und früh blühende Arten, deren Samen vor der ersten Mahd reifen.
Feuchte Bachtäler, die Umgebung von Teichen oder flache Moore wurden ursprünglich als Wiesen genutzt, während trockenere, abfallende, abgeholzte Vegetation und für den Ackerbau ungeeignete Flächen als Weiden genutzt wurden. Die Landschaft der Vorgebirgs- und Bergdörfer war in der Vergangenheit überwiegend bewaldet, aber die Wälder wurden zunehmend durch Abholzung beeinträchtigt und das besiedelte Vorgebirge wurde nach und nach zu einer Agrarlandschaft. Die Flurbereinigung in den 1950er Jahren bedeutete die Zerstörung zahlreicher Wiesen und Weiden. Die feuchten Wiesen und Weiden wurden trockengelegt und Chemikalien eingesetzt, um die Produktion effizienter zu gestalten. Dies führte natürlich zum Rückgang zahlreicher Pflanzen und Tiere sowie zum Verlust von Feuchtgebieten und damit vieler seltener Arten.
Ab der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts reichte das Land um die Dörfer imGesenke nicht mehr für den Lebensunterhalt der immer größer werdenden Zahl von Menschen aus, und die Vegetation der Berghügel wurde ausgebeutet. Beweidung und Heuernte, die sogenannte Kammweide, waren wahrscheinlich die Ursache für die Entwicklung vieler Pflanzenarten. Das letzte Mal, dass Rinder auf die Weiden getrieben wurden, war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung und die damit einhergehende Änderung der Einstellung zur Landwirtschaft bedeutete eine grundlegende Veränderung für das Vorgebirge.
Durch den deutlichen Bevölkerungsrückgang wurde nicht mehr so viel landwirtschaftliche Fläche benötigt, die weiter entfernten Bergwiesen und Felder wurden mit Fichten aufgeforstet und der Wald nach vier Jahrhunderten wieder näher an die Dörfer herangeführt. Noch heute kann man in den Wäldern fernab der Dörfer die ursprünglichen Felder, von denen jedes Jahr die Steine entfernt wurden, deutlich an den Steinhaufen erkennen. In letzter Zeit wurde die Beweidung im Praděd-Nationalpark und an anderen Stellen wieder aufgenommen. Hauptziel ist die Wiederherstellung der artenreichen Bergwiesen, die in der Vergangenheit jahrhundertelang beweidet oder gemäht wurden, bevor die Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg eingestellt wurde. Besucher des Praděd-Gebietes können jetzt Schottische Hochlandrinder und Huzulen-Pferde sehen, und auch Schafe kehren in einige Gebiete zurück. Nach mehr als siebzig Jahren wurde auch auf dem Gebiet des heutigen Ovčárna die Beweidung wiederhergestellt. Ein ähnlicher Trend ist auch in den Beskiden im Gange.

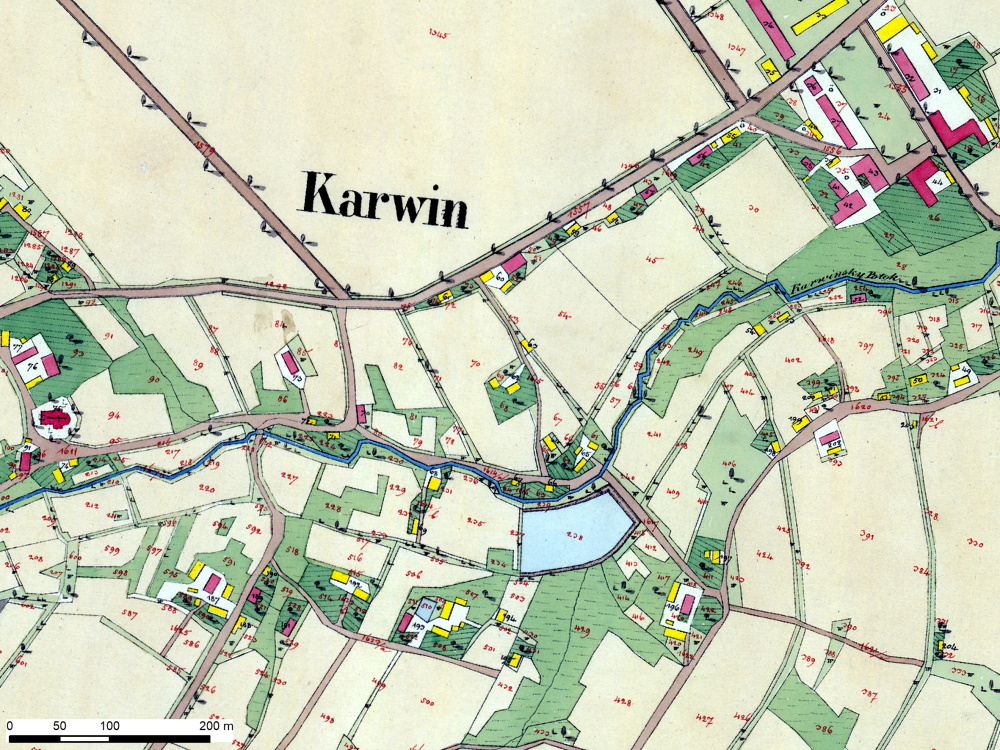
Seit Anfang der 1990er Jahre nimmt die Nutzung von Grünland als Quelle von Biomasse für energetische und biotechnologische Zwecke zu. Aufgrund der veränderten landwirtschaftlichen Nutzung, bei der eine extensive Mahd von Wiesen oft nicht wirtschaftlich ist, und der allgemeinen Eutrophierung der Umwelt, die das Wachstum konkurrierender Pflanzenarten fördert, gehören viele Wiesengesellschaften zu den gefährdeten bis stark bedrohten Lebensräumen.
3.12 Gärten und Obstplantagen
Eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Haushalte spielten die Obstgärten der Bauern, in denen Obstbäume schon immer einen festen Platz hatten. Der Obstanbau war und ist sehr vielfältig, von unterschiedlichem Alter und Formen. Heute jedoch wird der Obstbaum durch den Trend weg von der Subsistenzwirtschaft und hin zur Anlage von Ruhegärten zu einer gefährdeten Art. Steriles Laub in Form von immergrünen Zierkoniferen (Nullen, Zypressen, Formgehölze usw.) kann niemals die gleiche Leistung erbringen wie die Obstbaumkronen.
Obstbäume sind seit jeher ein fester Bestandteil der ländlichen Landschaft. Ohne das Vorhandensein traditioneller Bauerngärten, Alleen und all der Birnbäume auf den Dorfplätzen, Walnussbäume an den Hügeln oder Apfelbäume in den Vorgärten, könnte niemals ein wahres Bild des kulturellen und historischen Erbes der Landschaft dargestellt werden. Obstbäume und ihre Früchte haben für die Landbevölkerung seit jeher eine symbolische Bedeutung und tauchen in vielen Bräuchen, Traditionen, Aberglauben und Zeremonien auf. Kein Wunder, der Obstbaum ist vor allem ein Symbol für Fruchtbarkeit. Am bekanntesten ist der Weihnachtsbrauch des Apfelschneidens, der auch heute noch gepflegt wird. Der Stern im zerteilten Apfel prophezeit Gesundheit im kommenden Jahr, während ein Kreuz Krankheit oder sogar den Tod voraussagt. Ein anderer Brauch besagt, dass das Wasser aus dem ersten Bad eines neugeborenen Babys auf den Baum gegossen werden sollte, um sicherzustellen, dass das Kind so groß wie der Baum wächst.
Derzeit beobachten wir einen Trend zur "Entdeckung" ursprünglicher Sorten und Bestrebungen, bewährte, aber inzwischen fast ausgestorbene Obstbaumarten wieder zurückzubringen. Besonders deutlich wird dies z. B. in der Region Gesenke, wo die Entdeckung heimischer Arten mit der Suche nach der Identität der von der Vertreibung der ursprünglichen deutschen Bevölkerung betroffenen Landschaft verbunden ist. Der Bürgerverein Eberesche hat sich zum Beispiel für die Anpflanzung von essbaren Vogelbeeren (Sorbus aucuparia, var. Dulcis moravica) eingesetzt. Diese wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf dem Gut Liechtenstein in Ostruzná gezüchtet und sie verbreiteten sich dank des fürstlichen Försters Franz Kraetzel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Obstbaum, der auch in bergigen oder kalten Regionen Früchte trägt, in ganz Europa. Im Herbst 2012 pflanzte der Verein eine Allee von 45 Ebereschen an der Grenze entlang der Ortsstraße nach Petříkov, zwei Bäume bei der Kapelle an dieser Straße und drei weitere bei der Kirche. Aus der Frucht, die einen hohen Anteil an Vitamin C enthält, werden hervorragende Kompotte, Marmeladen, Wein, Schnaps und andere Produkte hergestellt. Gleichzeitig engagierte sich die Bewegung Brontosaurus Jeseníky für die Rettung der ursprünglichen, ökologisch sehr wertvollen Obstgärten in den heute nicht mehr existierenden Dörfern Hřibová (Pilzberg) und Zastávka (Stillstand). Die Obstgärten enthielten alte Bäume, vor allem Apfel- und Birnbäume, wie den Kulturapfel Gdanský hranáč (eine tschechische Sorte, die mindestens seit dem 16. Jahrhundert) den Kulturapfel Parména zlatá zimní (eine Sorte, die seit dem Mittelalter bekannt ist), Baumanns Renette, den Boikenapfel, Landsberger Renette, Sudetenrenette, Kulturbirnen.
Verwandt mit dem Thema Gärten und Obstgärten ist das Phänomen der Gartenarbeit. Die Entwicklung der Industrie veranlasste die Menschen, das Land zu verlassen und in die Städte zu ziehen. Die Wohn- und Sozialbedingungen waren für die Landbevölkerung oft unerträglich und das Bedürfnis nach einem Garten stieg. Während am Rande der größeren Städte große Gärten angelegt wurden, gründeten Arbeiter kleine Gärten und Gartenkolonien. Während des Ersten Weltkrieges dienten die Gartenkolonien als soziales Auffangnetz für ärmere Familien. Die Aufgabe der Gärten bestand in erster Linie darin, das Familieneinkommen durch den Anbau von eigenem Obst und Gemüse aufzubessern oder durch den Verkauf von Produkten einen Beitrag zum Familienbudget zu leisten. Die erholsame Seite der Gartenarbeit fehlte damals noch. In der Nachkriegszeit trat der soziale Aspekt in den Vordergrund und die Funktionen der Gartenkolonien wurden in gesellschaftspolitische umgewandelt. Die große Entwicklung der Kolonien fand in den 1970er Jahren statt. Nach 1989 kam es zu einer generellen Veränderung der Besitzverhältnisse und vielerorts waren die Gartenkolonien von der Schließung bedroht, da das Land an die ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben wurde. Der größte Teil der Gartenkolonieflächen wurde gerettet. Ab den 1990er Jahren begann auch die ökologische Bedeutung der Kolonien an Bedeutung zu gewinnen, da sie ein vollwertiger Teil des Siedlungsgrüns wurden.




3.13 Waldlandschaft
Ein Wald ist ein sehr komplexes Ökosystem, das sich aus Pflanzen und Tieren zusammensetzt. Er basiert auf Holzgewächsen. Als Wald gilt ein Gebiet, in dem Baumarten wachsen, die eine Mindesthöhe von fünf Metern erreichen und einen Überschirmungsgrad von mindestens 25 % aufweisen. Auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien sind die Wälder relativ ungleichmäßig vertreten, was mit der geographischen Zerklüftung des Gebietes zusammenhängt. Die Waldkomplexe in Teilen des Rauen und Niederes Gesenke und der Mährisch-Schlesischen Beskiden stehen im Kontrast zu den weniger bewaldeten Teilen der Schlesischen Tiefebene. Die Entwicklung der Wälder wurde durch Klima- und Bodenverhältnisse bestimmt, beeinflusst durch kolonisatorische Einflüsse, die Entwicklung von Industrie und Landwirtschaft, Eigentumsverhältnisse und in späterer Zeit durch die planmäßige Forstwirtschaft.
Im Niederes Gesenke überwiegt in Bezug auf die Vegetationsabstufung der Buchenwald, gefolgt von Buchen- und Eichenwäldern. Die ursprünglichen Baumarten im gesamten Gebiet waren die Buche und Weißtanne. Die Mischbestände wurden jedoch durch die Fichte ersetzt und nur selten finden sich heute noch Reste der ursprünglichen Zusammensetzung (z.B. in der Umgebung von Hradec nad Moravicí).
Die Wälder sind ein entscheidender Natur- und Landschaftsbestandteil von Altvatergebirge. Die heutigen Waldbestände sind im Vergleich zu den ursprünglichen Wäldern aufgrund der langjährigen Bewirtschaftung stark verändert worden, und Teile, in denen die heutige Baumzusammensetzung der ursprünglichen Zusammensetzung der Bestände entspricht, sind nur in Inseln erhalten geblieben, insbesondere in extremen und unzugänglichen Lebensräumen. Die Wälder bilden fast im gesamten Landschaftsschutzgebiet des Gesenkes einen großen zusammenhängenden Komplex.. Die Umwandlung der ursprünglichen fichtendominierten Mischwälder in die heutigen homogenen Bergfichtenwälder ist nicht nur auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen, sondern auch auf die sogenannte Kleine Eiszeit zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert - das kältere Klima kam der Fichte entgegen. Durch die rauen klimatischen Bedingungen entwickelte sich die typische Bergfichte mit ihrer schmalen, bis zum Boden verzweigten Krone und den achsenförmigen, nach unten gerichteten Ästen. Reste der ursprünglichen Bergfichtenbestände finden sich im Praděd-Nationalpark. Der sog. Liechtensteiner Wald, der im Jahr 1904 von Fürst Jan II. von Lichtenstein auf dem Gebiet des heutigen Naturschutzgebietes Šerák-Keprník gegründet wurde, war das erste Schutzgebiet im Gesenke und das älteste Schutzgebiet in Mähren und Schlesien.
In der Podbeskydská pahorkatina ist der Eichen-Buchenwald völlig vorherrschend, mit einem etwas kleineren Anteil an Buchenwald. Die ursprünglichen natürlichen Bestände wurden von Buchen-Eichen-Beständen mit einer Beimischung von Tannen und anderen Laubbäumen dominiert. Im nördlichen Teil waren Eichen-Hainbuchen, Ulmen und in den Auenwäldern auch Eschen reichlich vorhanden. Die Struktur von Laubbäumen ist sehr vielfältig. Der Wald ist sehr ungleichmäßig verteilt und meist in kleine Waldkomplexe oder isolierte Niederwälder fragmentiert. Die am besten erhaltenen Fragmente der Buchenvegetationsstufe sind im Naturschutzgebiet Palkovické hůrky, zwischen Kozlovice und Dolní Sklenov, geschützt.

Der am weitesten verbreitete Wald in den Mährisch-Schlesischen Beskiden war der Tannen-Buchenwald, in den höheren Lagen der Fichten-Buchenwald. Die ursprüngliche natürliche Vegetation war der Tannen-Buchenwald, mit einer Mischung aus Ahorn, Eiche, Esche und Ulmen. Die Fichte war nur marginal vertreten. Der Waldanteil im Gebiet ist sehr hoch und die Artenstruktur ist unangemessen zugunsten der Fichte verschoben, wobei die Buche die zweithäufigste Baumart ist. Die ursprüngliche Tanne ist nur noch minimal vertreten. Der am besten erhaltene Tannen-Buchen-Bestand im Gebiet ist im Naturschutzgebiet Mionší geschützt, während der einzigartige Rest natürlicher bergartiger Bestände im Naturschutzgebiet Kněhyně - Čertův mlýn geschützt ist.
Überraschenderweise sind die natürlichen Wälder im Opava Hochland schon seit langer Zeit erhalten geblieben, vor allem in der Region Opava. In der Vergangenheit herrschten hier Eichen-Buchenwälder mit einer Mischung aus Linde, Hainbuche und Ahorn vor, im Übergang zu höheren Lagen Buchenwälder. In diesem Gebiet gab es auch die sog. heraltische Kiefer, die noch heute in gemischten Beständen zwischen Cvilín und Opava zu finden ist, aber viele ihrer Bestände wurden auf Fichte umgestellt. Die Waldbedeckung in dem Gebiet ist relativ gering, wobei Eichen- und Buchenwälder überwiegen. Die natürliche Vegetation ist nur an wenigen Stellen erhalten geblieben. Der am besten erhaltene Eichen-Buchenwald ist im Naturschutzgebiet Černý les (Schwarzwald) bei Šilheřovice geschützt.
3.14 Forstwirtschaftliche Landschaft
Der Wald dient dem Menschen seit jeher als Nahrungsquelle, als Material zum Bau von Häusern und zur Herstellung von Werkzeugen, als Schutz vor Feinden und als Weide für das Vieh. Von Anfang an gab es eine gegenseitige Beeinflussung - der Mensch beeinflusst den Wald durch seine Aktivitäten und der Wald beeinflusst die Handlungen des Menschen durch seine Anwesenheit. Ziel des heutigen Ansatzes ist es, diese Quelle ökologisch sauberer, nachwachsender Rohstoffe nachhaltig zu bewirtschaften, die Artenvielfalt der Waldökosysteme zu erhalten und zu erhöhen, naturverträgliche Bewirtschaftungsmethoden anzuwenden und für die Gesundheit der Wälder zu sorgen, damit sie nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine ökologische Funktion und Erholungsfunktion erfüllen.
Das Gesenke erfuhr zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert eine bedeutende Veränderung. Damals wurde das Gesenke von der deutschen Bevölkerung im Zusammenhang mit der Suche nach und dem Abbau von Gold, Silber, Kupfer und anderen Metallen gezielt besiedelt (sog. Große Kolonisation). Nach und nach konzentrierte sich der Bergbau auch auf Eisenerzvorkommen. Mit der Entwicklung des Bergbaus wurden in den Flusstälern Hämmer und Schmelzhütten gebaut, die riesige Mengen an Holz verbrauchten, und so begann die Abholzung der Berghänge in höheren Lagen.
Andererseits waren die Beskiden bis zum Ende des Mittelalters praktisch ein Grenzwald an der Grenze zu Oberungarn. Bis zum 14. Jahrhundert waren in den Beskiden nur die Ausläufer des Gebirges besiedelt, was sich durch die Ankunft walachischer Kolonisten ab dem Ende des 15. Jahrhunderts änderte. Dank der sogenannten Schaf- und Ziegenzucht nutzten sie auch das Hochgebirge wirtschaftlich. Wälder wurden gerodet, um Platz für mehr Weideflächen zu schaffen, so dass sogenannte Weiden und Ahornhaine entstanden. Die Abholzung fand vor allem auf den Bergrücken statt, wo eine spätere Wiederaufforstung jedoch durch das raue Klima und die Beweidung blockiert wurde. Die sekundäre Besiedlung der Beskiden erfolgte ab dem 16. Jahrhundert in Form der sogenannten Streifenkolonisation und bedeutete eine grundlegende Veränderung der ursprünglichen Lebensräume - die Walddecke wurde gerodet und abgeholzt, um neue landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen. Eine weitere bedeutende Veränderung der Landschaft trat Mitte des 19. Jahrhunderts ein, als die Erschließung des Vorgebirges den Verbrauch von Holz und Holzkohle erhöhte. Um mehr Gewinn zu machen, führten die Gutsbesitzer nach und nach eine planmäßige Forstwirtschaft nach deutschem Vorbild ein, verdrängten die Viehhalter nach und nach aus den Bergen und forsteten das Land mit Fichten auf.
Zu den Aktivitäten, die zur Verschlechterung der Wälder beitrugen, gehörten die Herstellung von Holzkohle, Teer, die Ernte der Sommerfrüchte, das Weiden des Viehs in den Wäldern, usw. Die eigentliche Zerstörung der Wälder wurde durch die Entwicklung des Bergbaus und der Erzaufbereitung und etwas später durch die Entwicklung der Glasherstellung herbeigeführt. Die Wälder in der Nähe von Wasserläufen, durch die Holz geflößt werden konnte, litten am meisten. Vielerorts verschwand der natürliche mildernde Einfluss von Buche, Ahorn und Esche, und die Artenzusammensetzung der damaligen Wälder war arm an Tannen, die die Fichtenwälder stärkten. Infolge intensiver Ausbeutung wurden die Wälder im 17. Jahrhundert stark reduziert und ihre Reste waren in einem sehr schlechten Zustand.
Der enorme Holzverbrauch, die verwüsteten Wälder und die Befürchtung, dass die gesamte Wirtschaft durch zu wenig Holz bedroht sei, führten zur Erteilung eines kaiserlichen Patents, das die Grundsätze der Waldbewirtschaftung vereinheitlichen und ausreichend Holz für die Zukunft sichern sollte. Die Theresianische Waldordnung (für Schlesien, 1756) verpflichtete die Besitzer von Wäldern zu einer Reihe von Verpflichtungen und Beschränkungen im Interesse der Walderhaltung und der nachhaltigen Holzausbeute (die Verpflichtung zur Wiederaufforstung abgeernteter Flächen, das Verbot der Harzgewinnung aus gesunden Bäumen, das Verbot des Holzexports ins Ausland, die Verpflichtung der Förster zu einer entsprechenden Ausbildung usw.). Die Holzknappheit in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts führte auch zu einer revolutionären Veränderung in der Artenzusammensetzung unserer Wälder. Laubwälder wurden durch ungemischte Bestände von Kiefer und Fichte ersetzt, die Fichte wuchs sehr gut, und Qualitätsholz war in relativ kurzer Zeit verfügbar.

Mit dem Beginn der industriellen Revolution wurde Holz allmählich durch Kohle ersetzt, die im Grunde genommen die Rettung für die Wälder darstellte. Dennoch ist im Laufe des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein weiterer Rückgang der Waldbedeckung zu beobachten, insbesondere in landwirtschaftlichen Gebieten und in den Zentren der Industrialisierung. Nicht nur, dass aufgrund der hohen Nachfrage nach Holz Wälder abgeholzt wurden, sondern auch das Problem der Schädigung insbesondere der Nadelbäume durch Industrieabgase begann sich zu manifestieren. Hinsichtlich der Artenzusammensetzung waren die Tannenbestände am meisten gefährdet, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts im Bezirk Ostrava-Karviná ausstarben. Der Rückgang der Waldflächen hing auch mit der Entwicklung der Bergbauindustrie und dem sich intensivierenden Prozess der Verstädterung zusammen, vor allem aber mit der Umwandlung in Ackerland, nach dem ein zunehmender Hunger herrschte. Infolgedessen sank um die Mitte des 20. Jahrhunderts der Anteil der Wälder in der schlesischen Landschaft auf einen historischen Tiefstand. Erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts begann sich der Trend umzukehren (Rekultivierung der Landschaft, Zusammenbruch der sozialistischen Planung in der Landwirtschaft).
Das Ziel der Waldbewirtschaftung im 18. und 19. Jahrhundert war die schnelle Gewinnung von hochwertigem Rohmaterial für Bauzwecke, und dafür waren Fichtenbestände am besten geeignet. Die Umwandlung von heimischen Laub- und Mischbeständen in Fichten- oder Kiefernmonokulturen setzte sich bis ins 20. Jahrhundert fort. Ab den 1970er Jahren setzte sich der Drang zur Mechanisierung der Forstwirtschaft mit der Einführung von großen Forstmaschinen durch, was zu einer Bevorzugung von Steineichenholz und einer weiteren Erhöhung des Nadelholzanteils führte.
Die moderne Waldbewirtschaftung basiert nicht nur auf dem Eigentum, sondern auch auf der gesellschaftlichen Nachfrage. Förster versuchen seit langem, die Baumzusammensetzung der ursprünglichen Darstellung anzunähern, bevorzugen bei der Pflanzung Laubbaumarten und streben eine naturnahe Waldbewirtschaftung an. Auch die Ansprüche der Gesellschaft an den Wald haben sich verändert. Es wird zunehmend gefordert, dass der Wald als besterhaltener Teil unserer Natur erhalten bleibt und nicht nur wirtschaftlichen Nutzen, sondern auch Erholung und Entspannung bietet.
3.15 Wälder in Gefahr
Die Umwandlung der ursprünglichen Mischwälder in Fichtenmonokulturen hat zu einer erheblichen Schwächung der natürlichen Waldfunktion geführt und prägt den Zustand unserer Wälder bis heute. Wind, Frost, Schnee und Wild verursachen große Schäden an den geschwächten Waldbeständen. In regenarmen Zeiten kommt es zu umfangreichen Schäden durch schädliche Insekten im Wald. In den 1970er und 1980er Jahren kam es zu einer erheblichen Degradierung der Wälder, insbesondere in den Beskiden, durch Emissionen und die damit verbundene langfristige Versauerung und Nährstoffverarmung der Waldböden.
Neuere Forschungen zur Dynamik von Gebirgswäldern zeigen, dass ihr Zerfall über größere Flächen natürlich verläuft. Die Hauptgründe für den natürlichen Zerfall der mitteleuropäischen Bergfichtenwälder sind Stürme und der nachfolgende Einschlag von Borkenkäfern (hauptsächlich Borkenkäfer, insbesondere der Fichtenborkenkäfer). Das Alter der Bestände spielt ebenfalls eine wichtige Rolle; ältere Wälder sind anfälliger für Wind und nachfolgende Insektenbefall als jüngere Bestände. Lycophyten sind zusammen mit anderen Insekten Teil des natürlichen Bergwaldes und tragen zur Waldregeneration bei. Sie befallen bevorzugt Baumstämme, gefälltes Holz oder alte absterbende Bäume. Nach Windwürfen oder Schwächung von Waldbeständen durch ungünstige Bedingungen können sich Borkenkäfer schnell vermehren. Steigt ihre Zahl über einen bestimmten Schwellenwert, greifen sie auch gesunde Bäume an und verursachen ein großflächiges Waldsterben.
The weakening of trees can be mainly caused by warm and dry weather with a lack of precipitation, which is also the cause of the current overgrowth of bark beetles in non-native spruce forests (Beskydy, Jeseníky Mountains). Bark beetle gradation is virtually inevitable given the current state of mountain spruce forests, especially given the current climatic fluctuations and the high age of the stands. In addition, these ecosystems were created under significantly different climatic conditions than today. Die Schwächung der Bäume kann vor allem durch warmes und trockenes Wetter mit einem Mangel an Niederschlägen verursacht werden, was auch die Ursache für die derzeitige starke Vermehrung des Borkenkäfers in nicht heimischen Fichtenwäldern ist (Beskydy, Jeseníky). Bei dem derzeitigen Zustand der Bergfichtenwälder ist eine Ausbreitung des Borkenkäfers nahezu unvermeidlich, insbesondere bei den derzeitigen Klimaschwankungen und dem hohen Alter der Bestände. Hinzu kommt, dass diese Ökosysteme unter deutlich anderen klimatischen Bedingungen entstanden sind, als sie heute herrschen.
Infolge des negativen Einflusses von Industriegebieten (Ostrava, Oberschlesien) wurde die Gesundheit der Wälder geschädigt und deutlich verschlechtert. Ab den 1870er Jahren begann man in der Region Ostrava-Karviná die Auswirkungen der industriellen Emissionen auf die Waldbestände und landwirtschaftlichen Kulturen zu beobachten. Die Wälder im Bezirk Ostrava-Karviná wurden zu einem Symbol für das Schicksal der Wälder in und um die Stadt Ostrava. Bereits 1870 organisierte ein Komitee des Mährisch-Schlesischen Forstvereines eine Exkursion in die hiesigen Wälder und stellte fest, dass die Tannen in den Beständen bereits vollständig ausgerottet waren und andere Bäume wenig Wachstum zeigten oder abstarben. Aufgrund der Intensität der Schäden an den Waldbeständen wurde er Ende des 19. Jahrhunderts und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts sogar zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Anfang der 1920er Jahre stellte der bedeutende tschechische Chemiker und Biologe Julius Stoklasa fest, dass es nur wenige Orte gibt, an denen die Emissionen die Vegetation so intensiv beeinträchtigen wie in der Umgebung des mährischen und schlesischen Ostrava, Vítkovice und Karviná. Nach seinen Berechnungen werden in diesem Bereich täglich mehr als fünf Waggons schwefelhaltige Kohle verbrannt.
Die Luftqualität im Industriegebiet von Ostrava wurde besonders in der Zeit der sozialistischen Industrialisierung beeinträchtigt. Der größenwahnsinnige Aufbau der Hütten-, Strom- und Koksindustrie sowie die Verwendung minderwertiger Brennstoffe belasteten die Luft extrem, so dass der hygienische Standard sowohl für Staub als auch für Emissionen anderer Stoffe ständig überschritten wurde, insbesondere SO2. Die wahrscheinlich schlimmste Situation im Bereich der Luftverschmutzung gab es in den 1950er und frühen 1960er Jahren, als neu gebaute Industriekapazitäten nur minimale Maßnahmen getroffen haben um die Staubemissionen und schädlichen Emissionen zu reduzieren. Die in den Hygienevorschriften festgelegten durchschnittlichen Tagesgrenzwerte für die SO2-Konzentration wurden an einigen Messstellen bis um das Zehnfache überschritten. Es überrascht nicht, dass die Waldbedeckung in den Bezirken Ostrava und Karviná Mitte der 1970er Jahre die niedrigste in der gesamten Tschechoslowakei war.

Vor allem im nördlichen und nordwestlichen Teil der Mährisch-Schlesischen Beskiden wurde der Waldbestand schnell degradiert. Alarmierende Berichte über großflächige Schäden oder das Absterben von Wäldern in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren beschäftigten sich ausschließlich mit der Wirkung von Emissionen, insbesondere der direkten Wirkung von Kohlendioxid auf den Assimilationsapparat der Bäume. Allmählich wurde auch der Effekt der sauren Deposition und der anschließenden Bodenversauerung als ein weiterer wichtiger Mechanismus der Schädigung akzeptiert. Die Entwicklung der Luftverschmutzung im Zeitraum 1980-1999 ist durch drei Hauptschadstoffe gekennzeichnet: Schwefeldioxid und Stickoxide sowie Feinstaub. Schwefeldioxid und Stickoxide sind ein natürlicher Bestandteil der Atmosphäre, aber ihre Überproduktion, die hauptsächlich durch anthropogene Quellen verursacht wird, schafft ein Problem, mit dem die Natur nicht fertig wird. Saurer Regen ist einer der Hauptfaktoren, die Schäden an Bäumen verursachen. Im Jahr 1999 wurde die Entschwefelung großer SO2-Quellen abgeschlossen, wodurch die gesamten Schwefelemissionen in der Tschechischen Republik auf 10 % der in den frühen 90er Jahren produzierten Menge reduziert wurden. Die Stickstoffemissionen sind seither um etwa 30 % gesunken, und ihre Struktur hat sich verändert, wobei der Verkehr zu einer Hauptquelle geworden ist. Nicht nur Fichtenwälder werden geschädigt, auch andere Baumarten können bedroht sein. In den letzten 20 Jahren gab es zum Beispiel einen signifikanten Rückgang der Esche. Der Erreger ist der Pilz Chalara fraxinea, der mittlerweile in ganz Europa verbreitet ist. Es besteht also die Gefahr, dass die Eschen allmählich aus unserer Landschaft verschwinden.
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ist ein Vegetationsindex, der das Verhältnis der Oberflächenreflexion im roten sichtbaren und nahen infraroten Teil des Spektrums angibt. Die resultierenden Indexwerte, die von -1 bis +1 reichen, geben einen Hinweis auf die Menge an Chlorophyll, die in dem betreffenden Bereich vorhanden ist. Sehr niedrige NDVI-Werte stehen in der Regel für ein Gebiet ohne Vegetation (z. B. Schnee). Niedrige Werte weisen auf Bereiche mit wenig oder keiner Vegetation hin (z. B. Felsen, nackter Boden). Mittlere Werte weisen auf Bereiche mit Grasland und Gestrüpp hin. Hohe Werte weisen auf Wälder und andere Gebiete mit sehr dichter Vegetation hin. Der NDVI zeigt auch den Gesundheitszustand der Vegetation an.
3.16 Stadtparks
Ein Stadtpark ist eine bestimmte Art von Parkobjekt, das Teil der städtischen Umgebung ist. Diese Bezeichnung bezieht sich auf einen öffentlichen Raum, der aus dauerhaft begrünten Flächen mit Zierbepflanzung (Bäume, Sträucher, Flächen für die Anzucht von Stauden oder einjährigen Pflanzen), Wasserspielen (Brunnen, Teiche), Mobiliar (Bänke, Beleuchtungskörper) und einer parkähnlichen Umgebung besteht, Geländer, Wetterkästen, Mülleimer, Spielelemente), Kunstwerke (dekorative Statuen und Denkmäler) und kleine Gebäude (Pergolen, Nischen), die entweder eine zentrale Position innerhalb der Stadt einnehmen oder sich an ihrer Peripherie befinden. In erster Linie dient er der Erholung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung oder künstlerischen Inszenierungen (Promenadenkonzerte), in zweiter Linie der ästhetischen und staatsbürgerlichen Bildung der jüngeren Generation und dem Unterricht in Botanik und Dendrologie.
Opava vermittelt einen Eindruck von den verschiedenen Formen von Grünflächen. Der 1798 gegründete Stadtpark war mit einer sich modernisierenden Bürgergesellschaft verbunden, wovon die im Park ausgeübten Aktivitäten zeugen, darunter der Bürgerschießstand, Sportplätze (ein Fußballplatz in der Nähe des Parks existierte seit Beginn des 20. Jahrhunderts), Cafés oder Ausstellungshallen. Die heute noch bestehenden Parkanlagen rund um die kreisförmige Allee, die gelegentlich mit Werken zeitgenössischer Künstler (z. B. Kurt Gebauers Vögel) bereichert werden, wurden bis 1945 durch Sommercafés ergänzt. Natürlich war die Parklinie durch Alleen und Vorgärten der Wohnhäuser mit den senkrecht dazu verlaufenden Straßen verbunden. Zu den Einrichtungen des Parks gehört ein Musikpavillon; in den letzten Jahren wurde das Urban Alpinum restauriert und eine Gedenktafel mit dem Portrait des bedeutenden schlesischen Botanikers angebracht. Die kreisförmigen Parks gehören nicht nur der Vergangenheit an, sondern haben einen direkten Bezug zum heutigen Leben, nicht zuletzt, weil sie wichtige Kommunikationslinien tragen. Weitere öffentliche Grünflächen, die man als öffentliche Stadtparks bezeichnen könnte, wurden auf den Plätzen der Vorstadtviertel angelegt (Denis-Platz, Bezruč-Platz, Joy-Adamson-Platz; auf dem Gelände der heutigen Friedhöfe, Dreifaltigkeitsplatz, St.-Hedwig-Platz).

Bemerkenswerte Parkbauten finden sich auch in anderen schlesischen Städten, z.B. in Bílovec, wo der Park mit der Existenz eines bürgerlichen Schießstandes zusammenhängt (der Musikpavillon ist bis heute erhalten geblieben). Das Rückgrat der Bepflanzung besteht aus Alleen, die den Fußgängerwegen folgen und Rasenflächen definieren. Ähnlich wurde auch der Park in Vítkov bepflanzt, wo im Hinblick auf die Zeit seiner Entstehung (um 1900) auch landschaftliche Motive eingeführt wurden, vor allem der Teich mit einer Insel und ein mit mehreren Steinstufen gestalteter Zugang. Von den Städten in Tschechisch-Schlesien, die mit dem Kurwesen verbunden sind, ragt Jeseník heraus, dessen integraler Bestandteil das Lázně Jeseník (Heilbad Jeseník) ist. Dank ständiger Pflege hat es seinen Charakter aus der Zeit um 1900 bewahrt, einschließlich der Park-Ensembles. An anderen Orten (z.B. Vidnava, Javorník, Zlaté Hory) sind eher die Folgen des chronischen Mangels an präventiver Instandhaltung und professioneller Pflege des Stadtgrüns als Bestandteil des kulturellen Erbes zu beobachten.
3.17 Schlossparks
Ein Schlosspark ist ein spezifischer Typ eines Parkobjektes, der einen ländlichen oder städtischen Adelssitz ergänzt und dessen Geschichte und oft auch sein Schicksal, einschließlich stilistischer Veränderungen oder Verwüstungen, teilt. Schlossparks können nach verschiedenen Kategorien klassifiziert werden: nach der Größe, nach der dendrologischen Zusammensetzung, nach dem Niveau der architektonischen Gestaltung, nach dem Vorhandensein eines Wasserspiels, nach dem Erhaltungsgrad der Einrichtung oder nach der Zugänglichkeit.
Im Untersuchungsgebiet gibt es weder einen Renaissance- noch einen Barockschlosspark. Alle bei Schlössern und Burgen angelegten Parks sind nach englischer Art stark umgestaltet erhalten geblieben (obwohl einige Teile des Burggrabens aus der Zeit der Renaissance erhalten geblieben sind, z.B. in Linhartov), oder Befestigungsanlagen). Das englische Parkkonzept hat das ältere, barocke, ikonographisch belegte, geometrische Konzept der Parterrebildung verdrängt, das durch ein naturnahes Landschaftskonzept geprägt ist. Bei einigen Burgen ist eine geometrische Komposition zu erkennen, die auf einer zum Burggebäude hin orientierten Achse beruht (z. B. Štáblovice, Hnojník, Velké Hoštice). Diese sind keine Überbleibsel älterer französischer Gärten, sondern das Ergebnis der Geometrisierung des Gartenparterres im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Hauptelemente sind große Rasenflächen in Form von Esplanaden, die von der Siedlung weg in die Landschaft führen (Raduň, Fryštát, Šilheřovice), Alleen, die entweder der Siedlung zugewandt sind und eine Fahrstraße definieren (Dubová), die die Burg mit der dominanten Landschaft verbinden (vor allem die Verbindung zwischen der Burg und der Wallfahrtskapelle in Dolní Životice oder Štemplovec), oder als integraler Bestandteil eines großen Parterres (Město Albrechtice), Solitäre, die oft mit Rücksicht auf Kontraste in Kronenform, Laubfarbe oder Art (Nadelbäume × Laubbäume) gepflanzt werden (Litultovice). Bei großen Komplexen (Kravaře, Fryštát, Hradec nad Moravicí) wird im Park ein markantes Wasserelement eingesetzt, während in der Nachbarschaft des Schlossgebäudes ein geometrisches Parterre erscheint (oft im Sinne einer idealen Rekonstruktion).
Zierelemente waren schon immer ein fester Bestandteil des Parks: Brunnen, Vasen, Obelisken, bildhauerische Werke, kleine Gebäude, Pavillons, Einsiedeleien, Aussichtspunkte, die mit einem Pavillon oder sogar einem kleinen Aussichtsturm (Hradec nad Moravicí) ausgestattet waren; über kleine Wasserläufe wurden dekorative Brücken gebaut, der Park wurde immer durch Spazierwege und gepflasterte Pfade gegliedert, die Bepflanzung mit Bäumen wurde durch Blumenbeete und Bereiche für die Übersommerung exotischer Pflanzen ergänzt (für die zur Überwinterung Orangerien entworfen wurden). Eine attraktive Ergänzung des Parks ist ein Zierteich (z. B. in Slezské Rudoltice); bei Wasserflächen war es um 1900 üblich, eine künstliche Insel hinzuzufügen (Mladecko, Litultovice). Einzigartig ist das Teich-Trio im Schlosspark Radun, das im Bezug auf die Fauna und Flora wertvoll ist. Ein bemerkenswertes Phänomen des Parks in Hradec nad Moravicí ist die Benennung seiner Teile - Straßen, Brücken, Plätze nach Mitgliedern der Familie Lichnovsky oder deren Freunde. Diese weitgehend erhaltenen Bezeichnungen wurden kürzlich restauriert und werden denkmalpflegerisch betreut. Nur sporadisch sind Orangerien, Gewächshäuser und andere Gebäude erhalten geblieben (Hošťálkovy), oft dokumentiert durch Pläne (Jezdkovice) oder Fotografien (Dívčí Hrad). Überlieferte Pläne ganzer Parks sind eher die Ausnahme (Dolní Životice oder Jezdkovice). n für die Kenntnis der Parks sind sporadisch, z.B. kennen wir nur selten die Namen der Gärtner (für den Park in Jindřichov die Gärtner Wikola und Kříž, für den Park in Kyjovice J. Kupka und A. Dragoun, usw.). Wertvolle Informationsquellen sind zeitgenössische Drucke (Hradec nad Moravicí), Fotografien, vor allem von den verschwundenen Burggebäuden (Dobroslavice, Třebovice) oder von der umgebauten Burg (Štáblovice). Gelegentlich haben wir auch Bereiche zur Entspannung dokumentiert (z. B. Sommersitzplätze im Gartenparterre des Schlosses in Stěbořice).

Nach 1945 können wir die Verwüstung der Parkbauten beobachten; in einigen Fällen überlebte der Park sogar die Existenz des Schlosses selbst, dass er ursprünglich ergänzte (Dobroslavice, Hrabyně, Orlová). Ein wichtiges Kriterium ist aus heutiger Sicht die Integrität des Parkobjektes: Wir unterscheiden zwischen 1. Parks, die ihre Integrität bewahrt haben (d.h. sie sind noch z.B. durch eine Mauer oder einen Zaun von der Innenstadt getrennt); 2. Parks, die als öffentliche Grünflächen Teil der Siedlung geworden sind (teilweise in Javorník - Schloss Janský Vrch, vollständig in der Nähe von Jeseník, Klimkovice, Poruba, usw.); und 3. Fragmente ehemaliger Parks und Gärten (oft seltene Solitäre). Ein einzigartiger Fall ist der Schlosspark in Linhartov, der durch die Staatsgrenze zwischen Österreich und Preußen im Jahr 1742 geteilt wurde, so dass ein Teil davon mit einer Orangerie noch immer auf polnischem Gebiet liegt.
3.18 Baumreihen, Alleen und Gedenkbäume
Baumreihen und Alleen sind eine besondere Art der Baumbepflanzung, meist entlang von Straßen. Von einer Baumreihe spricht man, wenn die gepflanzten Bäume in regelmäßigen Abständen in einer Linie angeordnet sind. Typischerweise besteht eine Baumreihe aus einer einzigen Baumart. Eine Allee besteht in der Regel aus zwei, in manchen Fällen aber auch aus mehr als einer Baumreihe.
Obwohl es seltene Berichte über Baumreihen und Alleen bereits im 15. Jahrhundert gibt, kann ihre Verbreitung in Mitteleuropa erst ab dem 17. Jahrhundert verzeichnet werden, als sie begannen, ein wichtiges Landschaftselement der sogenannten Barocklandschaft zu bilden. Das Netz der Haupt- und Nebenstraßen mit den typischen Baumalleen hat die Landschaft der böhmischen Länder dauerhaft geprägt, vor allem während der Regierungszeit von Maria Theresia und Joseph II., als die Pflanzung von Bäumen in Alleen entlang der Straßen sogar durch kaiserliche Patente angeordnet wurde. Die "nützlichen" Bäume, die entlang der Straßen gepflanzt wurden, sollten den Reisenden Schutz vor Sonne und Schnee bieten, und auch für die Obstversorgung waren die Bäume von großer Bedeutung.
So wurden die Alleen in kurzer Zeit zu einem typischen Landschaftselement, das bis in das 20. Jahrhundert Bestand hatte. Erst durch das Aufkommen des Automobils sind viele von ihnen verschwunden. Besonders in den letzten Jahrzehnten wurden sie häufig beschädigt, sowohl durch den Umbau des Straßennetzes als auch vor allem durch eine unzureichende Straßenpflege (Streuen der Straßen, Einsatz von Herbiziden) und auch die Abschaffung der Fachgruppen der Straßenverwaltung, die in den 1970er und 1980er Jahren die Alleen betreuten. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts werden Alleen unter dem Vorwand entfernt, sie seien gefährlich für den zunehmenden Straßenverkehr.
Einige sehr alte oder anderweitig interessante Alleen bleiben jedoch als wichtige Naturdenkmäler staatlich geschützt. Obwohl es in Schlesien Hunderte von Baumreihen und Alleen gibt, sind nur einige von ihnen mit monumentalen Bäumen bestückt. Zum Beispiel die einzigartige vierreihige Lindenallee auf dem Uhliřský vrch bei Bruntál und die Allee auf dem Anenský vrch in Andělská Hora, die Eichenallee in Radun und die Reste der Allee der ehemaligen "Kaiserstraße" in Havířov (vor allem auf der E. Krásnohorská Straße). Darüber hinaus sind einige Alleen und Baumreihen als bedeutendes Landschaftselement registriert, z. B. die sehr eindrucksvolle Lindenallee zwischen dem Schloss in Dubová und Radkov oder die Lindenallee von Hnojník nach Komorní Lhotka. Fast einen halben Kilometer lang ist eine bemerkenswerte Linden-Ahorn-Allee, die sich in der Nähe von Janovice bei Rýmařov an der Strecke V alejích befindet. Beweise für seine Existenz sind bereits in den Karten der zweiten militärischen Kartierung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu finden. Es gibt einen Wander- und Lehrpfad durch die Allee.
Ein Baumdenkmal ist eine offizielle Bezeichnung für Bäume von besonderer Bedeutung, die nach dem Natur- und Landschaftsschutzgesetz zu Denkmalbäumen erklärt wurden. Sie sind mit einer Plakette mit einem kleinen Staatswappen gekennzeichnet, meist auf einem Ständer in der Nähe des Baumstammes. Jeder Bürger der Tschechischen Republik kann die Ausweisung eines Baumes als Denkmal bei der zuständigen Behörde vorschlagen. Der Vorschlag wird von der Behörde auf seine Eignung hin geprüft und eine Entscheidung getroffen. Jeder Denkmalbaum hat eine Schutzzone, in der keine für den Denkmalbaum schädliche Tätigkeit erlaubt ist (z.B. Geländeveränderung, Entwässerung, Chemisierung, Bauarbeiten usw.).
Um viele dieser monumentalen Bäume ranken sich Legenden, die mit der Geschichte verbunden sind (z. B. die Josefina-Platane in Bartošovice oder die sog. Bruderlinde in Velké Štáhli). Bemerkenswert ist die geschützte Sommereiche im Schlosspark in Linhartovice. Sie hat einen Stammumfang von 720 cm, eine Höhe von 28 m, eine Kronenbreite von 10 m und ein geschätztes Alter von ca. 850 Jahren. Sie wächst als Solitär im Schlosspark und ist eine der 10 Eichen mit dem stärksten Stamm in Tschechien. Die Beziehung der Menschen zu den Bäumen entwickelte und verstärkte sich vor allem während der tschechischen nationalen Wiedergeburt, die zur Zeit der Nationalhelden wurde. Eine moderne Welle des Interesses an alten und monumentalen Bäumen, ihren Geschichten und ihrem Schutz wurde durch die Fernsehserie "Gedenken der Bäume" ausgelöst.

Klicken Sie auf das Bild um die Galerie zu öffnen..

3.19 Wasser und Mensch
Wasser ist für den Menschen seit jeher von grundlegender Bedeutung. In der Vergangenheit wurden Wasserquellen verehrt, wovon nicht nur die Namen von Quellen und Brunnen zeugen, sondern auch die mit ihnen verbundenen Legenden und Sagen. Den Quellen und Brunnen wurde die gebührende Pflege zuteil, die von verschiedenen Zeremonien (z.B. Brunneneinweihung) begleitet wurde. Vielen Quellen wurden heilende Kräfte zugeschrieben. In den letzten zwei Jahrhunderten hat sich die Beziehung zum Wasser allmählich verändert, Wasser wurde ausgebeutet und viele Landschaftsveränderungen hatten unglückliche Folgen. Da sich das Klima in den letzten Jahren stark verändert hat, wird den Menschen die unersetzliche Rolle des Wassers in der Landschaft und für das Leben im Allgemeinen wieder bewusst.
Das Fehlen von Gewässern in der Landschaft wurde nach und nach durch den Bau von künstlichen Wasserwerken ersetzt. Zunächst wurden Zuchtteiche, später die ersten künstlichen Stauseen, Teiche angelegt. Bereits im 11. Jahrhundert wurden im Oderbecken Teiche angelegt und die Tradition des Teichbaus hat sich bis in die heutige Zeit erhalten, obwohl viele Teiche im 18. und 19. Jahrhundert trockengelegt wurden. Eines der wichtigsten ist das System der Teiche zwischen Studenka und Ostrava. Insbesondere beim Sand- und Kiesabbau werden auch künstliche Wasserreservoirs angelegt. Spezifische Biotope sind geflutete Steinbrüche und Abbaubecken.
Das Ende des 19. und der Beginn des 20. Jahrhunderts waren für den Bau von Staudämmen besonders wichtig, als die Entwicklung der Industrie die Modernisierung alter und den Bau neuer Staudämme erforderte. Ein Wehr ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Wassersäule eines Fließgewässers zu erhöhen und die es in der Regel auch ermöglicht, einen Teil des Durchflusses aus dem Hauptgerinne in einen Damm zu leiten. Sie dient der Nutzbarmachung des abfließenden Wassers zur Energiegewinnung (Mühle, Sägewerk, Kraftwerk) oder wird zur Regulierung des Gewässers (Hochwasserschutz, Erhöhung der Schiffbarkeit) gebaut. Ein Stauwehr ist eine ähnliche Konstruktion. Der Hauptunterschied besteht darin, dass ein Wehr in der Regel in einem stehenden Gewässer als Teil eines Dammes gebaut wird, um zu verhindern, dass der Wasserspiegel eine bestimmte Grenze überschreitet, während ein Stauwehr auf fließendem Wasser gebaut wird, um den Wasserspiegel anzuheben. Ein besonderes Wasserbauwerk ist ein künstlicher Wasserfall, der eine Nachahmung eines natürlichen Wasserfalls ist, ein Bauwerk, das hauptsächlich aus ästhetischen Gründen an einem Wasserlauf errichtet wird. Der künstliche Wasserfall, der eine der Attraktionen von Karlova Studánka ist, wurde Ende des 19. Jahrhunderts für die Bedürfnisse des Kurortes gebaut.
Ein einzigartiges technisches Denkmal in Schlesien ist die vom hiesigen Unternehmer Carl Weisshuhn erbaute Talsperre. Im Mai 1891 wurde der gesamte 3,6 km lange Kanal in Betrieb genommen und diente der Holzflößung zu den Papierfabriken in Žimrovice, wo er Wasser und Energie lieferte.
Zu den Wasserbauwerken gehören auch Wasserreservoirs, Wasserspeicheranlagen. Ihr Zweck ist es, die Differenzen zwischen Zuflüssen aus der Wasserquelle und Entnahmen der Verbraucher auszugleichen, den notwendigen Druck im Wasserversorgungsnetz bereitzustellen und eine ausreichende Wasserreserve für den Brandfall zu gewährleisten. Wassertanks können unterirdisch oder oberirdisch gebaut werden; Hochbehälter werden in flachen Gebieten gebaut und bilden meist eine markante Landmarke in der Landschaft.

Im 20. Jahrhundert wurde das Wasserversorgungs- und Abwassernetz intensiv ausgebaut und modernisiert. Das Wasserversorgungsnetz umfasst die Einrichtungen zur Trinkwasserversorgung, während das Abwassernetz eine Reihe von Einrichtungen zur Ableitung von Abwasser aus einzelnen Gebäuden und öffentlichen Räumen zu einer Kläranlage darstellt. Dank Kläranlagen konnte die Verschmutzung der Fließgewässer und damit die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft in den letzten Jahrzehnten deutlich reduziert werden. Der aktuelle Trend geht dahin, Wasser in die Landschaft zurückzugeben, Wasserläufe zu revitalisieren, Feuchtgebiete wiederherzustellen und andere Aktivitäten, die darauf abzielen, dem Wasser seine ursprüngliche, natürliche Funktion in der Landschaft zurückzugeben.
3.20 Mineralwasser
Mineralwässer gehören zum natürlichen Reichtum von Schlesien. Ihre Quellen werden zur Kurbehandlung und zum täglichen Trinken verwendet. Jede der natürlichen Quellen hat unterschiedliche Eigenschaften und daher einen anderen Geschmack. Mineralwässer sind natürliche Gemische und Lösungen unterschiedlicher Konzentration, deren Entstehung durch eine Reihe von Faktoren bedingt wurde.
Das kohlensäurehaltigen Wasser in der Region Jesenik hat einen niedrigen Kohlendioxidgehalt und eine geringe Mineralisierung. Ihre schlechte Chemie ist auf die relativ homogene und gesteinsarme Geologie zurückzuführen, die hauptsächlich aus Klasten, Schiefer und Phylliten besteht.
Vor ein paar Jahrzehnten gab es im Niederen Gesenke wesentlich mehr Sauerwasser und Sauerwasserquellen entstanden an vielen Orten. Durch den Verkauf der meist chemisch behandelten Mineralwässer hat die Bevölkerung vielerorts das Interesse an der Pflege von Quellen, Brunnen und Schächten verloren, so dass viele der Sauerwasserquellen verschwunden sind. Auch viele Mineralwasserquellen in Schlesien verschwanden oder wurden durch die großen Überschwemmungen von 1997 beschädigt. Glücklicherweise ändert sich das Verhältnis zu den natürlichen Ressourcen allmählich wieder und viele Quellen natürlicher Mineralwässer werden wiederhergestellt. Ein Beispiel ist die Gemeinde Lichnov in der Region Bruntál, die in ein geologisches Bohrloch investiert hat und es geschafft hat, die ursprüngliche Quelle der beliebten Lichnov-Sauerwassers wiederherzustellen.
Das Mineralwasser in Karlova Studánka ist ein saures Wasser, das typisch für die Region Jeseníky ist. Seine chemische Zusammensetzung wird von Bikarbonaten und Kalzium dominiert, mit kleineren Mengen an Strontium, Lithium, Eisen und Kieselsäure. Die Ursache der Mineralquellen in Karlova Studánka ist die Bela-Verwerfung, die die geologisch sehr komplizierte Gesteinsstruktur des Rauen Altvatergebirge in nordwestlich-südöstlicher Richtung durchschneidet. Die Verwerfungszone, die von zahlreichen Klüften begleitet wird, ermöglicht das Versickern von reichhaltigen Niederschlägen bis in eine Tiefe von 200 Metern und bietet gleichzeitig einen Weg für Kohlendioxid aus der Tiefe, dessen Ursprung mit dem quartären Vulkanismus in der Umgebung von Bruntál zusammenhängt. Obwohl der Eisengehalt von Mineralwässern in der Regel gering ist, ist er beider Ausströmung stark bemerkbar, wenn zweiwertiges Eisen an der Luft zu dreiwertigem Eisen oxidiert und dabei charakteristische rostige Hydroxidschichten bildet.
Im malerischen Tal des Flusses Moravice (Mähren) befindet sich der heute leider verwüstete Kurort Jánské Koupele, der im Jahr 1809 gegründet wurde. Bereits im Jahr 1754 wurde das hiesige stark kohlensäurehaltige Wasser, das Melčská kyselka genannt wurde, in Fässer abgefüllt und auf die Burg in Melč gebracht. Heutzutage sind die Pavillons der Marie- und Paul-Quellen geschlossen und es ist nicht mehr möglich, das Mineralwasser, das sehr beliebt war, zu konsumieren. Besucher können nur den traurigen Anblick der verfallenen Quellen sehen.
Auch an anderen Orten gibt es kohlensäurehaltige Mineralwasserquellen. Zu den bekannteren gehören Jeseník nad Odrou, Dolní Moravice, Suchá Rudná und Zátor. In Velká Štáhla befindet sich eine CO2-Abfüllanlage. In der Nähe von Moravský Beroun, in der Nähe der Siedlung Sedm Dvorů, befindet sich eine Pumpstation, von der aus eines der bekanntesten Mineralwasser per Pipeline zum Werk in Ondrášov transportiert wird. Es gehört auch zu einer Gruppe von Mineralwässern, deren Ursprung mit der jungen vulkanischen Tätigkeit in der Region des Niederen Gesenke verbunden ist. Zur gleichen Gruppe von Mineralwässern gehört auch das im Jahr 1957 in Lhotka bei Litultovice entdeckte Mineralwasser.

Im Ostrauer Becken gibt es auch eine Reihe von Mineralwasserquellen. Ihre Existenz wurde durch Bohrungen im Zusammenhang mit dem Kohleabbau entdeckt. Die Mineralwässer in Karviná-Darkov gehören zu fossilen, chemisch umgewandelten Meerwässern (Solen) aus tertiären Sandschichten. Das Jod-Brom-Wasser wird von Natrium- und Chlorionen dominiert, und der Brom- und Jodgehalt ist sogar der höchste in Europa. Die Geschichte der Verwendung von Jodbromwasser im Gebiet von Karviná reicht bis in das 13. Jahrhundert zurück, als in Solka (heute ein Teil von Karviná) Salz hergestellt wurde. An diese Tradition knüpft heute das sogenannte Darkov-Salz an, das zu therapeutischen Zwecken eingesetzt wird. Das Sanatorium Klimkovice hat eine ähnliche Ausrichtung wie das Kurbad Darkov und verwendet die gleiche Art von Mineralwasser. Das Mineralwasser wird aus 11 km entfernten Bohrlöchern in der Nähe des Dorfes Polanka nad Odrou entnommen, in einer Pumpstation von gelöstem Methan befreit und erst dann in ein Reservoir geleitet, von wo aus es in die Aufbereitungsanlagen abgeleitet wird.
Einen ganz anderen Charakter haben die schwefelhaltigen Thermalwässer, aus denen die Heilbäder Bludov und Velké Losiny entstanden sind. Die lokalen Thermalquellen sind das Ergebnis der schnellen Zirkulation von Wasser entlang der Spalten der Erdkruste, wenn Niederschlagswasser in große Tiefen (bis zu 1000 m) eindringt, sich erwärmt und wieder aufsteigt. Durch das Vorkommen von Mineralwässern in Schlesien und Nordmähren ist eine Kurtradition entstanden, die zwar nicht so bekannt ist wie die der westböhmischen Kurorte, aber dank der Vielfalt der einzelnen Standorte durchaus etwas zu bieten hat.
3.21 Stauseen in Schlesien
Ähnlich wie die Regulierung von Wasserläufen und die Flussschifffahrt ist auch der Bau von Stauseen eines der zentralen Themen der Wasserwirtschaft. Darüber hinaus stellen die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts errichteten Wasserwerke im oberen Oderbecken ein wichtiges Phänomen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts dar, weil sie durch politische Entscheidungen bedingt waren und eng mit dem Bau von Industrieanlagen und der Errichtung neuer Städte zusammenhingen. Deren Bau wurde durch das 1955 verabschiedete Wasserwirtschaftsgesetz erleichtert.
Das älteste Wasserwerk in der Region ist der Stausee Kružberk, die in den Jahren 1948-1955 gebaut wurde und Trinkwasser liefert. Da auch nach der Fertigstellung des Staudamms Wasserknappheit herrschte, wurden die Talsperre Morávka (1960-1966) und die Talsperre Šance am Fluss Ostravice (1964-1969) gebaut. Durch die Verbindung dieser Stauseen wurde das erste Wasserversorgungssystem auf dem Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei errichtet, das unter dem Namen Regionales Wasserversorgungssystem Ostrava bekannt ist und bis heute das grundlegende Produktions- und Verteilungswasserversorgungssystem für die Produktion und Versorgung mit Trinkwasser für den größten Teil der Mährisch-Schlesischen Region bildet. Neben den Talsperren und dem Wasserverteilungsnetz gehören auch die Wasseraufbereitungsanlagen in Podhradí u Vítkov (erbaut zwischen 1954 und 1962), Nová Ves bei Frýdlant nad Ostravicí (in Betrieb seit 1969) und Vyšní Lhoty (erbaut zwischen 1954 und 1963) dazu.
Der in den Jahren 1951-1958 am Fluss Lučina errichtete Stausee Žermanice mit einem 314 Meter langen und 38 Meter hohen Damm wurde für die Trinkwasserversorgung und als Hochwasserschutz entworfen. Aus den gleichen Gründen wurde der Bau der Talsperre im Těrlice am Fluss Stonávka (1955-1964) durchgeführt, deren Damm mit einem schrägen Lößdichtungskern 617 Meter lang und 25 Meter hoch ist.
Zusätzlich zu diesen Dämmen wurden in der Region mehrere kleine Stauseen angelegt. Einer davon ist Baška, gelegen am Bach Baštice bei Frýdek-Místek, erbaut in den Jahren 1958-1961. Dieser Stausee sollte den Abfluss des Flusses Ostravice regulieren, ähnlich wie der Stausee Olešná am gleichen Fluss in den Jahren 1960-1964. Aus historischer Sicht ist dies nur ein Teil der ersten Etappe des Baus von kleinen Staubecken (abgesehen davon sollten Reservoirs am Bach Bystrý in Janovice, an der Datyňka und in Krnov usw. gebaut werden). Unter anderen kleineren Stauseen der jüngeren Zeit ist vor allem der Stausee Pocheň am Bach Čižina (1973-1975) zu nennen.
Der Bau des zweiten Staudamms am Fluss Moravice wurde mit erheblicher Zeitverzögerung begonnen. Der Stausee Slezská Harta wurde in den Jahren 1987-1997 gebaut; er ist mit einer 540 m langen und 65 m hohen Staumauer ausgestattet. Noch nicht fertiggestellt, hat sie sich beim Hochwasser 1997 bewährt. Der in Vorbereitung befindliche Staudamm bei Nové Heřmínovy am Fluss Opava mit einem Volumen von 14,54 Mio. m3 und einer Staumauer von 26,5 Metern Höhe und ca. 330 Metern Länge hat mehrere Funktionen (Hochwasserschutz, Verbesserung der Strömung im Fluss Opava, Erholungsfunktionen).
Unter den Fachleuten, die sich theoretisch mit verschiedenen Aspekten der Wasserwerke in Schlesien und Ostrava beschäftigten, sind der Chemiker Rudolf Jirkovský (1902-1989), der Ingenieur František Jermář (1891-1971) und vor allem der Wasserbauingenieur Jan Čermák (1903-1989), eine führende Persönlichkeit beim Bau der Talsperren Žermanice, zu nennen.
3.22 Industrielle und post-industrielle Landschaft
Entwicklung der Vorgebirgs- und Berggebiete der Beskiden (Abwanderung oder Pendeln eines Teiles der Bevölkerung zur Arbeit,Die Industrielandschaft ist ein Phänomen, das im direkten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert entstanden ist. Obwohl die wirtschaftliche Tätigkeit bereits in den vorangegangenen Jahrhunderten die Gestalt der Landschaft stark beeinflusste (z.B. der mittelalterliche und frühneuzeitliche Erzbergbau in eher verheerender Weise), war dieser Einfluss bis zum Aufkommen der Industriegesellschaft lokal deutlich begrenzt. Erst im 19. Jahrhundert wurde die Landschaft durch einen Komplex grundlegender technologischer, energetischer, produktionstechnischer und sozialer Veränderungen einem bis dahin nie dagewesenen menschlichen Druck ausgesetzt.
Die Industrielandschaft kann man sich nicht als homogene Landschaft vorstellen, sondern im Gegenteil: Da der Prozess nicht flächendeckend, sondern sehr diversifiziert mit der Existenz von Industrialisierungsinseln unterschiedlichen Typs ablief, waren die Auswirkungen auf die Landschaft differenziert. Diese Tatsache lässt sich im Bereich Teschen sehr schön demonstrieren. Der Industrialisierungsprozess, der in der Region Těšín seit dem Ende des 18. Jahrhunderts auf der Grundlage der traditionellen Eisen- und Lederindustrie zu beobachten ist, begann nach den Napoleonischen Kriegen an Dynamik zu gewinnen. Sie basierte, wie in vielen anderen Regionen auch, vor allem auf der Umwandlung der traditionellen Textilproduktion in eine moderne Textilindustrie (Bílsko, Frýdek), sowie auf der massiven Entwicklung der Eisenindustrie (Ustroň, Baška, Třinec, Lískovec), dem Aufkommen des Kohlebergbaus im westlichen Těšín und der Entstehung einer modernen Lebensmittelindustrie (anfangs vor allem auf dem Gut des Grafen Jindřich Larisch-Mönnich). So entwickelte sich die Region Těšín nicht zu einem homogenen Wirtschaftsraum, sondern wurde durch mehrere Industrialisierungszentren repräsentiert, die oft einen unterschiedlichen Charakter hatten. Im Laufe des 19. Jahrhunderts bildeten sich allmählich vier grundlegende Industriezentren von Těšín heraus. Vor allem war es Bílsko und Umgebung, wo die traditionelle Gerbereiindustrie in eine moderne Wollindustrie umgewandelt wurde. Dieses relativ homogene Zentrum der Wollindustrie dominierte eindeutig die Struktur der Těšíner Industrie bis zur Wirtschaftskrise in den 1870er Jahren. Im 19. Jahrhundert entstand im westlichen Teschen zwischen Ostrava in Polen und Karviná eine Industrieregion, die auf der Ausbeutung von Kohlevorkommen und der damit verbundenen Koks- und Chemieindustrie basierte. Das dritte Zentrum war Frýdek und Umgebung, wo die wichtigsten Industriezweige die Textilproduktion mit Schwerpunkt auf Leinen- und Baumwollstoffen sowie die Eisenverhüttung waren, die sich in Betrieben in Baška und Lískovec konzentrierte. Relativ homogen war das letzte der Industriezentren der Region Těšín - das auf Metallurgie und Metallverarbeitung ausgerichtete Gebiet von Třinec und Ustron. An der Wende zum 20. Jahrhundert hat der Erz- und Kohlebergbau die entwickelte Textilindustrie in der Region Těšín in den Schatten gestellt. Die genannten Industriezentren beeinflussten in der Folge sowohl ihr unmittelbares landwirtschaftliches Hinterland als auch die vielschichtige Erholungsbau, massiver Holzeinschlag und die Notwendigkeit der Waldverjüngung, die Auswirkungen industrieller Emissionen auf Waldbestände usw.).
Die bedeutendsten direkten Eingriffe in die Landschaft fanden in den Gebieten der Mineralienausbeutung und der entwickelten Schwerindustrie statt. Hier kam es im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts meist zu deutlichen Landschaftsveränderungen, die spätere großflächige Rekultivierungseingriffe erforderten (in den böhmischen Ländern, Kladno, Ostrava, Karviná, im nordböhmischen Braunkohlerevier). In den Abbaugebieten sind großflächige geomorphologische Veränderungen eingetreten (Haldenbildung, Senkungen durch Unterspülung, Bildung von gefluteten Senkungsbecken), der Bergbau hat sich auf die Qualität der Wasserversorgung und den Zustand der Luft ausgewirkt. Die vor 1945 beobachteten Trends in der Landschaftsentwicklung haben sich in den folgenden Jahrzehnten deutlich verstärkt. Im Gegensatz dazu hat die Entwicklung der modernen Konsumgüterindustrie einen viel weniger zerstörerischen Einfluss auf die Landschaft gehabt.

Nach 1989 begann sich ein widersprüchlicher Prozess - die Deindustrialisierung - recht schnell in die Landschaft einzuprägen. Deindustrialisierung bedeutet einen Rückgang der Produktion im sekundären Sektor, einen Verlust von Arbeitsplätzen und einen Rückgang der industriellen Beschäftigung. Sie geht aber auch mit demografischen Veränderungen (geringere Geburtenraten, Alterung der Bevölkerung) und Veränderungen in der Siedlungsstruktur (Suburbanisierung) einher. Die Deindustrialisierung begann sich in den am weitesten entwickelten Ländern der Welt bereits in den 1970er Jahren zu manifestieren und betraf vor allem Städte mit einer Konzentration von traditionellen Industrien. Dieser Trend traf die Tschechische Republik nach 1989 und war in alten, auf Schwerindustrie ausgerichteten Industriegebieten sehr ausgeprägt. In der Landschaft manifestiert sich der Prozess der Deindustrialisierung auf vielfältige Weise, vor allem in der dramatischen Zunahme von verlassenen, bewachsenen Flächen und dem Vorhandensein von Brachflächen, d.h. ungenutzten oder gering genutzten Resten menschlicher Wirtschaftstätigkeit. In der Regel befinden sich diese Standorte (verlassene Fabrikgebäude, Hallen, ungenutzte Verkehrsgebäude, Verwaltungsgebäude und damit zusammenhängende Flächen) in der Nähe von Siedlungen (im Zentrum oder am Rand, ausnahmsweise auch außerhalb), haben eine größere Fläche (in der Tschechischen Republik wurden systematisch Standorte mit einer Größe von 2 ha und mehr registriert) und sind in hohem Maße Träger von ökologischen Belastungen. Orte mit einer sehr hohen Konzentration ökologischer Belastungen, wie z.B. die berüchtigten Ostrauer Lagunen, werden oft als Blackfields bezeichnet. Derzeit gibt es Bestrebungen, verlassene und ökologisch markierte Flächen effektiv zurück zu gewinnen und wieder zu nutzen.
3.23 Industrielandschaft - Modellbeispiel Vítkovice
Vítkovice entwickelte sich seit seiner Gründung im 14. Jahrhundert viele Jahrhunderte lang als ein kleines Dorf der Herrschaft Hukvaldy, die den Bischöfen von Olomouc gehörte. Ende des 18. Jahrhunderts lebten nach Angaben des Topographen Franz Joseph Schwoy 157 Einwohner in 23 Häusern. Noch interessanter ist, dass von hier in den späten 1820er Jahren ein entscheidender Impuls ausging, der nicht nur das hiesige Dorf, sondern die gesamte Region nachhaltig veränderte. Im Jahr 1828 gründete der Besitzer des Gutes, der Olmützer Erzbischof Rudolf Habsburg, das erste moderne Eisenwerk in der Habsburger Monarchie.
Erst die wachsende Eisenhütte, die 1843 von Salomon Mayer Rothschild gekauft wurde, verursachte einen großen Zustrom von Einwohnern und eine dauerhafte Veränderung des Charakters von Vítkovice. Vor allem ab den späten 1870er Jahren entwickelte sich das Unternehmen rasant unter der Führung der hervorragenden Manager Paul Kupelwieser und später Adolf Sonnenschein, denen neben dem wirtschaftlichen Aufschwung des Unternehmens auch die Umsetzung sozialer Programme wichtig war, darunter den groß angelegten Wohnungsbau (das sog. Neue Vitkovice-Projekt). Gab es Ende der 1860er Jahre bereits weniger als 1.700 Einwohner in Vítkovice, so war es an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ein großes Dorf mit fast 20.000 Menschen. Vor dem Ersten Weltkrieg war Vítkovice, das 1908 zur Stadt erhoben wurde, die fünftgrößte Gemeinde in Mähren. Nicht nur die meisten Einheimischen und viele aus der weiteren mährischen und schlesischen Umgebung, sondern auch eine große Zahl von Zuwanderern aus Galizien, Ungarn und dem Balkan fanden in der Eisenhütte Arbeit. Der Zustrom von Einwohnern motivierte die Leitung der Vítkovicer Bergbau- und Hüttengesellschaft zum Bau von Arbeiterkolonien, Beamtenhäusern und zum Ausbau der städtischen Einrichtungen, so dass hier an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine ganze neue Fabrikstadt entstand. Das Eisenwerk wuchs bis zum Ersten Weltkrieg auf mehr als 510 ha an, was bedeutet, dass es die eigentliche Katasterfläche von Vítkovice (436 ha im Jahr 1900) deutlich übertraf.
Die Witkowitzer Eisenwerke vertiefte ihre Bedeutung im turbulenten 20. Jahrhundert. Zunächst bewiesen sie ihre Unentbehrlichkeit während der beiden Weltkriege als wichtiger Lieferant von Militärmaterial für die österreichisch-ungarische und später auch für die deutsche Armee, dann wurden sie nach 1948 zu einer Säule der sozialistischen Industrialisierung bei der Umsetzung des sog. Stahlkonzepts der tschechoslowakischen Wirtschaft. Die enorme Betonung der wirtschaftlichen Funktion führte dazu, dass Vítkovice innerhalb weniger Jahrzehnte buchstäblich zu einer Stahlstadt wurde. Die Landschaft von Vítkovice verwandelte sich schnell in einen komplett urbanisierten Komplex, überwuchert von Industrieanlagen, Bergwerken und Steinbrüchen. Luftaufnahmen aus der ersten Hälfte der 1960er Jahre zeigen, dass 80 % des Katastergebiets mit Wohn- und Industriebauten verbaut waren, nur in den Außenbezirken waren noch Reste der landwirtschaftliche Tätigkeit in Form eines typischen Mosaiks aus Feldern und Wiesen, das jedoch in den folgenden Jahrzehnten vollständig verschwand.
Vítkovice ist bis heute ein Beispiel für eine Fabrikstadt, in der ein dominanter Industriebetrieb die räumliche Form der Siedlung und das Leben dort grundlegend beeinflusste. Noch heute ist sie teilweise ein lebendiger Organismus, und ihr historischer Kern mit seiner typischen Fachwerkarchitektur wurde 2003 zum städtischen Naturschutzgebiet erklärt. Ein bedeutender Teil des Industriekomplexes des sog. Dolní oblast Vítkovice (der Komplex der Grube Hlubina, der Kokerei, der Hochöfen und der zusammenhängenden Betriebe) blieb nach dem Ende der primären metallurgischen Produktion erhalten und wurde zu einem bedeutenden kulturellen und gesellschaftlichen Zentrum. Im Jahr 2002 wurde der Komplex zum nationalen Kulturdenkmal erklärt und im Jahr 2008 erhielt er den Status eines europäischen Kulturerbes.
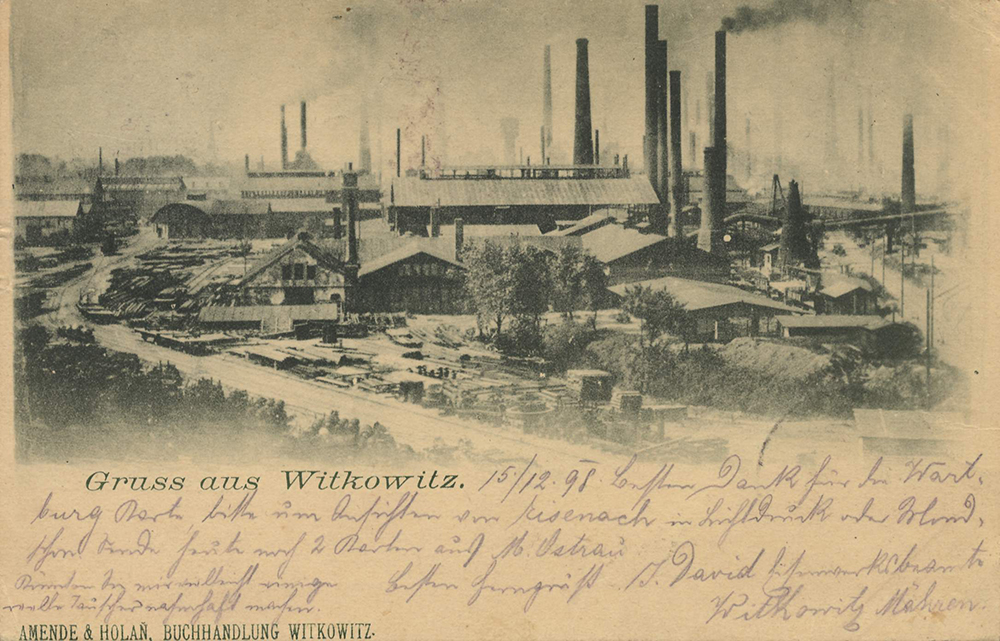


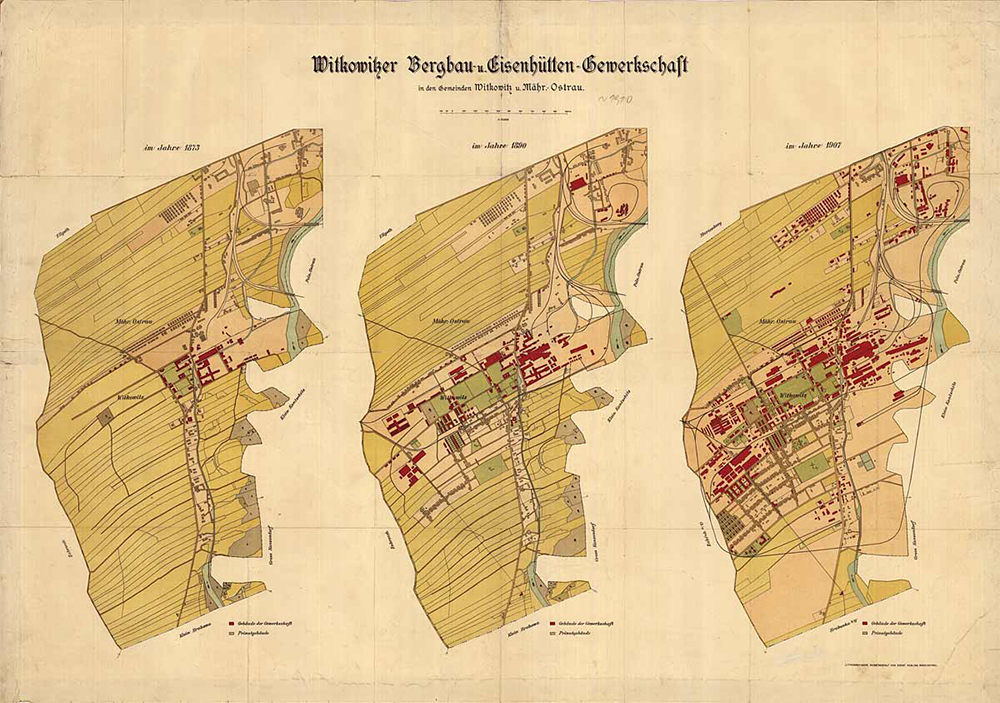
3.24 Steinabbau
Die große Vielfalt der Gesteine im geologischen Aufbau Schlesiens und Nordmährens hat zu einem beachtlichen Mineralreichtum geführt. Das älteste Material, das in der Vergangenheit ausgebeutet wurde, ist Naturstein. In der Vergangenheit war die Region Schlesien vor allem für den Abbau und die Verarbeitung von Granit und Marmor bekannt.
Das ausgedehnte Granitmassiv diente schon im Mittelalter als Quelle für Baumaterial, was man noch heute an den ältesten weltlichen und religiösen Gebäuden in Gesenke sehen kann. Die systematische Gewinnung des hiesigen Gesteins begann jedoch erst im 19. Jahrhundert; ab den 1860er Jahren kann man bereits von den Anfängen der industriellen, gewerblich organisierten Produktion von Steinprodukten sprechen. Der rationelle Umgang mit mineralischen Rohstoffen wurde von den Steinfachschulen gefördert.
Der Aufschwung des Granit- und Marmorabbaus und der -verarbeitung in den Ausläufern von Rychlebské hory, Žulovská pahorkatina und Zlatohorská vrchovina setzte sich trotz des Rückgangs der Steinproduktion während der wirtschaftlichen Turbulenzen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts und trotz des weiteren Rückgangs während des Zweiten Weltkrieges und des anschließenden Abzugs der Steinhandwerker beim Abzug der Deutschen aus Gesenke fort. Nach dem Zweiten Weltkrieg erreichte die Steinproduktion nicht mehr den Umfang und die Qualität der Vorkriegszeit. Die künstlerische Produktion wurde völlig vernachlässigt und die Herstellung von Pflastersteinen und anderen Baumaterialien erhielt den Vorzug. Auch wenn Granit und Marmor in der Jesenice-Region heute nur noch in sehr geringem Umfang abgebaut werden, ist die Tradition des Bergbaus und der Steinverarbeitung für die Region auch heute noch von großer Bedeutung.
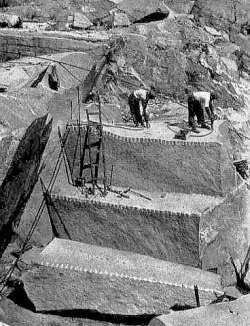
Im Niederen Gesenke und im Odergebirge gibt es eine reiche Geschichte der Schiefergewinnung und -verarbeitung. Große Lagerstätten aus dem Unterkarbon liefern noch immer hochwertige Dachschiefer, die für Dachreparaturen an historischen Gebäuden, aber vor allem als Ziegel und Pflaster verwendet werden. Die Gewinnung von Dachschiefer hat die Gesamtentwicklung dieser industriell rückständigen Region entscheidend geprägt. Die Bergbautätigkeit hinterließ in der Region des Niederen Gesenkes zahlreiche sichtbare Zeugnisse der Schiefergewinnung und -verarbeitung, und mit der Zeit wurden die Gruben- und Steinbruchstandorte zu attraktiven Orten für Tourismus und Erholung. Neben dem dominierenden Abbau und der Verarbeitung von Granit, Marmor und Schiefer wurden in Tschechisch-Schlesien auch andere Mineralien abgebaut. In der Vergangenheit erlangten der Abbau und die Verarbeitung von Kalkstein vor allem in der Region Jeseniky eine große wirtschaftliche Bedeutung. Die ersten Hinweise auf das Kalkbrennen stammen vom Ende des 15. Jahrhunderts. Der technologische Wandel in der Kalkproduktion, der durch den Übergang von kleinen Feldöfen zu Schachtöfen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gekennzeichnet war, katapultierte Gesenke in die Position eines führenden Kalkproduzenten.

In addition to the dominant mining and processing of granite, marble and shale, other minerals were also mined in Czech Silesia. In the past, the mining and processing of limestone in the Jeseníky region became quite economically important. We have the first mention of lime burning from the end of the 15th century. The technological change in lime production, which meant the transition from small field kilns to shaft kilns in the first half of the 19th century, catapulted Jeseníky to a leading lime producer.
Im Opava-Becken befindet sich die bedeutendste und einzige abgebaute Gipslagerstätte in der Tschechischen Republik. Die erste Gipsgrube wurde 1849 in Opava eröffnet, danach folgte die Eröffnung eines Tagebaus in Kateřinky. Die Lagerstätte in der Nähe von Kobeřice wurde 1963 eröffnet und wird noch heute abgebaut.
In Schlesien gibt es reiche Vorkommen an Sanden, Kiesen und Kiessanden, die zu den wichtigsten Rohstoffen für die Baustoffindustrie gehören. Kleine Sandgruben gibt es schon seit dem frühen Mittelalter, größere Sandseen tauchten erst in der sozialistischen Zeit in der Landschaft auf, während der Kiesabbau in den 1980er Jahren seinen Höhepunkt erreichte, vor allem im Zusammenhang mit dem Bau von Großwohnsiedlungen. Die Rohstoffquellen für die Ziegelherstellung sind hauptsächlich Ablagerungen von Löss und Lösslehm aus dem Quartär. Der Hauptzweck der Tonerden war die Bereitstellung von ausreichend Rohmaterial für die Produktion von Ziegeln und anderen Bauelementen sowie ausnahmsweise auch für die Herstellung von Keramiken. In der Nähe von Vidnava im Žulovská-Gebirge wurden Kaolinvorkommen abgebaut, die in der Vergangenheit vor allem zur Herstellung von Schamotte genutzt wurden. Heute ist das Gelände einer der schönsten Steinbrüche in Gesenke.
Seit 1990 hat die Tschechische Republik die Förderung von Mineralien, Erzen und Uran deutlich reduziert. Auf der anderen Seite hat die Förderung einiger Mineralien zugenommen, vor allem durch Exporte und einen Anstieg des Bauvolumens. Der Abbau von Mineralien veränderte und verändert das Gesicht der Region, die sozialen Bedingungen und die Qualität der Umwelt in der Region.
3.25 Erzabbau
Seit der Antike interessiert sich der Mensch für die Nutzung von Rohstoffen, die er zunächst an der Oberfläche fand, später konzentrierte sich sein Interesse auf den Untergrund. Die Ursprünge der Suche nach Erzvorkommen und deren Abbau reichen weit in die Vergangenheit zurück. Erzgebiete in Schlesien waren bereits im Mittelalter bekannt. Die Ära des Erzbergbaus war die längste in unserer Region, allerdings wurde der Erzbergbau, was die Menge der geförderten Masse angeht, von der Kohle- und Mineralförderung in den Schatten gestellt. Im 20. Jahrhundert erlebte der Erzbergbau in Schlesien einen Aufschwung, doch gegen Ende des Jahrhunderts wurde der Abbau eingestellt. Der nördliche Teil der mährisch-schlesischen Region ist reich an polymetallischen Erzlagerstätten, die in der Vergangenheit von großer Bedeutung waren. Direkt in Schlesien befinden sich zwei historisch bedeutsame Erzlagerstätten, die zu den größten im Böhmischen Massiv gehören. Dies sind die Goldlagerstätte Złoty Stok in Polen (ehemals Rychleby) nahe der Grenze zur Tschechischen Republik und der Zlatohorský- Erzbezirk mit polymetallischen Erzen (einschließlich Gold) in der Nähe von Zuckmantel.
Eine weitere bedeutende polymetallische Lagerstätte im Niederen Gesenke war Horní Benešov. Zahlreiche kleine Vorkommen von polymetallischen Erzen liegen auch im südöstlichen Teil des Niederen Jeseník, vor allem im Odergebirge. Interessant ist die Lagerstätte Nová Ves bei Rýmařov; die Überreste des historischen und rezenten Bergbaus sind im Gelände deutlich sichtbar. Mineralien von Kupfererzlagerstätten sind zum Beispiel aus Ludvíkovo bei Vrbno pod Pradědem bekannt.
Zu den reichsten mineralogischen Lokalitäten in Schlesien gehören die Uranlagerstätten Zálesí und Horní Hoštice bei Javorník oder Bílá Voda im Gebirge Rychlebské hory. Die Lagerstätte in Zálesí u Javorníka wurde bei Schürfungen im Jahr 1957 gefunden, und in den Jahren 1959-1968 wurden hier Uranerze abgebaut. Die Eisenerzvorkommen setzen sich von Mähren bis nach Schlesien fort, vor allem in der Umgebung von Mala Morávka und Dolní Údolí bei Zuckmantel, sowie in der Nähe von Horní Benešov. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden an einigen Stellen in den Mährisch-Schlesischen Beskiden Eisenkonkretionen abgebaut, die als Quelle für Eisenerz dienten und somit die historische Rohstoffbasis für die Hüttenindustrie in Schlesien, insbesondere in der weiteren Umgebung von Třinec, bildeten.
In der Nähe von Zuckmantel wurde im Tal des Flusses Olešnice mit dem Lehrpfad Tal der verlorenen Stollen eine Nachbildung mittelalterlicher Bergbaumühlen errichtet. In der Mühle wird den Touristen die Zerkleinerung des Golderzes gezeigt. Die beiden hölzernen Maschinen, die nach historischen Zeichnungen gefertigt wurden, werden von Wasserrädern angetrieben, die ihre Energie aus dem ursprünglichen Kanal beziehen. Die hügelige Beschaffenheit des Tals und die Position der Wasserräder in einer Kaskade senkrecht zum Hang schaffen eine malerische Kulisse. In der Region Jeseníky gibt es einige weitere sehr interessante Lehrpfade, die den Besuchern die Bergbautätigkeit näher bringen, die die Landschaft so stark geprägt hat. Einer der interessantesten Orte ist Příčný vrch mit seiner reichen Bergbaugeschichte.

Aufgrund des Ausmaßes der Bergbautätigkeit in den Erzfeldern sind diese Bereiche unterhöhlt und der Untergrund verbirgt hier eine außerordentliche Anzahl von Gängen und ausgebauten Bereichen, d.h. erhebliche unnatürliche Störungen im Gesteinsmassiv, die zum Einsturz von Decken und zum Einsturz des Deckgebirges führen können. Die wohl sichtbarste Spur des Erzbergbaus in der Umgebung von Zuckmantel, ist die als Kulturdenkmal gesetzlich geschützte Žebračka-Senke. In den Wänden des Abgrunds befinden sich Überreste der alten Stollen, mit denen die Bergbausohle rund um die Kammer erschlossen wurde.
3.26 Steinkohlenbergbau
Der spezifische und sehr wichtige Rohstoff des östlichen Teils von Schlesien und Nordmähren ist zweifelsohne die Steinkohle. Bei archäologischen Ausgrabungen auf dem Hügel Landek in Ostrava-Petřkovice wurden Beweise für die Kohleverbrennung gefunden, die etwa 21 Tausend Jahre alt sind. Es ist nicht klar, ob dies eine absichtliche oder nur eine versehentliche Verwendung von Steinkohle war. Der mährisch-schlesische Teil des oberschlesischen Kohlebeckens, das sogenannte Ostrava-Karviná-Revier, ist das Hauptkohleabbaugebiet in der Tschechischen Republik. Weiter südlich liegt das Kohlebecken Podbeskydská, das von den Beskiden bedeckt ist. Der Kohleabbau war in der Vergangenheit von großer wirtschaftlicher Bedeutung, wurde aber in den 1990er Jahren schrittweise reduziert und schließlich ganz eingestellt. Braunkohle wurde in kleinerem Umfang auch in Schlesien, in der Nähe des Dorfes Uhelná in der Region Jeseniky abgebaut. Dieser Tagebau ist heute geflutet und wird zu Erholungszwecken genutzt.
Die größte Ausdehnung des Bezirks Ostrava-Karviná erfolgte nach 1945, als der Abbau von Kohle und anderer Rohstoffe infolge der Ausrichtung der tschechoslowakischen Wirtschaft auf den Aufbau der Schwerindustrie bevorzugt wurde. Im Zusammenhang mit dem Bau neuer Bergwerke und dem Wiederaufbau und der Modernisierung bestehender Bergwerke stiegen die Kohleförderung, die Koksproduktion und die Zahl der Arbeiter im Vergleich zur Vorkriegszeit um ein Vielfaches. Es folgte ein umfangreicher Wohnungsbau und die Zusammenlegung von Siedlungen zu größeren Siedlungen. Die Bergbautätigkeit wird von einer Reihe negativer Erscheinungen begleitet. Die Hauptursache für Veränderungen in der Landschaft ist die Bewegung von Massen aus dem Gesteinskörper an die Oberfläche. Das Deckgebirge stürzt dann nach dem Abbau in die Abbaugebiete ein und es entstehen Erdfälle und Senkungsmulden. Das dominierende Merkmal des Kohlereviers sind die Halden oder Abraumhalden. Sie bestehen aus Abraum, der eigentlich der Restmüll aus dem Kohleabbau ist, bestehend aus Schluffstein, Sandstein, Bröckel, Arkose, pulverisiertem Ton und Tonstein, die auch Kohlefragmente und pulverisierte Kohle enthalten. Dieser Abraum wurde in der Vergangenheit in der Nähe der Gruben gelagert, aber mit der Entwicklung der Technik begann man, ihn auf größeren Gemeinschaftsflächen in verschiedenen Formen aufzuschütten, oft in unmittelbarer Nähe von Städten (in Ostrava z. B. die Halde Ema oder die inzwischen beseitigte Halde in Černá louka). Allerdings erwiesen sich konische, kuppelförmige Halden als recht riskant (Feuer, Erdrutsche), so dass man begann, Terrassen- und Plattenhalden zu bilden. Gleichzeitig begann man, das Material aus den Halden für verschiedene Haldenabdeckungen, Rekultivierung und den Straßenbau zu verwenden, so dass viele Halden wieder verschwanden.

Der Steinkohletiefbau hat negative Veränderungen in der Landschaft verursacht. Der Einfluss der anthropogenen Aktivität hat die Morphologie des Geländes in den unterspülten Bereichen erheblich beeinflusst. Der Bezirk Ostrava-Karviná, der Teil der industriellen Agglomeration Ostrava ist, ist ein typisches Gebiet mit einer intensiven wirtschaftlichen Belastung der Landschaft. Der Tiefbau hat hier die Morphologie des Geländes und den Charakter der Bäche beeinflusst. Infolgedessen wurde die Landschaft degradiert und verwüstet, was zu Veränderungen im sozioökonomischen Bereich führte. Die Folgen des tiefen Kohleabbaus zeigten sich am deutlichsten im Karviná-Teil des Reviers, wo sich das ehemals dicht besiedelte Gebiet in eine fast völlig verwüstete Landschaft verwandelte. Hier befindet sich auch die Grube Lazy; fast 200 Jahre lang hat der tiefe Kohleabbau in Orlová-Lazy das Gelände negativ beeinflusst, insbesondere durch die Entstehung von Oberflächendeformationen und Wasserläufen durch die Veränderung der Bodenneigung aufgrund von Senkungen und der Ableitung von Abbau- und Prozesswasser. Anthropogene Veränderungen der Oberfläche haben auch sekundäre Auswirkungen auf Straßen, Versorgungseinrichtungen und Gebäude. Senkungsmulden entstehen als Folge der Absenkung eines Gebietes und werden oft durch Grundwasser oder Staunässe in der Aue überflutet. Dadurch entstehen Senkungsbecken oder Senkungsseen; die durchschnittliche Tiefe eines Senkungsbeckens beträgt 25 m. In der Region Karviná sind viele Hektar infolge von Bodensenkungen völlig überschwemmt.
3.27 Die untergrabene Landschaft
Bergbauaktivitäten prägen seit der Antike das Gesicht der Landschaft. Zunächst war es das Goldwaschen, das Spuren in der Landschaft hinterließ, vor allem in Form der sogenannten Sickerstellen (Flussablagerungen, die durch den Abbau von goldhaltigen Sanden entstanden). Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit brachte der Erzbergbau Veränderungen der Landschaft in viel größerem Umfang mit sich. Dies waren sowohl primäre als auch sekundäre Erscheinungsformen des Bergbaus. Zu den primären Manifestationen des Erzabbaus gehörten vor allem die unterschiedlichsten Geländeveränderungen und Formationen - von kleineren Schächten und Einschnitten über kleinere Senkgruben bis hin zu Gruben und Halden. Zu den sekundären Erscheinungsformen des Bergbaus gehören die Abholzung von Wäldern im Zusammenhang mit dem Bergbau selbst und insbesondere mit der Erzmetallurgie sowie die Veränderung von Wasserläufen im Zusammenhang mit dem Bau sowohl von Bergbau- als auch von Erzaufbereitungsanlagen (Stollen, Hämmer). Die Landschaft ist auch durch den Abbau von Mineralien sehr stark beeinträchtigt worden.
Wirkte der oben erwähnte Bergbau zwar recht intensiv, aber in relativ begrenztem Umfang auf die Landschaft ein und fand im Fall der Erzgewinnung allmählich über einen Zeitraum von Jahrhunderten statt, so stellte sich die Situation im Fall des Kohleabbaus anders dar. Die massive Ausbeutung der Steinkohle im Revier Ostrava-Karviná verursachte in relativ kurzer Zeit eine weitgehende Verwüstung der Landschaft, die eine massive Rekultivierung der Landschaft erforderlich machte.
Die Geschwindigkeit der Landschaftsveränderungen im Bezirk Ostrava-Karviná wurde durch drei grundlegende Faktoren bestimmt: 1. das Ausmaß des Abbaus; 2. die verwendete Abbaumethode; und 3. die Mächtigkeit der abgebauten Flöze. Was die Auswirkungen auf die Landschaft betrifft, so ist die Etablierung von ausgebauten Stollen zu einem langfristigen Problem geworden. Aufgrund der Betonung der Maximierung des Abbaus wurde während des Zweiten Weltkrieges sowie nach 1945 nur ein kleiner Teil der Gruben eingerichtet und die Methode des kontrollierten Höhlenbaus massiv angewendet. Dies führte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu großflächigen Schäden in der Landschaft, insbesondere in der Region Karviná.
Der tiefe Kohleabbau hat vor allem geomorphologische Veränderungen verursacht. In der Landschaft können wir sowohl primäre Manifestationen des Bergbaus antreffen, zu denen vor allem Halden, Senkungsbecken, Schlammteiche und Tagebaue gehören, als auch sekundäre Manifestationen, zu denen Rekultivierungsflächen oder trockene Schlammteiche gehören. Im Hinblick auf den Charakter der Landschaft des Bezirks Ostrava-Karviná waren die typischen primären Manifestationen der Bergbautätigkeit im Laufe der Industrialisierung vor allem Abraumhalden und geflutete Senkungsbecken.
Historisch gesehen waren die frühesten Halden, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts in den Bezirk eindrangen, kegelförmige Halden mit einer Höhe von bis zu 80 Metern. Die Halde Ema, deren Bau in der Nähe der Grube Petr Bezruč in den 1920er Jahren begann, ist zu einem Symbol der Bergbaulandschaft in der Region Ostrava geworden. Heute ist er ein attraktives Touristenziel, unter anderem wegen seiner ständigen thermischen Aktivität, die von Schwefeldioxidausbrüchen begleitet wird. Ab den 1950er Jahren wurden flach geformte Absetzteiche gebaut, die bessere Eigenschaften in Bezug auf Staub und zukünftige Rekultivierung hatten. Seit den späten 1970er und 1980er Jahren gibt es eine Umkehrung in der Haldenbewirtschaftung, als es sich als unhaltbar erwies, abgebautes Gestein an Dutzenden von Stellen, oft in der Nähe von Siedlungen, zu lagern. Es entstanden so genannte Zentralhalden, großflächige Abraumhalden, die in der Regel in verwüsteten Gebieten errichtet wurden, die zur Sanierung vorgesehen waren. Trotz des Rückganges der Bergbautätigkeit nach 1989 sind die Abraumhalden ein wichtiger Bestandteil des Landschaftsbildes im Bezirk Ostrava-Karviná.
Das zweite bedeutende Element der Landschaft des Kreises Ostrava-Karviná waren die überschwemmten Nachsenkbecken, die durch die Absenkung des Geländes infolge der Unterspülung entstanden. Geländebewegungen verursachen schwere Schäden an Gebäuden, Infrastruktur und Boden und können bei großflächigen Senkungen (wie in der Region Karviná) zu einer großflächigen Verwüstung des Gebietes führen. Sehr oft wird das abgesunkene Gelände überflutet und es bildet sich ein überflutetes Senkbecken. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden einige Senkbecken für die Ablagerung von Flotationsrückständen, Kohleschlämmen oder Kraftwerksaschen genutzt, während andere nach und nach für Erholungszwecke zurückgebaut werden. Die spezifische primäre Manifestation des Tiefkohlebergbaus stellen die Schlammbecken dar, die in der Region Ostrava-Karviná erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Derzeit werden die Becken nach und nach abgebaut, zurückgewonnen und in die umliegende Landschaft integriert. Dadurch entsteht eine spezifische Umgebung aus Feuchtgebieten und Wasserflächen, sehr oft in den Bereichen der ursprünglichen Teiche. Aus biologischer Sicht schafft dies eine sehr wertvolle Umgebung.
3.28 Untergrabene Landschaft - Rekultivierung
Das Hauptziel der Rekultivierung ist es, die unerwünschten Spuren menschlicher Wirtschaftstätigkeit zu beseitigen, die die bestehende Landschaft und die Möglichkeit ihrer Nutzung zunehmend gestört hat. Bei der Rekultivierung versuchen Experten, nicht nur aus biologischer Sicht, ein gut funktionierendes Landschaftssystem wiederherzustellen - es ist auch wichtig, die Landschaft in ihrer sozialen Funktion wiederherzustellen.
Grundlage dieser Rekultivierungen ist die so genannte technische Rekultivierung (Sanierung), die auf dem Denken der 1950er und 1960er Jahre beruht, als der Glaube vorherrschte, dass jedes Stück Land in irgendeiner Weise genutzt werden muss. Ziel der technischen Rekultivierung ist es, neues Terrain zu modellieren, um "Narben" zu überdecken, Steinbruchgruben abzudecken oder aufzufüllen und das Gebiet für die Bepflanzung vorzubereiten - also biologische Rekultivierung. Bei der Begrünung von großen Kohleabbaustätten werden riesige Mengen an Abraum oder Abraumhalden bewegt. Bei Wandsteinbrüchen werden durch technische Modifikationen die felsigen Bereiche der Stollen entfernt und zugeschüttet und die senkrechten Wände werden zu einem sanften Gefälle modifiziert, eine Praxis, die zwar den Sicherheitsvorschriften entspricht, aber einzigartige Lebensräume vollständig zerstört. In vielen Fällen werden Baugruben aus wirtschaftlichen Gründen mit Bodenaushub, Bauschutt, Nebenprodukten der Energiewirtschaft und Klärschlamm belastet. Der Hauptnachteil einer solchen technischen Rekultivierung ist die Verringerung der morphologischen Vielfalt des Geländes und die Zerstörung wertvoller Biotope, die in geeigneten Teilen des Geländes entstanden sind. Die technische Rekultivierung ist in der Regel überdimensioniert und daher sehr kostspielig.
Die geeignetsten Alternativen sind die so genannten naturnahen Wiederherstellungsmethoden, die vor allem auf der Nutzung der ökologischen Sukzession basieren. Das Hauptziel einer solchen Wiederherstellung und Sanierung ist der unmittelbare Schutz von gefährdeten oder besonders geschützten Arten wildlebender Pflanzen und Tiere. Die natürliche Rekultivierung wurde hierzulande vor allem in den letzten Jahren angewandt. Die Steinbrüche werden bereits während des Abbaus in den Soll-Zustand gebracht; das Ideal ist, die natürliche Sukzession ablaufen zu lassen und nur durch äußere Eingriffe zu regulieren.
In den böhmischen Ländern begannen die Rekultivierungsmaßnahmen bereits vor dem Ersten Weltkrieg in Nordböhmen in den vom Braunkohletagebau verwüsteten Gebieten. Im Bezirk Ostrava-Karviná wurden zunächst Sanierungsmaßnahmen diskutiert, um die Qualität der örtlichen Gewässer zu sichern. Bereits in den 1920er Jahren wurde eine Reihe von Projekten realisiert, die der späteren Sanierung der bergbaugeschädigten Landschaft zum Teil recht nahe kamen. Es handelte sich dabei um verschiedene Modifikationen von Wasserläufen und die Auffüllung von Sumpfgebieten in der Agglomeration Ostrava, die sich die Menge an Abraum zunutze machten, die die Landschaft von Ostrava übersäte. Anfang der 1950er Jahre, wurde im Zusammenhang mit dem enormen Anstieg des Bergbaus und den damit verbundenen Bergschäden, zum ersten Mal ein umfassender Sanierungsplan für das Kohlerevier ausgearbeitet. Ab 1956 hat dann die eigentliche Sanierung und Rekultivierung, auch wenn für ziemlich lange Zeit nur in einem kleinen Maßstab, begonnen. Die Zunahme der Rekultivierungsanstrengungen ist vor allem seit den späten 1970er und 1980er Jahren zu beobachten, als die Bewirtschaftung der Abraumhalden erheblich rationalisiert wurde. In der Zeit vom Ende der 1970er bis Anfang der 1990er Jahre wurden großflächige Rekultivierungen durchgeführt, wobei nach und nach ganze Bergbaugebiete in verschiedenen Teilen des Bezirks Ostrava-Karviná rekultiviert wurden (z. B. die Grube Jan Šverma in Ostrava-Mariánské Hory, die Grube Julius Fučík in Petřvald, die Grube Dukla in Havířov).

Im Zusammenhang mit den politischen und wirtschaftlichen Veränderungen der späten 1980er Jahre wurden die Rekultivierungsarbeiten nicht mehr aus dem Staatshaushalt bezahlt und die Milderung der Folgen der Bergbautätigkeit wurde den einzelnen Bergbaubetrieben übertragen. Angesichts der wirtschaftlichen Bedingungen wurde bis 1997 die konventionelle Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen, die vor 1989 eines der Hauptziele war, vollständig aufgegeben. Das Nachfolgeunternehmen die Aktiengesellschaft OKD Rekultivierungen musste seine Aktivitäten an die radikalen Veränderungen im Bergbausektor anpassen. In den letzten zwanzig Jahren hat sie vor allem Sanierungs- und Rekultivierungsarbeiten für Bergwerke in der Region Karviná (z. B. Rekultivierung des Darkov-Gebietes) durchgeführt und sich an der Beseitigung alter Umweltbelastungen beteiligt (z. B. Sanierung der ehemaligen Kokerei Karolina im Zentrum von Ostrava).
3.29 Verkehrsentwicklung - Straßennetz
Seit dem 18. Jahrhundert begann sich die mitteleuropäische Landschaft, auch durch den Bau von neuen Verkehrsadern, langsam zu verändern. Bereits im 18. Jahrhundert konnte man (nicht nur) in der Habsburgermonarchie die erste Welle der Modernisierung des Verkehrs beobachten, die durch den Versuch gekennzeichnet war, systematisch Wasserstraßen und hochwertige Steinstraßen zu bauen. Die Modernisierung des Straßenverkehrs im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist also mit dem Bau von Steinstraßen - der sogenannten Chaussée - verbunden.
Aus welchen Gründen baute der aufklärerisch-absolutistische Staat eine teure Verkehrsinfrastruktur? Als Hauptgrund für den Bau von Staatsstraßen wurde die Förderung des überregionalen Verkehrs genannt, was den merkantilistischen Grundsätzen der damaligen Zeit entsprach. Der militärisch-strategische Grund war sehr stark. In vielen Fällen wurden neue Straßen zu einem Mittel zur Stärkung der territorialen Integrität der staatlichen Einheit und spielten eine wichtige Rolle bei der Fixierung peripherer oder neu erworbener Gebiete. Diese Eigenschaft zeigt sich zum Beispiel im Straßenbau in der mährisch-schlesischen Region. Sie wurde nach den Schlesischen Kriegen durch die Sicherung des Gebietes des österreichischen Schlesiens und später auch des neu erworbenen Galizien motiviert.
Die Straßenbauten des 18. und 19. Jahrhunderts unterschieden sich in ihrem Charakter und ihrer Ausrichtung erheblich von den älteren Straßentypen, die sich weitestgehend dem Gelände anpassten und keine feste Oberfläche hatten. Die neuen "kaiserlichen" Straßen mussten einen möglichst geraden Verlauf nehmen, was die Erschließung neuer Grundstücke und manchmal sogar Rechtsstreitigkeiten mit Grundbesitzern zur Folge hatte. Sie wurden mit Entwässerungssystemen und zum Schutz vor Schneeverwehungen und Wind mit Alleen von Nutzbäumen versehen. Ihre Oberfläche hatte eine gewölbte Form, um das Regenwasser abzuleiten, und eine Steinbasis mit einer Schotterschicht, um eine gute Befahrbarkeit zu gewährleisten.
Eine Vorstellung davon, inwieweit diese äußerst anspruchsvollen Bauten ihrer Zeit die Landschaft beeinflussten, können wir zum Beispiel dank der erhaltenen einzigartigen Manuskriptkarten bekommen, die in den 1870er Jahren im Zusammenhang mit dem Bau der schlesisch-galizischen Straße von Opava nach Těšín und Bílsko angefertigt wurden. Die Spuren dieser Prachtbauten sind noch heute in der Landschaft zu finden, obwohl sie in späteren Jahrhunderten modernisiert, erweitert und mit neuen Flächen überbaut wurden. Ein Beispiel ist die ursprüngliche Strecke der schlesisch-galizischen Straße, die bis 2015 von Opava nach Ostrava entlang der ursprünglichen Reichsstraße verlief.

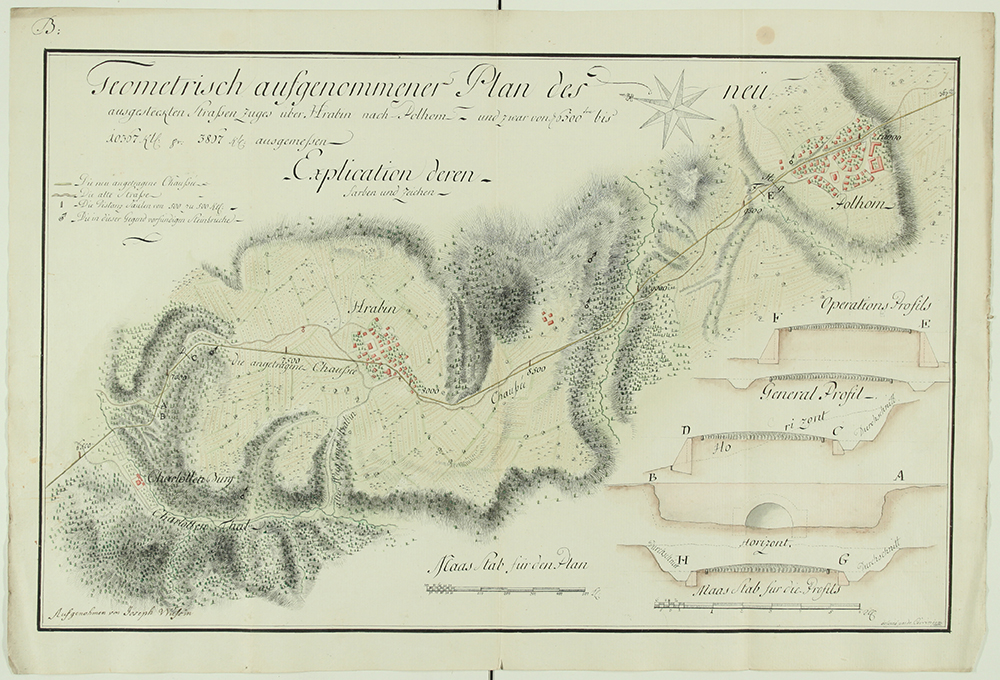
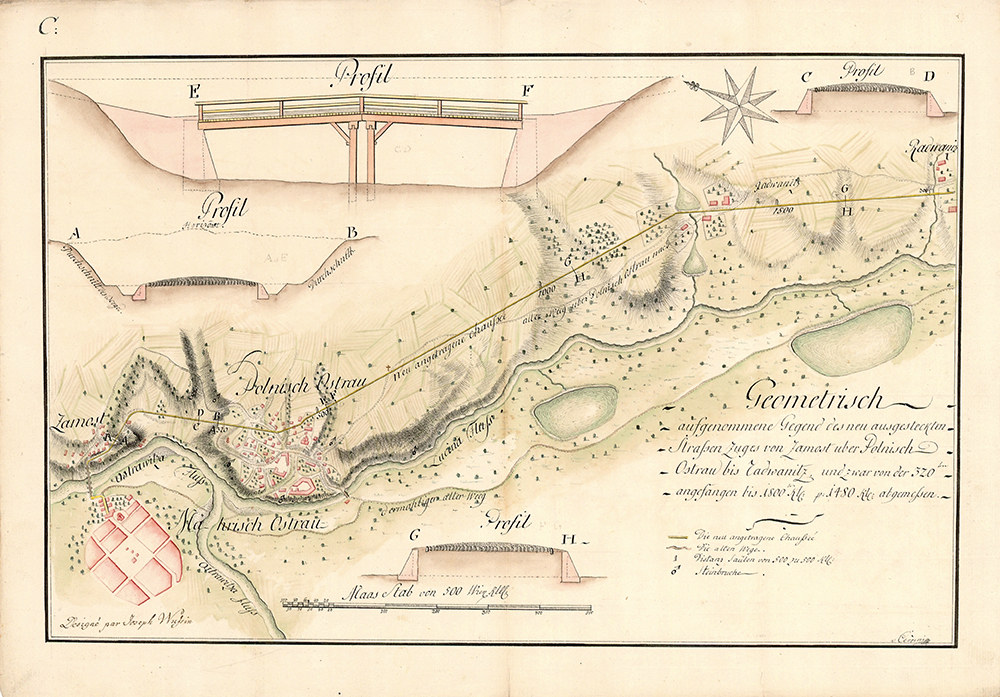
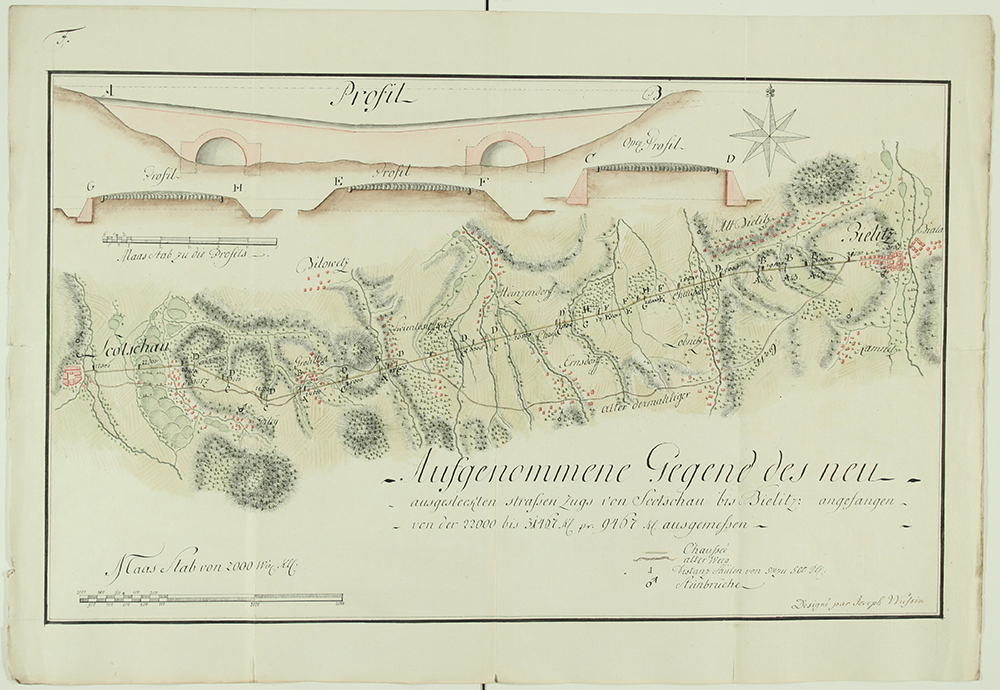
3.30 Verkehrsentwicklung - Eisenbahnen
Seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts haben die böhmischen Länder bedeutende Veränderungen in Bezug auf die Entwicklung der Verkehrssysteme durchgemacht. Das Rückgrat des überregionalen Handels waren die bis dahin wenigen staatlich gebauten und unterhaltenen "Reichsstraßen". Im Fall geeigneter natürlicher Bedingungen hätten die schiffbaren Abflüsse wichtiger Flüsse eine ähnliche Rolle spielen können, was im Untersuchungsgebiet nicht der Fall war. Doch ab Anfang der 1830er Jahre begann sich ein neues Verkehrssystem - die Eisenbahn - in ganz Mitteleuropa rasch durchzusetzen. Es waren die Eisenbahnen, die den Charakter der schlesischen Landschaft im Laufe des 19. Jahrhunderts maßgeblich beeinflussten, und dieser Einfluss hält bis heute an.
Die Eisenbahn, die in vielerlei Hinsicht zum Inbegriff des Industriezeitalters wurde, hat auch in wirtschaftlicher Hinsicht wesentlich zur Prägung der Landschaft beigetragen. Diese großen linearen Konstruktionen waren vor allem ein bedeutender geomorphologischer Eingriff. Die Bahn musste in einer möglichst geraden Linie und ohne nennenswerte Steigungen gebaut werden, was zwangsläufig den Bau einer Reihe neuer Brücken (oder Viadukte), Einschnitte und Tunnel bedeutete und im Allgemeinen umfangreiche Eingriffe in das umliegende Gelände erforderte. Ein gutes Beispiel dafür, wie anspruchsvoll diese Bauten waren, ist der Fall der Mährisch-Schlesischen Zentralbahn (Olomouc - Krnov - Opava; Krnov - Jindřichov in Schlesien), wo auf der 115 km langen Strecke fünf Tunnel mit einer Gesamtlänge von 744 m gebaut werden mussten, und allein zwischen Hlubočky und Domašov musste die Bahn 22 Mal den Fluss Bystřice überqueren. Auch der Bau einiger Bahnen in der Region Jeseniky und Těšín war recht anspruchsvoll. Generell lässt sich feststellen, dass im Bezug auf die Auswirkungen auf die Landschaft der Bau von Hauptstrecken der größte Eingriff war, während Lokalbahnen oft gebaut wurden, um Geld zu sparen und die Bahn so weit wie möglich an die Landschaft anzupassen. Ein Beispiel für das Bemühen, die Bahn so weit wie möglich an das Gelände anzupassen, ist die 20 Kilometer lange Schmalspurbahn von Třemešná nach Osoblaha, wo sich in der Nähe des Dorfes Liptáň die schärfste Bahnkurve Tschechiens (Radius von nur 75 Metern) befindet. Im Hinblick auf die aktuelle Situation ist jedoch zu bedenken, dass nahezu alle Bahnen ursprünglich nur eingleisig konzipiert waren und der Bau eines zweiten (oder zusätzlichen) Gleises erst erfolgen konnte, nachdem sie ihre Wirtschaftlichkeit unter Beweis gestellt hatten. Daher wurde den Eisenbahngesellschaften die Doppelspurigkeit meist erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung gestattet. Im Fall der Bahnstrecke Košice-Bohumín zum Beispiel wurde das zweite Gleis schrittweise ab Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, der größte Teil der Strecke dieser Bahn wurde bis in die 1930er Jahre zweigleisig und als Ganzes erst im Jahr 1955.
Der Bau der Eisenbahn hatte auch einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Städte und Dörfer. Es war nicht nur der Bau von Eisenbahngebäuden, die in einigen Fällen, vor allem nach späteren Rekonstruktionen, ein sehr repräsentatives Aussehen erhielten (z. B. Opava-východ oder Ostrava-Svinov), andernorts bildeten sie eine relativ einheitliche Eisenbahnarchitektur der jeweiligen Verkehrsbetriebe. In der Regel brachte der Bahnhof ein neues Kommunikationszentrum in den Stadtraum, das mit dem Stadtzentrum verbunden werden musste, und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand das Phänomen der Bahnhofsstraßen. Diese wurden nicht nur zu einer belebten Durchgangsstraße, sondern auch zu einem Raum für repräsentative bürgerliche und kommerzielle Entwicklungen.
Auch die Dampfeisenbahn prägte das Landschaftsbild durch ihre Emissionen und ihren Lärm erheblich. Im 19. Jahrhundert wurde dieses Phänomen als widersprüchlich wahrgenommen. Während die meisten Landbewohner die rauchende und rumpelnde Lokomotive zumindest in der Anfangszeit als Bedrohung für ihre landwirtschaftlichen Bemühungen sahen, war sie für andere ein Symbol für Fortschritt und Wohlstand. Wohlstand wurde in diesen Überlegungen mit wirtschaftlichem Aufschwung verbunden, und die nach und nach gesammelten Daten bestätigten diese Ansicht. Den Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung in Schlesien und dem bestehenden Verkehrsnetz, das die Landschaft stark beeinflusste, zeigt auch eine Karte der Handels- und Gewerbekammer Opava aus den frühen 1880er Jahren. Sie zeigt den Zustand des Eisenbahnnetzes in Schlesien nach der Beendigung des Baus des Haupteisenbahnnetzes in den böhmischen Ländern, d.h. ganz am Anfang der Ära des Baus von lokalen Eisenbahnen. Zugleich zeigt es die entwickelte Industrie Schlesiens in der Endphase der industriellen Revolution.

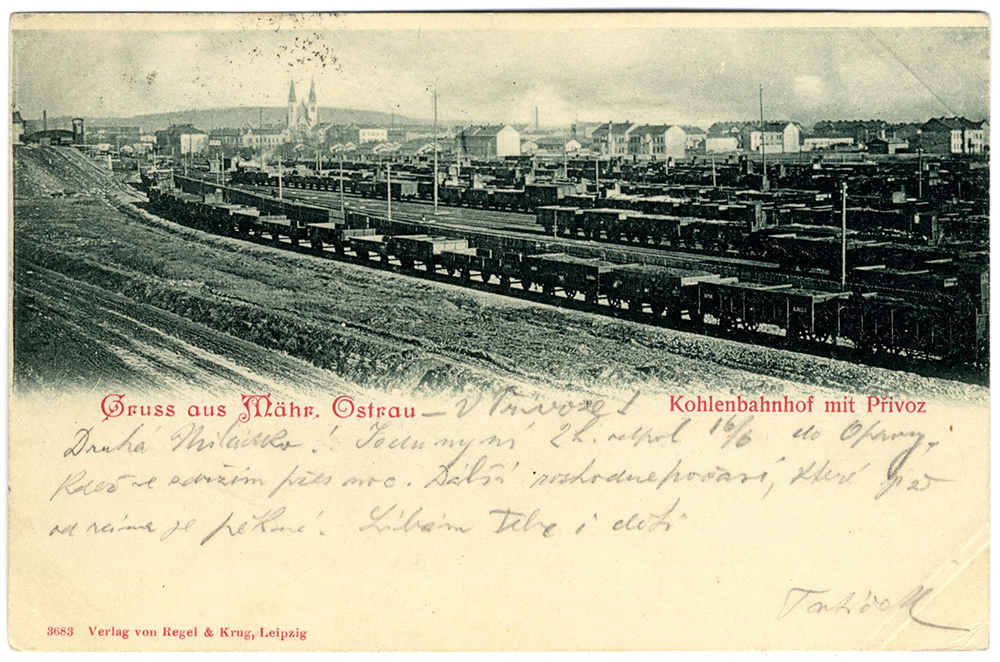
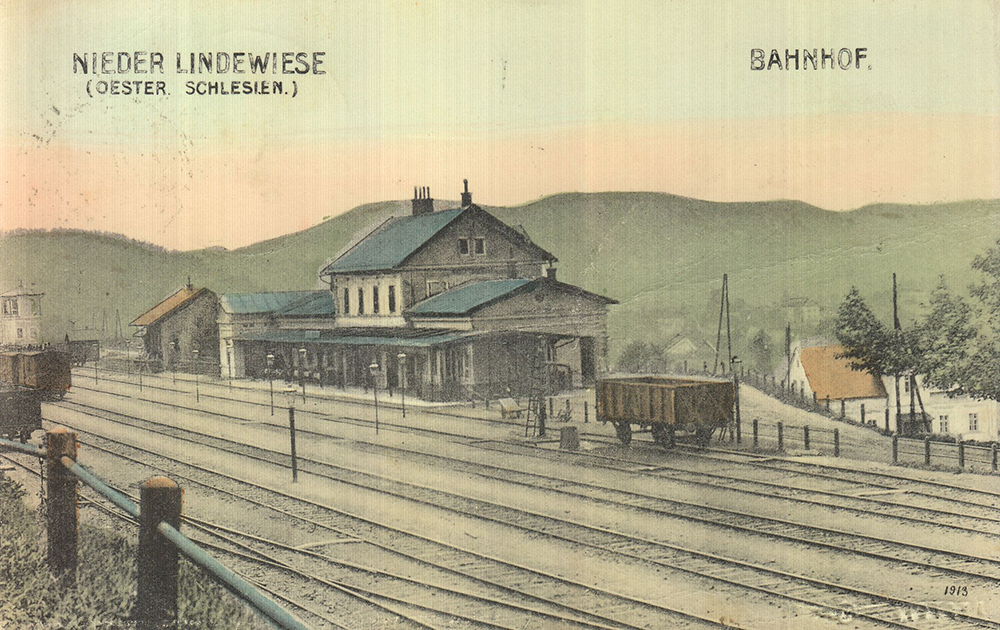
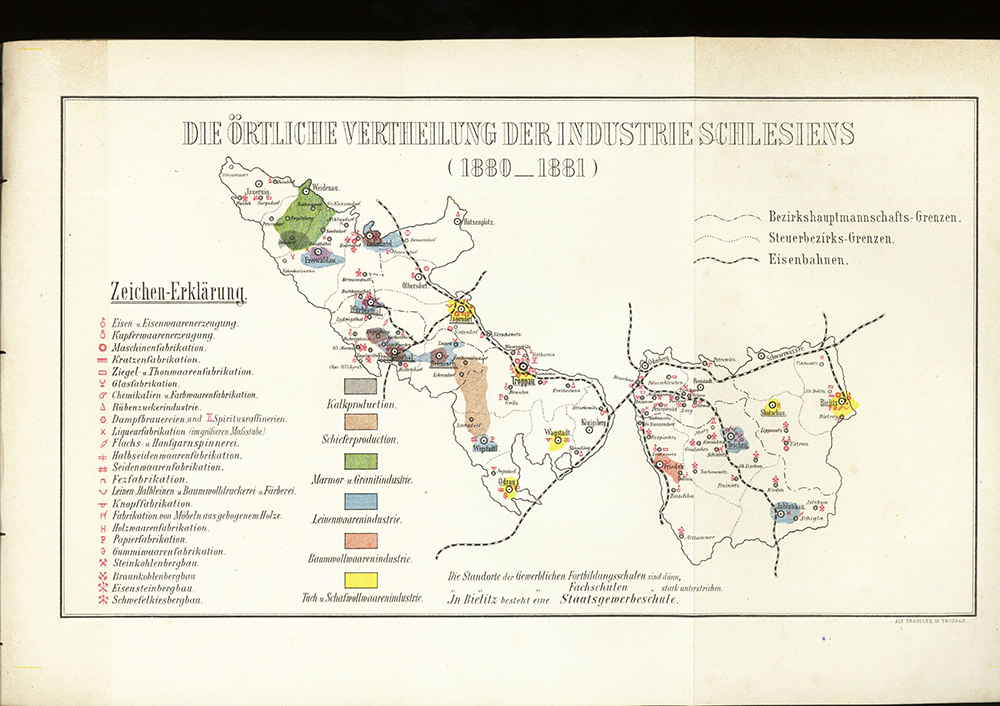
3.31 Verkehrsentwicklung - Luftfahrt
Die Luftfahrt ist ein bedeutendes Attribut der Neuzeit, der technischen Entwicklung und ein Symbol für die Beschleunigung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens im 20. Jahrhundert.
Die Tradition der Luftfahrt geht auf die Geschwister Vilém, Josef und Leopold Žurovec zurück. In den Jahren 1909-1911 konstruierten sie ein eigenes Flugzeug, das 1913 im Saal des Gasthauses in Albrechtice ausgestellt wurde, und in den Jahren 1912-1914 führten sie Flugversuche auf dem Flugfeld zwischen Albrechtice, Mošnov und Harta (deutsch Lilien) durch - der Siedlung, aus der sie stammten und die später dem Bau des Flughafens Ostrava in Mošnov wich.
Der Erste Weltkrieg brachte einen Wandel: Die Luftfahrt, die bis dahin auf technischen Experimenten beruhte und als Attraktion für Zuschauer galt, wurde zur Vernichtungswaffe. Die beachtliche Entwicklung der militärischen Luftfahrt ermöglichte es vielen jungen, technisch begabten Menschen, sich mit Flugzeugen verschiedener Bauarten vertraut zu machen und deren Steuerung zu beherrschen, was sie nach dem Krieg in der zivilen Luftfahrt anwenden konnten. Letztere wurde jedoch nur sehr langsam aufgebaut. Die militärischen Operationen am Ende des Krieges sind mit der kurzzeitigen Existenz des Flugplatzes in Hrabová verbunden, wo die tschechoslowakische Luftwaffe landete und an den Aktionen im Zusammenhang mit der Befreiung des polnisch besetzten Těšín (1919) teilnahm.
Während die tschechoslowakische Militärluftfahrt nach dem Ersten Weltkrieg neue Maschinen erhielt, entwickelte sich die zivile Luftfahrt in der Region lange Zeit nicht. Am 7. März 1926 wurde unter dem Protektorat von Präsident Masaryk der Masaryk-Luftfahrtverband (MLL) gegründet. Für Schlesien und Ostrau wurde in Opava (28. November 1926) ein Bezirkssitz eingerichtet, der 1934 nach Ostrau verlegt wurde. Der Masaryk-Luftfahrtverband errichtete westlich von Bohuslavice bei Dolní Benešov einen Flugplatz, der im September 1928 eröffnet wurde und ab 1. Juli 1935 kurzzeitig Flugverbindungen mit Prag unterhielt. Im Jahr 1936 wurde der Flughafen geschlossen. Der Masaryk-Luftfahrtverein in Moravská Ostrava erwarb für seinen Flugplatz das Gelände nördlich des Hauptbahnhofes der Bahnlinie Svinov - Ostrava der von Osten durch Přednádraží begrenzt wird. Es war eine Fläche von 600 × 400 Quadratmetern. Er war Austragungsort von Modellflug- und Segelflugwettbewerben und seit 1932 war er Schauplatz der Flugtage.
Am 10. Dezember 1926 wurde in Místek eine lokale MML-Gruppe gegründet, die seit 1931 aktiv war und von General František Melichar geleitet wurde. Den örtlichen Aviatikern stand der Flugplatz "Pod Štandlem" zur Verfügung, der an der Straße durch Sviadnov lag und eine Fläche von 350 × 850 Metern hatte. Es gab auch sportliche Aktivitäten, Segelflug, Modellbau, und die Vereinsmitglieder bauten Segelflugzeuge in ihrer eigenen Werkstatt.
Der Masaryk-Luftfahrtverband widmete sich der Förderung der Luftfahrt, ihrer Popularisierung und der Wettbewerbstätigkeit, während sich die Aero-Clubs auf die allmähliche Professionalisierung der Luftfahrt konzentrierten, die ihre Nutzung als Teil des modernen Fernverkehrs bedingte. Ostrava erreichte diese Entwicklungsstufe mit der Gründung der Ostrauer Filiale des Aeroclubs der Tschechoslowakischen Republik (Juni 1935). Der Aeroclub konzentrierte sich auf den Sportflugverkehr und die Pilotenausbildung und erwarb nach einer Reihe von Verhandlungen den Flugplatz in Hrabůvka, auf dem am 3. August 1936 das erste motorisierte Flugzeug gelandet ist. Nach und nach entstanden in der Nähe des Flughafens die Hangars des Aeroclubs, des Aeroclubs OKD, der Witkowitzer Eisenwerke und der MLL.
Die dramatische politische Situation in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre betonte die Stärkung der militärischen Luftfahrt, wozu auch die Aktion "Tausend neue Piloten für die Republik" (1936) beitrug, die darauf abzielte, neue Piloten für mögliche militärische Zwecke auszubilden. Ab 1934 produzierte die Firma Moravskoslezská vozovka, a. s. in Studénka Flugmotoren und Flugzeuge. Ein Werksflughafen in der Nähe des Werkes war bis 1945 in Betrieb, wurde dann aber für militärische Zwecke genutzt. Ende der 1930er Jahre wurde auf dem Flugplatz bei Dolní Benešov eine Gendarmerie-Luftpatrouille eingerichtet. Ein Wendepunkt in der Luftfahrt in Schlesien und Ostrau kam in den Jahren 1938-1939. Im Jahr 1938 - und erneut im Frühjahr 1945 - wurde der Flughafen in Dolní Benešov von der deutschen Besatzungsmacht genutzt. Ende August 1939 nutzte die Luftwaffe das Gebiet bei Mošnov, wo die Brüder Žurov einst ihre Flugzeuge getestet hatten, für Angriffe auf Polen. Als die Besatzer in das Landesinnere von Polen vordrangen, rückte die deutsche Luftwaffe in Preußisch-Schlesien und Polen ein. Der Feldflugplatz in Mošnov verschwand damit und wurde erst Anfang 1945 wieder aufgebaut, um der sich zurückziehenden deutschen Armee zu dienen. Der Werksflugplatz in Studénka diente demselben Zweck. Am 10. Mai 1945 landeten die Flugzeuge der ersten tschechoslowakischen Luftdivision auf dem Flugplatz Mošnov.

Seit 1945 waren die an der Luftfahrt Interessierten im Tschechischen Nationalen Aero-Club zusammengeschlossen, der ein Netz lokaler Organisationen schuf (Místek - Flugplatz "Pod Štandlem", 1947-1951; Bahna, 1953-1962; Vítkovice und Moravská Ostrava - Flugplatz Hrabůvka; Opava - Flugplatz bei Dolní Benešov; Jeseník, 1947-1954). Die Situation in der Luftfahrt nach dem Februar 1948 war durch politische Säuberungen unter den Piloten und organisatorische Veränderungen gekennzeichnet. Für die Industrieregion Ostrava war es notwendig, einen neuen Verkehrsflughafen zu bauen, der im Kriegsfall von der Armee genutzt werden konnte. Die Wahl fiel auf ein Gebiet bei Mošnov (Bau 1957-1959; ein Teil des Flugplatzes wurde von der Armee genutzt). Luftfahrtinteressierte schlossen sich nicht mehr dem Aeroclub, sondern dem Tschechoslowakischen Verband der Volksfliegerei an, dessen Aktivitäten von Svazarm (gegründet 1951) übernommen wurden. Letztere erwarb einen neuen Flughafen bei Dolní Benešov (Bau in den Jahren 1959-1961). Die Erneuerung des Aeroklubs in Jeseník geht auf die Jahre 1967-1968 zurück, als der Bau des Flugplatzes in Nová Ves bei Mikulovice begann, der Mitte der 70er Jahre fertiggestellt wurde.
Das Jahr 1989 brachte eine Reihe von großen Veränderungen im Bereich der Luftfahrt. Zunächst kam es zu einer radikalen Rekonstruktion und Modernisierung des Verkehrsflughafens Ostrava in Mošnov, der im Jahr 2004 in den Besitz der Mährisch-Schlesischen Region überging (seit 2006 als Leoš Janáček Airport). Was die Freizeitaktivitäten betrifft, so konnten der Aeroclub in Frýdlant nad Ostravicí, der Schlesische Aeroclub in Zábřeh u Dolní Benešov und der Aeroclub Jesenice ihre früheren Aktivitäten fortsetzen; andere Aeroclubs nahmen ihre Aktivitäten nach einer längeren Pause wieder auf. Im Jahr 1997 wurde der Pobeskydský aviatický klub Frýdek-Místek mit einem Flugplatz südlich der ehemaligen Siedlung Bahno gegründet. In Krnov befindet sich auch ein öffentlicher Inlandsflughafen, der vom örtlichen Aeroclub betrieben wird. Kleine Flughäfen gibt es auch in der Nähe der Dörfer Trnávka, Velké Hoštice, Hať und Sedliště sowie in der Nähe der Talsperre Slezská Harta.
3.32 Natürliche Extreme und ihre Auswirkungen
Naturereignisse treffen unser Gebiet jedes Jahr und verursachen je nach Ausmaß materielle Schäden und im Extremfall den Verlust von Menschenleben. Das verheerendste Phänomen sind in der Regel Überschwemmungen, die den Charakter von Naturkatastrophen annehmen können, wie es im Juli 1997 in Mähren und Schlesien der Fall war. Weitere hydrometeorologische Extreme sind sintflutartige und lang anhaltende Regenfälle, Dürren, Stürme, Hagelstürme, Vereisungen, große Schneemengen, extreme Hitze- oder Kältewellen. Geomorphologische Extreme, die vor allem durch Hangprozesse (z. B. Lawinen, Steinschlag, Muren und Blockmuren) repräsentiert werden, können ebenfalls erhebliche lokale Auswirkungen auf die Landschaft haben. Unter unseren Bedingungen gehören Überschwemmungen, Dürren und Stürme zu den wichtigsten hydrometeorologischen Extremen.
Ein anderes Extrem ist die Trockenheit. Historische Quellen berichten uns über das Auftreten von Trockenjahren. Äußerst reichhaltige Aufzeichnungen existieren für die Dürre von 1947, die auch im gesellschaftspolitischen Bereich eine bedeutende Rolle spielte. In diesem Jahrhundert haben Dürreperioden unsere Landwirtschaft schon mehrmals betroffen. Die erhöhte Häufigkeit von Trockenjahren, ihre Intensität und ihre flächenmäßige Ausdehnung sind also langfristiger Natur. Die Dürre und ihre negativen Auswirkungen sind kumulativ, z. B. sinken die flachen Grundwasserspiegel, die Feuchtigkeitsreserven im Boden nehmen allmählich ab und das Dürrerisiko ist jetzt das höchste seit 130 Jahren.
Der Wind selbst stellt keine unmittelbare Gefahr für den Menschen dar, gefährlich wird er erst durch die Zunahme seiner Intensität und Geschwindigkeit (Orkan) und die anschließende Einwirkung auf Gegenstände und Objekte in der Nähe des Menschen. Wind kann Äste abbrechen, Bäume entwurzeln, Gebäude, Strom- und Telefonleitungen zerstören und Probleme im Schienen- und Straßenverkehr verursachen. Aber auch in der Tschechischen Republik ist das Auftreten von Tornados keine Seltenheit, obwohl ihre zerstörerische Wirkung hier viel schwächer ist. Im Jahr 2013 ereignete sich in der Nähe von Krnov ein Tornado; der Windwirbel verursachte erhebliche Schäden, insbesondere an Waldbeständen. Im Jahr 2010 wurde in der Nähe von Kobierzyce und Štěpánkovice ein atmosphärischer Wirbel (Tromba) beobachtet.

Zu den gefährlichen Phänomenen gehören auch Erdrutsche und Felsstürze. Hierbei handelt es sich um einen gefährlichen Geofaktor, der durch Hangbewegungen von Boden, Geröll, Fels oder Gesteinsmassen aufgrund geologischer Prozesse entsteht. Glücklicherweise ist dieses Phänomen meist räumlich begrenzt. Im Juni 1921 kam es während eines Wolkenbruches im Tal der Hučivá Desná zu Erdrutschen am Westhang des Červená hora unterhalb von Vřesová studánka. Die Masse versperrte das Tal und bildete einen Stausee, dessen späterer Bruch katastrophale Folgen für den gesamten Flusslauf hatte. Ein massiver Erdrutsch ereignete sich im Mai 2010 nach starken Regenfällen am Südhang der Gírová (Jablunkovské Mezihoří). Schneelawinen sind eine besondere Form des Hangversagens. Der Mechanismus der Bewegung ist identisch mit dem von Lawinen, aber das transportierte Material ist hier Schnee. Die Lawinen sind nur an Berggebiete und meist an die Wintersaison gebunden. Die meisten Lawinen in Mähren und Schlesien gehen im Großen Becken im Gesenke ab; die Schneedecke ist hier im Gletscherkarst am höchsten und auch während der Schneeschmelze im Frühjahr gefährlich.
3.33 Aktuelle natürliche und anthropogene Prozesse in der Landschaft
Die Landschaft als ein extrem dynamisches System hat eine gewisse Fähigkeit, eine stabile Umgebung zu erhalten, nach einer Störung in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren oder einen neuen Gleichgewichtszustand zu finden, der für die weitere Existenz geeignet ist. Die Geschwindigkeit der aktuell stattfindenden Prozesse ist unterschiedlich. Eingriffe und Veränderungen, die zunächst als störend erscheinen, können mit der Zeit zu einem angemessenen Teil der Landschaft werden. Die Landschaft wurde und wird durch natürliche Prozesse verändert, zu denen der Mensch im Laufe ihres Bestehens beigetragen hat. Seit der Mensch ein wesentlicher landschaftsprägender Faktor geworden ist, verschmelzen und interagieren natürliche und anthropogene Prozesse, wobei die anthropogenen Einflüsse auf die Landschaft immer intensiver werden.
Wasser ist ein sehr sensibler Bestandteil der Landschaft. Oberflächen- und Grundwasser werden durch sauren Regen, Industrieemissionen, Abwässer, Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft usw. verschmutzt. Das Oberflächenwasser enthält sogar pharmazeutische Inhaltsstoffe, die aus Arzneimittelfabriken, Krankenhäusern und Haushalten sowie aus der illegalen Herstellung von Betäubungsmitteln in das Wasser gelangen. Der verstärkte Einsatz von Stickstoffdüngern in den 1960er und 1970er Jahren hat sich verzögert auf die Grundwasserverschmutzung ausgewirkt. Deponien stellen eine potenzielle Gefahr dar, und bei ihrem Bau und Betrieb muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass keine Leckagen in das Grundwasser gelangen. Wasserverschmutzung kann auch als Folge von Streusalzeinsatz auftreten.
Der Zustand der landwirtschaftlichen Flächen und des Waldes ist ein ernstes Problem. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche nimmt ab und ihr physischer Zustand verschlechtert sich (chemische Düngung, Bodenverdichtung durch schwere Maschinen, Erosion und Denudation). Hinzu kommen die Versauerung der Böden und die Verarmung an wichtigen Elementen. Auch der Zustand unserer Wälder hat sich in letzter Zeit verändert. So wurden artenreine Fichtenbestände durch Trockenheit geschädigt und anschließend von Borkenkäfern befallen, und auch die langfristige Versauerung und Nährstoffverschlechterung der Waldböden wirkt sich negativ auf den Zustand der Wälder aus.
Wetterextreme zeigen uns, wie verletzlich die vom Menschen gestaltete Landschaft ist. Dürre ist mit Problemen in der Landwirtschaft und der Wasserversorgung verbunden. Sintflutartige Regenfälle werden immer zerstörerischer, was mit den vielen negativen Eingriffen in die Landschaft in der Vergangenheit zusammenhängt. Das Rückhaltevermögen der Landschaft hat sich erheblich verringert und die Landschaft ist, beeinflusst durch intensive Landwirtschaft, Bebauung und andere Faktoren, nicht mehr in der Lage, die notwendige Wassermenge aufzunehmen. Verschiedene bauliche Maßnahmen sind zwar ein wirksamer Schutz vor Überschwemmungen, stellen aber auch einen großen Eingriff in das Landschaftsbild dar.
Im Zusammenhang mit dem Mineralabbau kommt es zu erheblichen Veränderungen des Landschaftsbildes. Nicht nur die Lagerstätten selbst sind bedroht, sondern auch die natürliche Umgebung um sie herum. Der Bergbau führt zu einem Verlust von Bodenfonds, Zerstörung der Vegetationsdecke, kann die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft beeinträchtigen, Verschlechterung der ökologischen Bedingungen in der Umgebung. Gleichzeitig können nach dem Ende des Bergbaus aber auch interessante neue Biotope entstehen, die oft von seltenen Pflanzen- und Tierarten bewohnt werden.
Auch die Bautätigkeit findet in großem Umfang statt. Der Prozess der Verdichtung und Ausweitung des Straßennetzes und die damit verbundene Fragmentierung der Landschaft gehen weiter. Ein ernstes Problem, das eng mit dem Bauwesen zusammenhängt, ist die Gefahr von Erdrutschen, die häufig im Zusammenhang mit der Gründung neuer Gebäude entsteht. Bereiche, in denen es in der Vergangenheit zu Erdrutschen gekommen ist (Steilufer des Stausees Šance), werden ebenfalls überwacht. Kleinere Erdrutsche können durch Überschwemmungen hervorgerufen werden (Flyschzone der Karpaten, Ausläufer des Gesenkes).
Die Bergbau-, Hütten-, Chemie- und Energiewirtschaft prägte lange Zeit die einzelnen Landschaftsbestandteile von Tschechisch-Schlesien. Die industrielle Tätigkeit ist nach wie vor einer der Haupteinflüsse auf die Atmosphäre, sie beeinflusst die Qualität des Grund- und Oberflächenwassers, das Gelände wird für den Bau von Industriegebäuden verändert usw. Alle diese Aspekte können Auswirkungen auf die einzelnen natürlichen Bestandteile der Landschaft haben. Nach dem Tiefenbergbau im Bezirk Ostrava-Karviná wurde die Landschaft großflächig gestört; einige davon wurden bereits vollständig (Darkovské moře, Karolina, Lazy, Louky nad Olší) oder teilweise rekultiviert (Lagune Ostramo, Heřmanice-Halde). Eine Besonderheit der Region Ostrava sind zwei brennende Kohlenhalden (Ema, Heřmanice-Halde), wo während des Haldenbrandes eine Reihe von geochemischen und mineralogischen Prozessen stattgefunden hat. Die Heřmanice-Halde wird derzeit dekontaminiert. Jüngste Gasuntersuchungen zeigen, dass brennende Haufen nicht annähernd so viel Gefahr darstellen wie erwartet.
Obwohl unser Gebiet seismisch relativ ruhig ist, kommt es von Zeit zu Zeit zu kleinen Erdbeben. Anthropogene Erschütterungen, verursacht durch Bergbauaktivitäten, Steinbruchsprengungen und Verkehr, sind spezifisch. Auf dem Gebiet von Schlesien treten größere Beben nur in den unterminierten Gebieten (Ostrava, Karviná) auf. Das aktuelle Problem im Gebiet von Ostrava und Karviná sind nach wie vor die durch Unterspülungen, vor allem Senkungen, verursachten Bewegungen, die trotz eines deutlichen Rückganges des Bergbaus noch viele Jahre lang anhalten werden.
Besondere Bedingungen ergeben sich in größeren Städten (große Gebäudefläche, starke Erhitzung, geringe Vegetationsfläche, schneller Wasserabfluss usw.). Anthropogene und natürliche Einflüsse wirken auf Gebäude ein und führen zu deren Degradation (Erosions- und Korrosionsprozesse). In Städten und in der Nähe von Hochspannungsleitungen wird das Erdmagnetfeld beeinflusst, und in Großstädten bilden sich im Sommer sogenannte Wärmeinseln. Eine neue Wildnis entsteht in Gebieten, die entweder vom Menschen intensiv ausgebeutet oder direkt geschaffen und später aufgegeben wurden. Dabei handelt es sich um ein ganz bestimmtes Gebiet, oft an der Stadtperipherie, das aus irgendeinem Grund aufgegeben und der Entwicklung überlassen wurde. Sehr bald übernehmen die frühen Stadien der Sukzession die Oberhand und der Standort wird von krautigen Gemeinschaften und Gestrüpp überwuchert. Insekten, Vögel und Wildtiere finden hier Zuflucht, und auch Obdachlosen und schwarze Müllhalden kommen vor.
Normalerweise neigt man dazu, alle aktuell ablaufenden Prozesse nur aus der eigenen Perspektive zu betrachten, aber das kann irreführend sein. Zum Beispiel sind Überschwemmungen zwar katastrophale Ereignisse (Sachschäden, Verlust von Menschenleben), aber aus der Sicht anderer Organismen können sie eine Chance sein, die sie zu ihrem Vorteil nutzen können. Besonders nach katastrophalen Ereignissen ist die Fähigkeit der Landschaft, in ihren ursprünglichen Zustand zurückzukehren, gut belegt.

Anpassung an den Klimawandel. Forschungsergebnisse aus vielen Wissenschaftsgebieten zeigen deutlich, dass sich der Klimawandel in den letzten Jahren vollzogen hat. Die Auswirkungen dieser Veränderungen können katastrophal sein, daher ist es notwendig, sich so weit wie möglich auf sie vorzubereiten. Anpassung bedeutet, mit den Auswirkungen eines sich ändernden Klimas zurechtzukommen, und wir betrachten Anpassungsmaßnahmen als Anpassungen, die die Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels verringern. Im Jahr 2017 wurde der Nationale Aktionsplan zur Anpassung an den Klimawandel durch den Regierungsbeschluss Nr. 34 verabschiedet. Der Plan ist ein Umsetzungsdokument der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in der Tschechischen Republik von 2015 und ist nach den einzelnen Erscheinungsformen des Klimawandels gegliedert. Zu den negativen Auswirkungen des Klimawandels gehören langanhaltende Trockenheit, Überschwemmungen und Sturzfluten, steigende Temperaturen, extreme Wetterereignisse (starke Regenfälle, extrem hohe Temperaturen, extreme Winde) und natürliche Brände.
Die Anpassung an den Klimawandel umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der negativen Auswirkungen von extremer Hitze. Extreme Temperaturen betreffen ganze Ökosysteme, sind aber in urbanisierten Gebieten besonders ausgeprägt. Hitzestress kann zu gesundheitlichen Problemen, erhöhtem Energiebedarf für die Kühlung, negativen Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung und verminderter Lebensqualität führen. Die Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion sind weitreichend, und auch im Energie- und Wassersektor können Probleme auftreten. In städtischen Umgebungen muss der städtische Wärmeinseleffekt reduziert werden - Anpassung der Gebäude an den Klimawandel, Erhöhung des Anteils an Vegetation und Wasserflächen usw. Hitzeinseln entstehen auch durch Nacherntefelder, mit Oberflächentemperaturen von bis zu 50°C und deutlich trockeneren Landschaften. Große Bodenblöcke werden entwässert, um wirtschaftlich rentable Anbauflächen (Raps, Mais und Getreide) zu schaffen. Ab 2020 verpflichtet eine Regierungsverordnung die Landwirte, Felder in erosionsgefährdeten Gebieten zu unterteilen und mehr Pflanzenarten anzubauen oder Felder mit Pufferstreifen aus bodenschonenden Pflanzen zu unterteilen. Dies sollte zu einer Verbesserung der Fähigkeit der Landschaft führen, Wasser zurückzuhalten.
Die klimatischen Bedingungen der letzten Jahre haben erneut eine ernste Bedrohung aufgezeigt - die Dürre - deren Auswirkungen wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Art sind. Nach den verfügbaren Klimamodellen ist in Zukunft mit einem weiteren Anstieg der Lufttemperatur und der damit verbundenen Zunahme des Risikos und der Dauer von Trockenheit zu rechnen. Die Auswirkungen der langanhaltenden Trockenheit werden durch die jahrelange unsachgemäße Bewirtschaftung der Landschaft, vor allem auf landwirtschaftlichen Flächen und in Wäldern, aber auch im bebauten Bereich, verschärft. Die Kombination aus Trockenheit und unsachgemäßer Bewirtschaftung führt zur Degradierung und Erosion der landwirtschaftlichen Flächen und zu einer Verringerung ihres Produktionspotenzials. In verstädterten Gebieten kann es nicht nur zu Wasserknappheit kommen, sondern auch die Wasserqualität kann sich verschlechtern oder direkt verunreinigt werden. Es ist zwingend notwendig, auf die Verbesserung des Wasserhaushalts in Wäldern und landwirtschaftlichen Landschaft. Auch bei der Bewirtschaftung von Regenwasser in Wohngebieten und in der Industrie gibt es erhebliche Reserven. Es besteht die Notwendigkeit, das natürliche Rückhaltevermögen von Fließgewässern und Überschwemmungsgebieten zu erhöhen, um einen effektiven Schutz und eine effektive Nutzung der Wasserressourcen zu gewährleisten, und ggf. neue Quellen zu erschließen.
Überschwemmungen sind ein natürliches Phänomen, das nicht vollständig verhindert werden kann. Umso wichtiger ist es, dass auf eine wirksame Prävention Wert gelegt wird. Überschwemmungen haben die größten negativen Auswirkungen auf stark verstädterte Gebiete, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft, Verkehr, Industrie und Energie. Die Aufmerksamkeit muss in erster Linie den Gebieten gelten, die bereits am stärksten durch Überschwemmungen gefährdet sind. Die Grundsätze des Hochwasserschutzes müssen in der Raumplanung berücksichtigt werden, damit keine weiteren Risikogebiete entstehen.
Die Prognosen für das Jahr 2099 gehen von einem weiteren allmählichen Anstieg der Durchschnittstemperaturen in der Tschechischen Republik aus, wobei die höchsten Temperaturen in Schlesien weiterhin im Ostrauer Becken liegen werden. Die durchschnittliche Oberflächentemperatur in Europa ist Berichten zufolge um 1,3 °C höher als der vorindustrielle Durchschnitt. Mit steigenden Temperaturen kommt es logischerweise zu einer deutlichen Verlängerung der Vegetationsperiode und zu einer Verschiebung von Vegetationsstadien und Artenspektren nach Norden bzw. in höhere Lagen, was auch Veränderungen in der Baumartenrepräsentation mit sich bringen würde. Steigende Temperaturen in Verbindung mit lang anhaltender Trockenheit erhöhen natürlich das Risiko des Waldsterbens und die Gefahr von Waldbränden. Höhere Temperaturen können eine Verringerung der Oberflächenwasserqualität verursachen. Die Sicherstellung stabiler Ökosysteme, insbesondere in der Forst-, Land- und Wasserwirtschaft, sollte die wichtigste Anpassung an die steigenden Temperaturen und die damit verbundenen Auswirkungen sein. Mit der Zunahme von Trockenheit und hohen Temperaturen wird auch ein höheres Auftreten von Bränden in Wäldern und Grasland sowie in landwirtschaftlichen Kulturen erwartet.
In all diesen Fällen ist es notwendig, die ökologische Stabilität der Landschaft zu stärken und die mit den oben genannten Phänomenen verbundenen Risiken zu reduzieren. Es ist auch wichtig, die Flexibilität und Zuverlässigkeit des Transportsektors und die Entwicklung und Stärkung des integrierten Rettungssystems zu gewährleisten. Die erfolgreiche Anpassung der Tschechischen Republik an die negativen Auswirkungen des Klimawandels ist eine entscheidende Aufgabe für die Regierung und die staatlichen Institutionen, aber es ist wichtig, sich insbesondere auf die Anpassungsaktivitäten auf regionaler und lokaler Ebene zu konzentrieren. Vorrangig sollten Lösungen gewählt werden, die sich positiv auf mehrere Aspekte des Klimawandels auswirken. Die Erforschung der negativen Auswirkungen des Klimawandels und die Bewertung der besten Möglichkeiten zur Anpassung der Landschaft und der Gesellschaft an diese Veränderungen erfordert nicht nur die Zusammenarbeit vieler verschiedener Disziplinen, sondern auch Bildung, Ausbildung und Sensibilisierung.
3.34 Zurück zur Natur - Bergwandern
In der Vergangenheit haben die Menschen die Berge lange Zeit als einen trostlosen, düsteren und unsicheren Ort betrachtet, der von dunklen Mächten und Geistern bewohnt wird und in den es nicht ratsam ist, einen Fuß zu setzen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wandelten sich die Berge jedoch in den Augen der Reisenden durch die negativen Auswirkungen der Industrialisierung auf die Städte, den sentimentalen Einfluss des Rousseau'schen Naturkults, die Expeditionen der Naturforscher und bald auch durch das romantische Konzept des erschreckenden "Erhabenen". Der laue Blick des Reisenden auf Hügel und Felsen ist von Erstaunen, Ehrfurcht und Schönheit geprägt. Der Blick des Touristen auf die Berglandschaft ist geboren. Ein einst unwirtlicher und heimtückischer "Nicht-Ort" wird so zu einem "Ort", an dem Wissenschaftler, leidenschaftliche Intellektuelle und exzentrische Künstler das "Authentische", das "Vergangene", das "Ursprüngliche" und das "Wilde" erleben können. Alles, was in überzivilisierten Städten fehlt.
Die Verabschiedung des liberalen Bundesgesetzes von 1867 machte dem organisierten Bergwandern die Füße frei und gab den anspruchsvollen Wanderungen einen sportlichen Touch in Form von selbstbefriedigender Freude an der körperlichen Ertüchtigung, die den Touristen der Romantik unbekannt war. Die britischen (1857 Alpine Club) und österreichischen (Österreichischer Alpenverein) Bergsteigervereine sollten zum Vorbild werden. In Schlesien konzentriert sich die Nachfrage nach Bergwanderungen im Norden auf das Gesenke, das Massiv des Kralice Sněžník, die Rychlebské hory und im Süden auf die Beskiden. Im Jahre 1881 wurde der Mährisch-Schlesische Sudeten-Gebirgsverein gegründet, dessen Mitglieder sich zum Ziel gesetzt hatten, die Jeseníky-Kämme innerhalb weniger Jahrzehnte populärer zu machen: über das Wetter zu berichten, Postkarten zu verteilen, Bergwege, Wegweiser und Rastplätze einzurichten, Aussichtstürme und Aussichtspunkte zu bauen, sie mit Orientierungstafeln und Ferngläsern auszustatten, billige Fahrkarten anzubieten und Empfehlungen für gute Gasthäuser, Restaurants und Unterkünfte zu veröffentlichen. Der Verein organisiert auch Exkursionen, Ausstellungen und Vorträge. Sie richtet eine Bibliothek ein, veröffentlicht wissenschaftliche Schriften, Karten und gedruckte Führer. In den tschechischen Ländern handelt es sich um einen Klub mit einem breiten territorialen Wirkungsbereich, einem Sitz in Jeseník und einer Reihe von untergeordneten Sektionen. Mit einer Mitgliederzahl von 4003 Personen ab dem Jahr 1911 wird er seine Hegemonie im Gesenke auch nach der Gründung der Tschechoslowakei und trotz der Bemühungen des tschechoslowakischen Touristenklubs, mit dem er auch eine Reihe von Kooperationen eingehen wird, beibehalten.
Noch vor der Gründung des Tschechischen Touristenklubs im Jahr 1888 wurde 1884 die Pohorská jednota Radhošt' gegründet. Erst dann, 1893, mit einiger Verzögerung wegen des fehlenden deutschen Hintergrunds in den überwiegend slawischen Beskiden, wurde eine konkurrierende Organisation, der Beskidenverein mit Sitz in Moravská Ostrava (ab 1895 in Těšín), eröffnet, der nach 1918 über 6.000 Mitglieder zählte. Der Beskidenverein ist aktiver bei der Herausgabe von Publikationen und Zeitschriften, aber beide Vereine konzentrieren sich auf die Förderung der Beskiden durch Reiseführer, Karten und durch die Organisation einer Vielzahl von Bildungsveranstaltungen, Theateraufführungen, Tanzabenden, Ausflügen, Ausstellungen, Filmvorführungen und Vorträge. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Reihe von exemplarischen nationalistischen Konflikten zwischen den beiden Organisationen um die "Herrschaft" über die Berge. Der Kampf äußert sich zum Beispiel in Reibereien beim Bau der eigentlichen Schutzhütten oder Hütten, auch die Markierung von Wanderwegen ist stark betroffen. Dies ist nicht unbedingt immer tschechisch-deutsch. Auch mit dem polnischen Towarzystwo Turystycznym haben die Deutschen zu kämpfen, während die Pohorská jednota Radhošt' mit dem Klub der tschechischen Touristen im Streit liegt. Während sich der Beskidenverein mit 3690 Mitgliedern bis 1927 erfolgreich das Beskidenvorland und einige bedeutende Gipfel wie den Babí hora aneignet, erobert die Pohorská jednota mit 6152 Mitgliedern bis 1934 den Pusteven, Radhoštěd und den Gipfel des Velký Javorník.
Die Vereinheitlichung der Leibeserziehung durch das kommunistische Regime nach 1948 machte sich auch im organisierten Tourismus bemerkbar. Zunächst wurden alle Touristenklubs in Sokol aufgelöst, um dann am 15. Juni 1950 per Dekret des Ministeriums für Nationale Sicherheit aufgelöst zu werden. In den nächsten Jahren wurden die touristischen Aktivitäten hauptsächlich in die Tourismusabteilungen der Leibesübungen der CSTV verlagert und die umfangreiche touristische Infrastruktur, die sich zu mehr als einem Drittel im Sudetenland befand, verstaatlicht. Nach der Vertreibung der Deutschen und der Übernahme des umfangreichen, touristisch genutzten Vermögens durch die Verwalter kam es zu einem deutlichen Niedergang und einer Verwüstung der touristisch attraktiven Gebiete. Neben den einsamen Wanderungen wurde die von der Revolutionären Gewerkschaftsbewegung (ROH) organisierte Massenerholung für Arbeiter später zu einer wichtigen Form des Tourismus in der Nachkriegstschechoslowakei. In den 1960er und 1970er Jahren wurden in den Bergen von Altvatergebirge und Beskiden viele Gebäude, verlassene Bauten und Mühlen in Chalupen umgewandelt, aber auch neue Hütten gebaut, die mit dem tschechoslowakischen Phänomen der so genannten Zweitwohnungen verbunden waren. Im Jahr 1988 gab es im Gesenke insgesamt 3822 Hütten und Chalets und in den Beskiden 7132. Auch in der nachsowjetischen Zeit wird das Gesenke von der Hüttenwirtschaft geprägt sein, während die hügeligen und bergigen Gebiete der Beskiden weiterhin von der Hüttenwirtschaft geprägt sind.
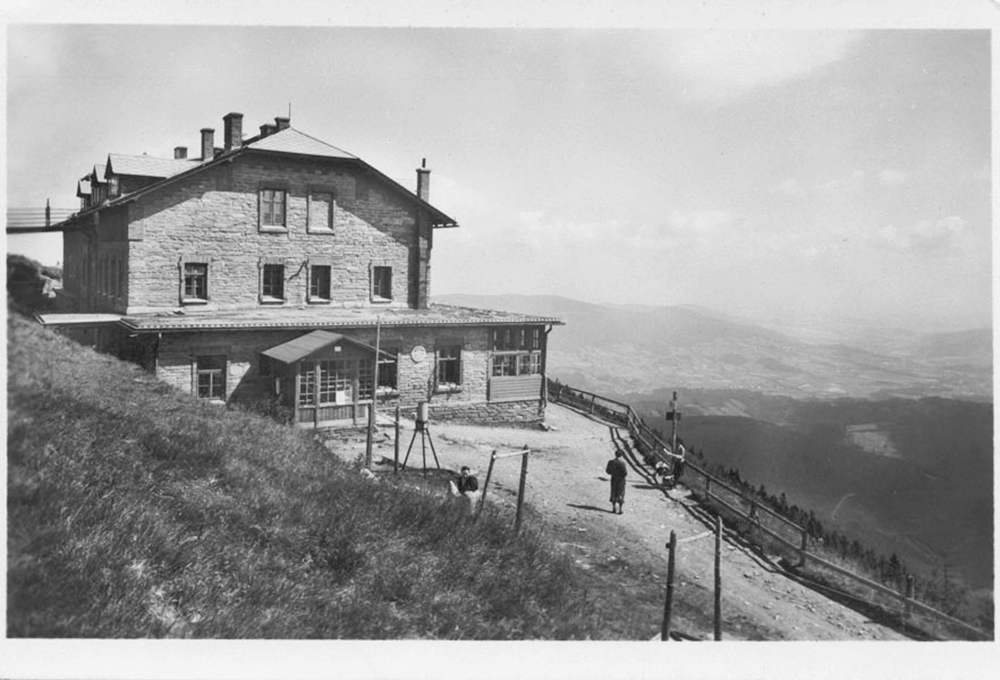
Nachhaltiger Tourismus in den Bergen war in den letzten Jahrzehnten ein drängendes Thema. Seit den 1960er und 1970er Jahren wurden die Bergwälder, Weiden und Hügel des Gesenke und Beskidengebirges in Gebiete mit erhöhtem Schutz, wie z.B. Schutzgebiete, einbezogen, wo der Umfang der erlaubten und verbotenen Aktivitäten durch Besucherregelungen geregelt ist. "Natur", "Authentizität" und "Wildheit" haben ein Haltbarkeitsdatum und sind daher heute rationiert. Obwohl der Tourismus reguliert wird, haben die Trends, die in den Bergen des 19. Jahrhunderts gesetzt wurden, bis heute Bestand. Obwohl ein Langläufer, Skifahrer oder Radfahrer, der um 1900 in den Bergen auftaucht, bei einem romantischen Touristen wie Mácha Unglauben hervorgerufen hätte, verbindet beide die Sehnsucht nach dem "Schönen", dem "Unberührten" und dem "Ursprünglichen". Obwohl zwischen den Mitgliedern des Beskidenvereins und den heutigen Bergwanderern im Riesengebirge ein Abstand von mehr als hundert Jahren liegt, eint sie der Wunsch, ihre Erfahrungen und Eindrücke zu teilen, auszuwerten und zu kommentieren. Einst auf dem Papier des Verbands-Newsletters, heute über Smartphone und soziale Netzwerke, wie Veranstaltungen wie 32 Gipfel der Beskiden / 32 Gipfel des Gesenkes zeigen. Das Wehklagen des harten Kerns der schlesischen Touristen über die Verunstaltung der Berge mit modernen Annehmlichkeiten ist keine neue Sache. Die Bewegung für die alte Einfachheit unter den mitteleuropäischen Bergwanderer- und Bergsteigerorganisationen geht auf das Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Die Verwendung des Rousseau'schen Mythos von der heiligen Natur als Zufluchtsort vor den zersetzenden Einflüssen des städtischen Lebens hat sich jedoch im Kampf gegen Zersiedelung, Komfort und die Einführung von Luxus in den Bergen nie durchgesetzt. Die Rückbesinnung auf die bäuerliche Idylle und die vermeintliche Askese der touristischen "Gründerväter" gelang nur einer Handvoll orthodoxer Bergsteiger angesichts der modernen Annehmlichkeiten, der Früchte der Wissenschaft und der Verlockungen eines grassierenden Konsumdenkens. So mögen Touristen in jedem Zeitalter gegen den Strom der Zeit reisen, der Zivilisation vorübergehend entfliehen, aber sie lehnen den technischen Fortschritt nicht ab. Der Tourist ist also eine typisch moderne Figur, ein Mensch, der tief eingeklemmt ist zwischen der unendlichen Sehnsucht nach dem "Echten", dem "Natürlichen" oder dem "Freien" und dem Unwillen, sich auch nur ein Minimum an Komfort und Luxus zu versagen.
3.35 Zurück zur Natur - Erholung und Sport
Erholung ist eine Freizeitaktivität, die in erster Linie der Entspannung und Erholung von der Arbeit und anderen Verpflichtungen dient. Das Ziel der Erholung kann mit der Erkundung der Natur, dem ästhetischen Erleben der Landschaft, dem Sport, dem Angeln usw. verbunden sein. Die Nutzung der Landschaft zur Erholung hat natürlich Auswirkungen auf die Umwelt, und die Landschaft wird durch erholungsbezogene Aktivitäten beeinflusst. Zu den negativen Auswirkungen der Erholung gehören Vandalismus, illegales Fahren von Kraftfahrzeugen in der Landschaft, Bauten in der Landschaft und die Anpassung der Landschaft für Erholungszwecke.
Die Tendenz der Stadtbewohner, im Sommer und zu anderen Zeiten aus der Stadt zu entfliehen, trat nicht plötzlich auf, sondern hatte eine lange Entwicklung und hing zunächst mit der Entwicklung des Kurwesens zusammen. Mit der Zeit wuchs das Interesse an der Erholung in einzelnen Gebäuden, die sich in der Nähe der Natur befinden. Die Entstehung des Aufenthaltes in Wochenendhäusern ist mit der Tramping-Bewegung verbunden, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu uns kam. Wochenendhäuser wurden im Gegensatz zu Häusern zum Zweck der Freizeitgestaltung, der Selbstverwirklichung und vor allem der Zufriedenheit ihrer Besitzer und Erbauer zugleich erfunden und gebaut. Die Ursprünge der Wochenendhäuser liegen im 19. Jahrhundert, als vor allem Städter und Angehörige der Mittelschicht begannen, ihre Freizeit auf dem Land zu verbringen. Wochenendhäuser als Erholungsform entwickelten sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, bedingt durch die Entvölkerung des Landes und insbesondere durch die Abwanderung der Deutschen aus den Grenzgebieten. Zu dieser Zeit war die Tradition, die Freizeit und Erholung in der Natur, in Hütten und anderen Erholungseinrichtungen zu verbringen, in unserem Gebiet bereits stark verwurzelt. Dieser Trend wurde durch den aufkommenden Sozialismus weitgehend verstärkt und weiterentwickelt. Ende der 1950er Jahre erschien die erste der sozialistischen Formen der sogenannten Massenerholung für Arbeiter.
Neben dem Wandern sind auch Radfahren und Radwanderungen sehr beliebt. In den 1990er Jahren gab es einen Mountainbike-Boom, der die Art des Besuches in der Natur veränderte. Im tschechischen Touristenklub wurde eine Radfahrersektion eingerichtet und spezielle Markierungen für Rad- und Wanderwege eingeführt. Eine Reihe von asphaltierten Radwegen wurde in zuvor wenig betroffenen Gebieten gebaut. Radwege werden oft an den Ufern von Flüssen und Bächen angelegt, wo sie einen schwerwiegenden Eingriff in die Ufer darstellen (Zerstörung der Vegetation, des Reliefs und des Felsens und oft auch der Natürlichkeit des Baches selbst) und die natürlichen Wege der Wildtiere zum Wasser kreuzen.
Die Berge (Gesenke, Beskiden) werden zu jeder Jahreszeit für Erholungsaktivitäten genutzt. Ursprünglich diente das Skifahren als Transportmittel, aber im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde es allmählich zu einem beliebten Sport und einer Freizeitbeschäftigung. Aufgrund des großen Interesses am Wintersport wurde der Skiinfrastruktur große Aufmerksamkeit geschenkt. Vielerorts haben mit dem Wintersport verbundene Bauten den Charakter der Berglandschaft verändert (Skipisten, Skilifte, Seilbahnen, Parkplätze, Freizeiteinrichtungen, auch die künstliche Beschneiung ist ein Problem).

Gewässer, sowohl fließende als auch stehende, geflutete Steinbrüche und Sandgruben werden seit jeher zur Entspannung genutzt. Eng mit dem Wasser verbundene Aktivitäten sind die Fischerei und der Wassertourismus. Das Reiten ist noch nicht weit verbreitet, doch die Auswirkungen auf Natur und Landschaft können in der Nähe von Reitgebieten deutlich werden. Direkte Schäden an der Natur sind in der Regel vernachlässigbar (Zertreten von Pflanzen). Motorradfahren hingegen ist eine sehr problematische Aktivität mit einer Reihe von negativen Auswirkungen auf die Natur und die Struktur der Landschaft (Lärm, Emissionen, Austreten von Kraftstoff, Erosion, Zerstörung von Organismen, Fragmentierung der Landschaft usw.). Die Freizeitnutzung von Geländewagen, Motorrädern, Quads oder Schneemobilen oder Jetskis schädigt die verschiedenen Bestandteile der Natur erheblich. Das illegale Fahren abseits der Straße in der Landschaft (sog. wildes Motocross) nimmt zu; dieses Problem wird vor allem in den Landschaftsschutzgebieten Beskiden, Gesenke und Poodří modelliert. Besonders in Landschaftsschutzgebieten und Naturschutzgebieten ist es notwendig, bei allen Erholungsaktivitäten bestimmte Auflagen zu beachten, um Schäden an der Landschaft und der Natur zu vermeiden.
4. BEVÖLKERUNG
INHALT DES KAPITELS
4.1 Bevölkerungsentwicklung 1869-1910
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.2 Bevölkerungsentwicklung 1921-1980
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.3 Bevölkerungsentwicklung 1991-2019
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.4 Bevölkerung nach Geschlecht und Alter 1869-1910
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.5 Bevölkerung nach Geschlecht und Alter 1920-1980
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.6 Bevölkerung nach Geschlecht und Alter 1991-2019
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.7 Bevölkerung nach Religion 1869-1950
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.8 Bevölkerung nach Religion 1991-2011
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.9 Bevölkerung nach Verkehrssprache 1880-1910
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU)
4.10 Bevölkerung nach Sprachen in Schlesien 1910 154
PaedDr. Zbyšek Ondřeka (ACC)
4.11 Nationalität der Bevölkerung 1918-1991
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.12 Einwanderungstrends zwischen 1869 und 1910
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.13 Zusammensetzung der Nationalitäten 1991-2011
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.14 Ausländer 1991-2020
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.15 Ureinwohner (Anteil der autochthonen Bevölkerung)
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.16 Migration im 21. Jahrhundert (2001-2019)
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.17 Natürlicher Anstieg im 21. Jahrhundert (2001-2019)
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.2 Bevölkerungsentwicklung 1921-1980
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.3 Bevölkerungsentwicklung 1991-2019
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.4 Bevölkerung nach Geschlecht und Alter 1869-1910
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.5 Bevölkerung nach Geschlecht und Alter 1920-1980
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.6 Bevölkerung nach Geschlecht und Alter 1991-2019
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.7 Bevölkerung nach Religion 1869-1950
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.8 Bevölkerung nach Religion 1991-2011
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.9 Bevölkerung nach Verkehrssprache 1880-1910
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU)
4.10 Bevölkerung nach Sprachen in Schlesien 1910 154
PaedDr. Zbyšek Ondřeka (ACC)
4.11 Nationalität der Bevölkerung 1918-1991
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.12 Einwanderungstrends zwischen 1869 und 1910
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU), prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (OU), doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (OU)
4.13 Zusammensetzung der Nationalitäten 1991-2011
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.14 Ausländer 1991-2020
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.15 Ureinwohner (Anteil der autochthonen Bevölkerung)
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.16 Migration im 21. Jahrhundert (2001-2019)
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.17 Natürlicher Anstieg im 21. Jahrhundert (2001-2019)
doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC), PhDr. Andrea Hrušková (ACC)
4.1 Bevölkerungsentwicklung 1869-1910
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Gebiet der sich schnell entwickelnden Schwerindustrie, d.h. die Gerichtsbezirke Fryštát, Bohumín, Polská und Moravská Ostrava, zu einer Region mit einem hohen Bevölkerungswachstum. In den Jahren 1869-1910 verdoppelte oder verdreifachte sich die Bevölkerung. In den übrigen Teilen Schlesiens und Nordostmährens war das Wachstum deutlich geringer oder sogar rückläufig. Der geringe Bevölkerungszuwachs bzw. -rückgang fand vor allem in den Ausläufern des Gesenkes und der Beskiden statt, wo der arme Boden die wachsende Bevölkerung nicht ernähren konnte, so dass vor allem junge Leute wegzogen, um Arbeit zu finden.
Die Bevölkerung der Gerichtsbezirke Polská Ostrava und Moravská Ostrava wuchs schnell, und auch die Bezirke Bohumín und Fryštát breitet sich sehr dynamisch aus. Dieses Territorium stellte das sich bildende Ostrava-Karviná Industriegebiet, das zu den Gebieten mit der höchsten Bevölkerungskonzentration in der österreichischen Monarchie gehörte. Selbst einige der ursprünglich kleinen Dörfer wuchsen so sehr, dass sie an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert den Status von Städten erlangten. Drei von ihnen bildeten später zusammen mit der Stadt Moravská Ostrava und der Stadt Polská Ostrava den Kern des sog. Groß-Ostrava (Vítkovice, Přívoz und Mariánské Hory), aber auch die Dörfer in der Nähe von Fryštát, wie z.B. Karviná, Ráj, Staré Město, Darkov usw., waren schnell wachsende Ortschaften. Ein ähnlich schnelles Wachstum erlebte damals auch ein Dorf, das etwas entfernt vom Kern des Industriegebiets lag - Třinec. Aus dem ursprünglich kleinen Dorf unter den Beskiden wurde vor dem Ersten Weltkrieg mit der Entwicklung der Eisenhütten und der Umsiedlung vieler Menschen auf der Suche nach Arbeit eine Ortschaft mit fast 4.000 Einwohnern. Der Anschluss an das Industriegebiet Ostrava-Karviná bedeutete daher auch für die angrenzenden Gerichtsbezirke Těšín und Klimkovice einen erheblichen Bevölkerungszuwachs. In den weiter entfernten Bezirken (Opava, Bílovec, Příbor, Místek, Frýdek, Jablunkov, Skočov, Strumieň) gab es keinen so bedeutenden Zuwachs, aber es gab trotzdem ein Wachstum, weil der Bevölkerungsüberschuss in das Industriegebiet zur Arbeit gehen konnte. Man spricht vom sog. breiteren Bevölkerungshintergrund des Ballungsraumes Ostrava-Karviná.
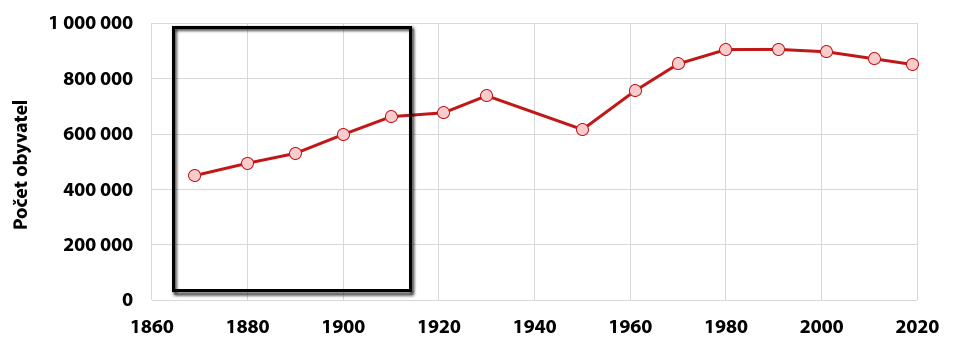
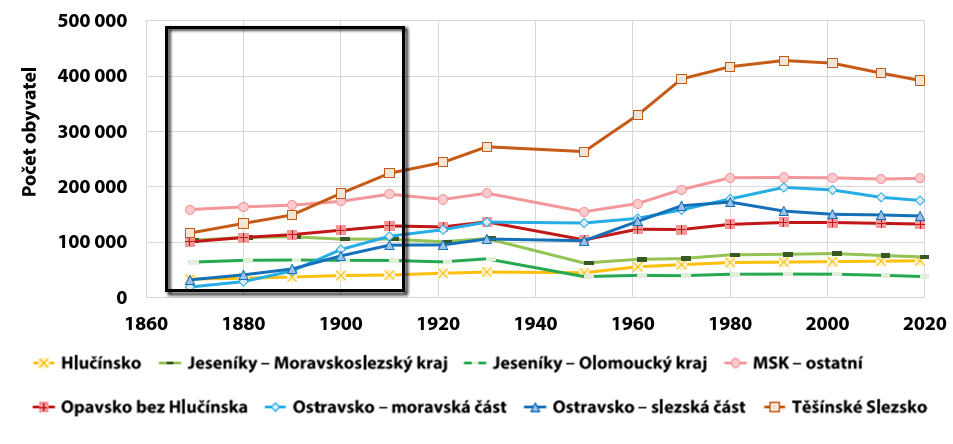
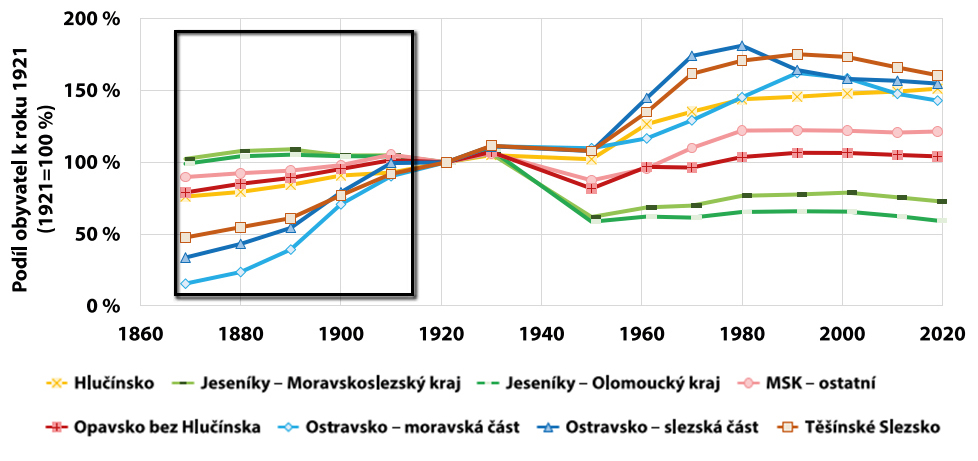
Ein gewisses Bevölkerungswachstum war auch in den Gerichtsbezirken Bílsko, Nový Jičín, Krnov, Jeseník und Vrbno zu verzeichnen. In diesen Fällen war der Grund nicht die Industrie von Ostrava-Karviná und ihr Arbeitsplatzangebot, sondern das Wirtschaftswachstum selbst, insbesondere in den Hauptzentren dieser Bezirke. Die Städte Bílsko, Nový Jičín und Krnov gehörten zu den wichtigsten Textilzentren in Mähren und Schlesien. Auch in der textilindustriellen Produktion stand Jeseník nicht zurück, außerdem entwickelten sich in seiner Umgebung bedeutende Kurzentren (Gräfenberg, Lipová). Ansonsten aber war der westliche Teil Österreichisch-Schlesiens eine Region mit stetigem Bevölkerungsrückgang. Die entvölkernden Bezirke waren vor allem die Gerichtsbezirke Javorník, Jindřichov, Osoblaha und Albrechtice. Das geringe natürliche Wachstum in diesen Bezirken wurde durch die langfristige Abwanderung junger Menschen im produktiven Alter, die als deutschsprachige Einwohner zur Arbeit nach Niederösterreich, vor allem nach Wien, gingen.
Es war bezeichnend, dass sowohl die Beschleunigung des Bevölkerungswachstums in der industriellen Agglomeration als auch der Bevölkerungsrückgang im nordwestlichen Teil Österreichisch-Schlesiens hauptsächlich in den 1880er und 1890er Jahren stattfand. Das Hauptmerkmal, das in den Teilgebieten Ostrau-Mähren, Ostrau-Schlesien und Teschen-Schlesien zu sehen ist, war dann der relative Anstieg von etwa 20-40 % auf 100 % bis 1921. Im Teilgebiet Ostrau-Mähren gab es zwischen 1880 und 1900 einen Anstieg von fast 47 Prozentpunkten.

4.2 Bevölkerungsentwicklung 1921-1980
Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung war die Zeit der Ersten Republik durch ein stabiles und moderates Wachstum in allen Teilen Tschechisch-Schlesiens und den angrenzenden mährischen Gebieten gekennzeichnet. Der Zweite Weltkrieg und die Vertreibung der deutschen Bevölkerung, die vor allem die Region des Gesenkes betraf, beeinflusste diese Entwicklung erheblich. Obwohl das Gebiet wieder bevölkert wurde, konnten die Verluste nicht wieder aufgeholt werden, und 1980 lag die Bevölkerung um etwa 25 % niedriger als im Jahr 1921. Andere Teile Tschechisch-Schlesiens und die angrenzenden mährischen Gebiete hingegen erlebten während der Zeit der kommunistischen Herrschaft ein stetiges Wachstum, vor allem der schlesische Teil von Ostrava Region, Teschener Schlesien und der mährische Teil von Ostrava Region. Die sozialistische Industrialisierung begünstigte die Schwerindustrie, die sich in diesen Regionen konzentrierte, so dass vor allem in den 1950er und 1960er Jahren eine große Zahl von Menschen dorthin zog.
Zwischen 1921 und 1930 erlebten alle Teile von Tschechisch-Schlesien und nordöstlichen Mähren ein leichtes Bevölkerungswachstum, was aber vor allem auf die ersten Nachkriegsjahre zurückzuführen ist, in denen die Geburtenrate kurzzeitig anstieg, um die vorangegangene Periode zu kompensieren (in den Jahren 1920-1921 betrug sie in Schlesien sogar 30,9 ‰). In den späteren Jahren der Ersten Republik waren die Auswirkungen des so genannten demographischen Überganges - die bewusste Einschränkung der Geburtenrate - bereits voll sichtbar. Trotz relativ günstiger Sterblichkeitsraten nahm die Bevölkerung nicht wesentlich zu, und auch die Zuwanderung war nicht signifikant. Ostrava und Teschener Schlesien verzeichneten ein Wachstum von 11 %, andere Regionen bis zu 10 % und die Region Hlučín am wenigsten (5 %).
Zwischen 1930 und 1950 kam es zu einem erheblichen Bevölkerungsrückgang als Folge des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsabwanderung der deutschen Bevölkerung. Die Bevölkerung von Tschechisch-Schlesien und nordöstlichen Mähren war von den Kriegsverlusten direkt betroffen, da ein Großteil des Gebietes annektiert wurde zum Deutschen Reich und eine große Anzahl von Männern musste sich melden. Dies betraf sowohl die deutsche als auch die teilweise slawischsprachige Bevölkerung aus Hlučín und Těšín. In ganz Tschechisch-Schlesien sank die Bevölkerung zwischen 1930 und 1950 um 16,5 %, aber während Ostrava, Hlučín und Teschener-Schlesien einen relativen Rückgang von nur 1-3 % verzeichneten, Opava um 25 % und die Region Gesenke um 60 %; im Fall von Gesenke, das zur Mährisch-Schlesische Region gehört, sank die Bevölkerung von 106 757 auf 62 456, und im Fall von Gesenke - Teil der Olmützer Region - von 70 092 auf 37 881. Der mährische Teil der Mährisch-Schlesischen Region (MSK - Sonstige) erlebte ebenfalls einen deutlichen Rückgang (um 19 %), da er die Regionen Nový Jičín und Šternberk mit einer relativ großen deutschen Minderheit umfasste, die ebenfalls angesiedelt wurde. So kam es z. B. im Gerichtsbezirk Fulnek zu einem Rückgang um 27 %, im Bezirk Město Libavá um 51 %, im Bezirk Místek aber nur um 6 %, und im Bezirk Frenštát p.R. war die Bevölkerung von 1950 fast identisch mit der von 1930 (relativer Anstieg um 0,7 %). Auch die jüdische Bevölkerung und die Roma trugen zum Rückgang der Bevölkerung während des Krieges bei. Die jüdischen Gemeinden konzentrierten sich vor allem in schlesischen Städten, wobei die größten jüdischen Kultusgemeinden in den Gemeinden des mährischen und schlesischen Teiles der weiteren Region Ostrava existierten. Die Nazis verkündeten die so genannte Endlösung der Judenfrage und führten in deren Rahmen einen Völkermord durch. Jüdische Familien wurden in der Regel in das Ghetto Theresienstadt und von dort in eines der Konzentrationslager, oft Auschwitz, überführt. Auch die Roma sind dort gelandet.
Während der gesamten Zeit des kommunistischen Regimes war es nicht möglich, die Region des Gesenkes so zu besiedeln, dass die Einwohnerzahl mindestens den Stand von 1921 erreichte. Die Bevölkerung wuchs zwar, aber dies war vor allem auf natürliche Veränderungen zurückzuführen, denn seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ging die Sterblichkeitsrate in den böhmischen Ländern dank der Antibiotika rapide zurück. Die Geburtenrate war ebenfalls rückläufig, aber in den 1970er Jahren kam es zu einem "Bevölkerungsboom", der die Bevölkerung der Region Gesenke deutlich ansteigen ließ (um 7 Prozentpunkte im heutigen Mährisch-Schlesischen Kreis und um 4 Prozentpunkte in der Olmützer Region). Dennoch betrug die Bevölkerung in diesen beiden Gebieten 1991 nur 78 bzw. 66 % des Wertes von 1921. Andere Gebiete in Tschechisch-Schlesien und nordöstlichen Mähren entwickelten sich wesentlich günstiger. Schon in den 1950er Jahren wuchs ihre Bevölkerung, so dass Opava und die mährischen Teile der Mährisch-Schlesischen Region bis 1961 fast die gleiche Einwohnerzahl wie 1921 erreichten, während Hlučín, Ostrava und Teschener-Schlesien eine viel größere Bevölkerung hatten. Dies war vor allem auf die beträchtliche Abwanderung junger Menschen im arbeitsfähigen Alter nach Ostrava und Karviná zurückzuführen, wo sie von der Fülle an Arbeitsplätzen in der Schwerindustrie und der starken sozialistischen Propaganda angezogen wurden, die versuchte, Arbeitnehmer in den Bergbau, die Metallurgie, die chemischen Betriebe usw. zu locken. Obwohl sich dieser Zustrom Anfang der 1960er Jahre verlangsamte, führte die fortschreitende Zusammensetzung der Bevölkerung zu einem weiteren Wachstum, und bis 1980 betrug das relative Wachstum im Vergleich zu 1921 in Hlučín 44 %, im mährischen Teil von Ostrava 45 %, im Teschener Schlesien 71 % und im schlesischen Teil von Ostrava sogar 81 %. Der Anstieg erfolgte weniger in den Industriezentren als in den umliegenden Gebieten. Im schlesischen Teil von Ostrava wuchs die Bevölkerung im Gerichtsbezirk Klimkovice in den 1950er Jahren am stärksten (von 25 920 auf 69 147, d.h. um fast 167 %), während im ehemaligen Gerichtsbezirk Schlesisch-Ostrau ein Rückgang von 13 % zu verzeichnen war. Zum Gerichtsbezirk Klimkovice gehörte jedoch die Ortschaft mit dem vielleicht bedeutendsten sozialistischen Aufbau in Ostrava - Poruba, die 1953 dem neu gebildeten Bezirk Ostrava-Region angegliedert wurde. Gleichzeitig stieg die Bevölkerung des Bezirks Český Těšín deutlich an (um fast 80 %), der nicht nur von der Nähe der Karviná-Gruben profitierte, sondern auch von der Existenz des bedeutenden Hüttengiganten Trzynietzer Eisenwerk auf seinem Gebiet.
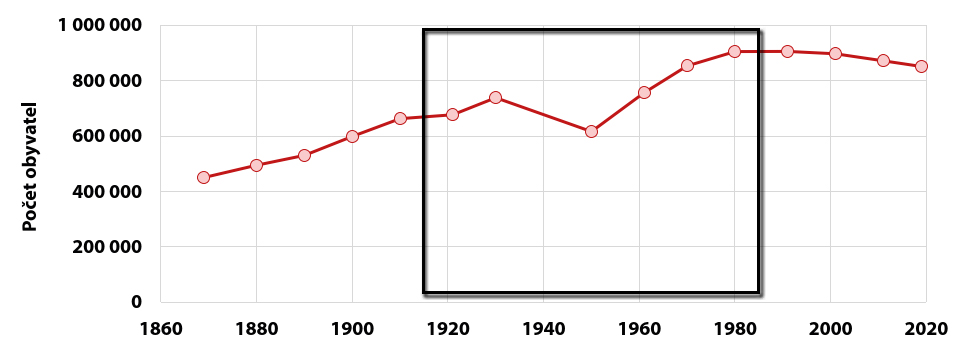
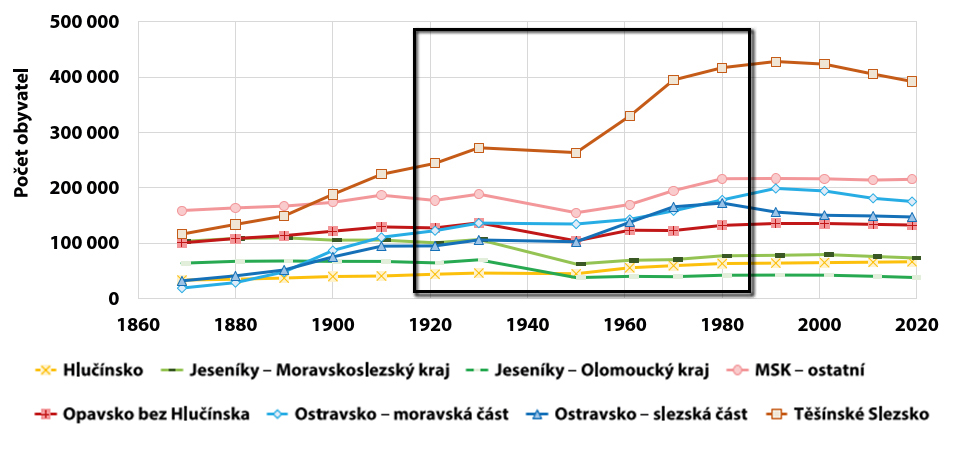
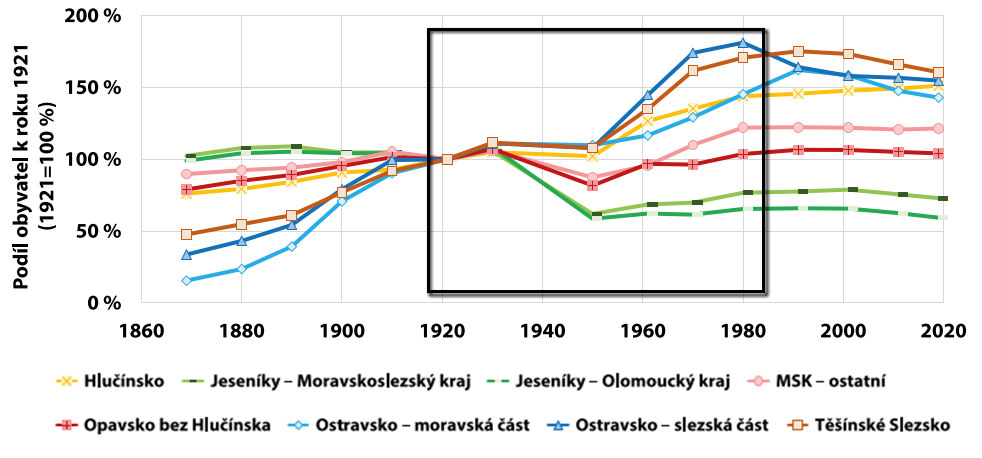
4.3 Bevölkerungsentwicklung 1991-2019
Im Jahr 1991 lebten 905 366 Einwohner auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien. Historisch gesehen ist dies die größte Einwohnerzahl in diesem Gebiet, genauer gesagt von 1869 bis 2019. Von 1990 bis 2019 ist ein leichter Rückgang der Einwohnerzahl um ca. 54,5 Tsd. zu verzeichnen.
Die oben genannten Prozesse beeinflussen die Bevölkerungsentwicklung der einzelnen Teilgebiete. Die Industrialisierung und Deindustrialisierung ist in der Region Teschener-Schlesien am stärksten ausgeprägt, die von 1991 bis 2019 den größten Bevölkerungsrückgang von 36 000 Personen zu verzeichnen hat. Dieser Rückgang ist auch in anderen Teilgebieten vorhanden, mit Ausnahme der Region Hlučín, die einen leichten Anstieg der Bevölkerung aufweist. In Bezug auf die Verteilung der Bevölkerung im Territorium überwiegen die Prozesse der Suburbanisierung, d.h. der Umzug ins Umland der größeren Städte. Diese Tatsache spiegelt sich auch in einem positiven Anstieg der Bevölkerung in der Region Hlučín wider, der vor allem durch den Prozess der Einwanderung von Einwohnern aus Ostrava verursacht wurde.
Die Entwicklung der Bevölkerung in Gesenke Region ist sowohl in der Subregion, die zur Olmützer Region gehört, als auch in der Subregion, die zur Mährisch-Schlesischen Region gehört, ähnlich. In der Olmützer Region war die Bevölkerungszahl im Jahr 2019 fast genauso hoch wie im Jahr 1950, was zeigt, dass der Prozess des Bevölkerungsrückgangs diese Region intensiver betrifft als die Regionen Bruntál und Krnov. Hinsichtlich der Zufriedenheit der Einwohner mit der Lebensqualität im Gesenke gibt es Unterschiede zwischen diesen Gebieten, wobei in der Mährisch-Schlesischen Region mehr zufriedene Einwohner leben als in der Olmützer Region. Diese Tatsache beeinflusst auch die Stabilität der Siedlung und die Bereitschaft der Bewohner, das Gebiet zu verlassen.
Alle Städte mit mehr als 10 000 Einwohnern auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien verlieren seit 1991 bis 2019 an Bevölkerung, was eine Manifestation der Heterogenisierung der Bevölkerung ist, d.h. die ungleiche Verteilung der Bevölkerung auf dem Gebiet wächst. Für die Gemeinden auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien ist die Zugehörigkeit zur Agglomeration Ostrava wesentlich. Die Metropole hat einen primären Einfluss auf die Gemeinden, die in die Agglomeration Ostrava fallen. In der Nähe der Agglomeration gibt es Gemeinden mit einem sekundären Einfluss und andere Gemeinden sind indirekt von der Agglomeration betroffen. Die Agglomeration Ostrava ist eines der am stärksten urbanisierten Gebiete in der Tschechischen Republik. Der Prozess der Bevölkerungskonzentration im Hinterland von Ostrava fand vor allem in der Zeit von 1869 bis 1980 statt. Die stärkste Bevölkerungskonzentration gab es während der ersten Welle der Industrialisierung, also zwischen 1869 und 1950. Anschließend war der Konzentrationsprozess schwächer. Zwischen 1991 und 2011 hat sich die Bevölkerungsverteilung erneut verändert. Deindustrialisierung und Suburbanisierung verursachten eine neue Art der Bildung des Gebietes mit der höchsten Bevölkerungskonzentration (d.h. Ostrava und sein Hinterland), dieser Prozess wird als "dezentralisierte" Konzentration bezeichnet (Hruška, 2012). Am intensivsten ist dieser Prozess in den Städten auf dem Gebiet von Schlesien.
Seit 1971 ist die Zahl der Gemeinden in der Tschechischen Republik zurückgegangen, wobei die niedrigste Zahl der Gemeinden im Jahr 1981 erreicht wurde. Eine weitere bedeutende Änderung trat 1991 ein, als eine größere Anzahl von Gemeinden durch Abtrennung von den größeren Städten entstand. entstand. Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich natürlich auch auf dem Gebiet von In der Tschechischen Republik ist die größte Anzahl von Gemeinden in der Größenkategorie bis zu 500 Einwohnern, und das Gebiet von Tschechisch-Schlesien ist in dieser Kategorie ganz anders. Die größte Anzahl von Gemeinden befindet sich in der Größenkategorie von 1 000-2 999 Einwohnern und in der Kategorie von 500-999 Einwohnern. Diese beiden Kategorien machen zusammen 57 % aller Gemeinden auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien aus.
Auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien lebt eine bedeutende Mehrheit der Einwohner in Städten mit mehr als 20 Tausend Einwohnern, 63% der Bevölkerung. In der Tschechischen Republik leben nur 42 % der Bevölkerung in diesen Gemeinden, während 8 % der Bevölkerung in kleinen Gemeinden mit bis zu 500 Einwohnern leben. In Schlesien leben nur 1,8 % der Bevölkerung in Gemeinden mit bis zu 500 Einwohnern.
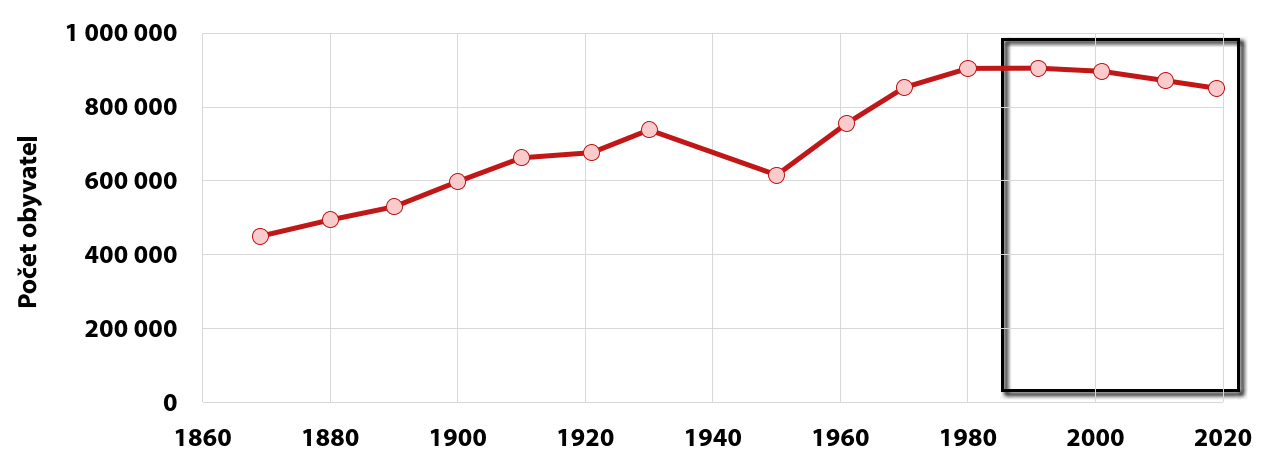
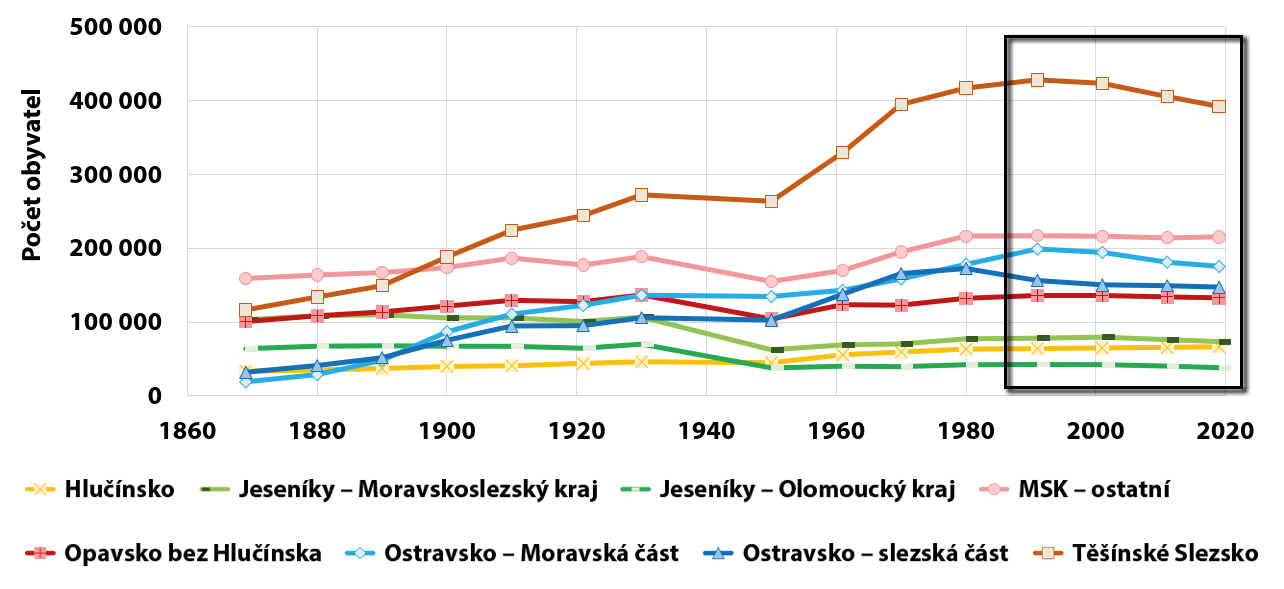

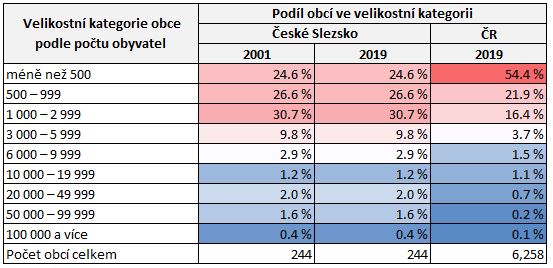
Tabelle 4.2: Anteil der Bevölkerung in den Größenkategorien der Gemeinden nach Einwohnerzahl in Tschechisch-Schlesien und der Tschechischen Republik in den Jahren 2001 und 2019
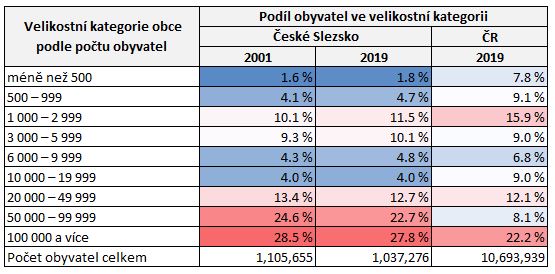
4.4 Bevölkerung nach Geschlecht und Alter 1869-1910
Die Bevölkerung ist im Allgemeinen mehr weiblich; obwohl mehr Jungen als Mädchen geboren werden (etwa 1.060 zu 1.000), gibt es typischerweise eine höhere Kindersterblichkeitsrate, und Frauen erreichen auch ein höheres Lebensalter. Andere Faktoren, insbesondere die Migration, haben das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ebenfalls beeinflusst. Wenn das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in ganz Österreichisch-Schlesien (das so genannte "Männer-Frauen-Verhältnis") nicht das gleiche ist wie im Rest des Landes, dann hat auch die Migration von Frauen eine Rolle gespielt. Bei der Volkszählung im Jahr 1900 betrug das Verhältnis von 1.000 Männer auf 946 Frauen, aber im Industriegebiet von Fryštát und Ostrava nahm die Männlichkeit der Bevölkerung aufgrund der intensiven Zuwanderung von meist jüngeren Männern deutlich zu (1.149 Männer auf 1.000 Frauen im Jahr 1900); in anderen Teilen der Region finden wir jedoch ein Übergewicht der Frauen, am deutlichsten im nordwestlichen Teil von Österreichisch-Schlesien in Bruntál, Jeseníky und Krnov Regionen (nur 895 Männer auf 1000 Frauen im selben Jahr).
Hinter den Durchschnittswerten verbergen sich jedoch zunehmend deutliche lokale Unterschiede. Während in Ostrava und Frýdek mit der sich entwickelnden Bergbau- und Hüttenindustrie und in Frýdek und Bílsko mit der blühenden Textilindustrie der Anteil der Kinder an der Bevölkerung mit fast 40 % hoch blieb, war er in Westschlesien zu dieser Zeit bereits deutlich rückläufig, z.B. in Bruntál, Jesenik und Krnov betrug der Anteil der Kinder an der Bevölkerung nur noch etwas mehr als ein Drittel. Am niedrigsten war der Anteil der Kinder in der Hauptstadt von Österreichisch-Schlesien, Opava (nur 29,4 %), wo andererseits die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-59) mehr als zwei Drittel der Bevölkerung ausmachte (67,9 %). Das Durchschnittsalter war in allen oben genannten Teilen Österreichisch-Schlesiens am höchsten - über 27 Jahre - und lag etwa vier Jahre höher als in den industrialisierten Regionen Fryštát und Ostrava. Allerdings war die Bevölkerung in diesen Teilen der Region noch relativ jung, mit einem relativ geringen Anteil an der Gruppe der älteren Menschen.
In den folgenden Jahrzehnten begann sich die Situation zu ändern und der Unterschied zwischen der Bevölkerungsstruktur des wirtschaftlich stagnierenden westlichen (Opava) Teiles Schlesiens und des sich entwickelnden östlichen (Těšín) Teiles wurde immer deutlicher. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts verursachte die langsam sinkende Bevölkerungszahl keine signifikanten Veränderungen in der Repräsentation der jungen Generation, aber es gab signifikante Unterschiede in den Anteilen der älteren Gruppe. Dies lag auch an der raschen Überalterung der Bevölkerung des nordwestlichen Teiles von Österreichisch-Schlesien, insbesondere der weiblichen Gruppe, als Folge der hohen Abwanderung jüngerer Menschen, die am schwierigsten sind betraf die überwiegend deutsche Bevölkerung von Bruntál, Jeseníky und Krnov Regionen, aber betraf ganz Opava-Schlesien, vielleicht mit Ausnahme von Klimkovice, das mit dem Industriegebiet Ostrava verbunden ist. Höhere Anteile an Kindern gab es vor allem in ländlichen Gebieten, während sie in städtischen Gebieten niedriger waren und vor allem vom produktiven Teil der Bevölkerung dominiert wurden. Letztere erreichte 1910 in den statutarischen Städten Opava und Bílsko 70 %, ähnlich auch in Těšín, Moravská Ostrava und Vítkovice. Wenn die Gesamtbevölkerung Österreichisch-Schlesiens, vor allem dank des Teschener-Teiles, insbesondere Fryštát, vor dem Ersten Weltkrieg noch einen relativ großen Anteil der Kinderkomponente und nur einen leicht steigenden Anteil der Seniorengruppe behielt, so zeigte sich in den städtischen Zentren, dass ihre Bevölkerung bereits vom demographischen Übergang betroffen war und sich auf den Weg des Wandels von einem progressiven zu einem stagnierenden, d.h. stagnierenden Bevölkerungstyp begeben hatte.
4.5 Bevölkerung nach Geschlecht und Alter 1920-1980
Nach dem Ersten Weltkrieg fehlten in der Bevölkerung vor allem Männer im erwerbsfähigen Alter. Heirats- und Geburtenraten fielen nach einem kurzen Aufschwung wieder, und es wurden nur wenige Kinder geboren. Dennoch betrug der Anteil der Kinder an der Bevölkerung in Tschechisch-Schlesien im Jahr 1921 noch 31,2 %, der bis 1930 auf 27,9 % sank. In den Regionen Opava oder Krnov machten sie weniger als ein Viertel der Bevölkerung aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Altersstruktur in den ehemals deutschen Gebieten von Krnov, Bruntál und Jeseniky Regionen, wo junge Familien zuzogen, relativ günstig, so dass der Anteil der Kinder um 1950 fast ein Drittel betrug. In anderen Teilen Schlesiens hingegen setzte sich der Prozess der Überalterung der Bevölkerung fort. Auch die kürzere Periode des Geburtenwachstums in den 1970er Jahren, die so genannten Husák-Kinder, änderte nichts am Gesamttrend, wobei der Anteil der über 65-Jährigen stieg und der Anteil der Kinder sank. Bei der Volkszählung 1980 machten Kinder 25 % der Bevölkerung in Tschechisch-Schlesien aus, während der Anteil der Personen über 65 Jahre 10,6 % betrug.
Der Erste Weltkrieg (1914-1918) war ein bedeutender Eingriff in das Leben der Bevölkerung. Mit dem Abzug der jungen Männer auf das Schlachtfeld sank die Heiratsrate und damit auch die Geburtenrate, während der langfristige Rückgang der Sterbefälle gestoppt wurde. Die niedrige Zahl der Geburten führte zu einer tiefen Kerbe in der Alterspyramide, und die Kriegsopfer spiegelten sich in einer geringeren Repräsentation der Männer im Alter von 20-40 Jahren wider. Der Nachkriegsanstieg der Geburtenrate war nur von kurzer Dauer, und bereits in den 1920er Jahren kam es zu einer deutlichen Verringerung des Anteils der Kinder an der durchschnittlichen tschechisch-schlesischen Bevölkerung um drei Prozentpunkte. Bei der Volkszählung von 1930 wurde festgestellt, dass die Bevölkerung in den Regionen Krnov und Opava am niedrigsten war, mit weniger als 24 %, während die höchsten in den Regionen Jablunkov und Hlučín (fast 36 und 32 %).
Die Wirtschaftskrise in der ersten Hälfte der 1930er Jahre hatte einen negativen Einfluss auf die Entwicklung der Bevölkerung. Die schlechten sozialen Verhältnisse führten zu einem Aufschub der Eheschließungen und bald zu einem deutlichen Rückgang der Geburten, was wiederum eine Einkerbung in der Alterspyramide zur Folge hatte. Das Lebensalter der Bevölkerung stieg allmählich an, während der Ersten Republik um etwa neun Jahre, und der Prozess der Überalterung der Bevölkerung schritt voran. Mit dem Münchner Abkommen 1938 wurde das Gebiet der Region zersplittert und in verschiedene Staatsgebilde eingegliedert. Im Gegensatz zur Entwicklung während des Ersten Weltkrieges zeigte die Geburtenkurve nun leicht nach oben; die Bevölkerungssituation wurde u.a. durch die Auswanderung und Flucht der Tschechen aus dem Grenzgebiet während der Besetzung durch Nazi-Deutschland, den Abzug junger Männer aus dem Gebiet an die Front, den Holocaust an den Juden usw. beeinflusst; weder die Größe noch die Zusammensetzung der Bevölkerung während des Krieges lassen sich genauer bestimmen. Nach Kriegsende war die Bevölkerungsentwicklung vor allem durch große Abwanderungsbewegungen geprägt, vor allem durch die Vertreibung der deutschen Bevölkerung durch die Nationalsozialisten. Nach dem Ende des Krieges wurde die Entwicklung der Bevölkerung vor allem durch die starke Migration, am meisten durch die Abschiebung der deutschstämmigen Bevölkerung beeinflusst, die zur Zerschlagung der Tschechoslowakei beigetragen hat. Am deutlichsten wurde dies bei der Besiedlung Westschlesiens - dem überwiegend deutsch besiedelten Jeseniky, Bruntál und Krnov. Vor allem junge Menschen trugen zum Bevölkerungswachstum bei, was sich positiv auf die Alterszusammensetzung auswirkte. In diesem Gebiet nahm der Anteil der Kinder deutlich zu, die Bevölkerungsdichte war deutlich geringer und erreichte wieder ein Drittel, während nicht einmal ein Zwanzigstel der älteren Menschen dort lebte. Aber auch die relativ hohe Geburtenrate trug zur Verbesserung der Alterszusammensetzung bei. Infolgedessen stieg auch der Anteil der Kinder - im Durchschnitt wuchs die Bevölkerung in Tschechisch-Schlesien um drei Prozentpunkte. Die Darstellung der Bevölkerungszusammensetzung in der Alterspyramide ab 1960 verdeutlicht alle Eingriffe in die natürliche Entwicklung: den anfänglichen Rückgang der Jüngsten schon im Zusammenhang mit dem Beginn des Gesetzes zum künstlichen Schwangerschaftsabbruch 1957, den höheren Anteil der Kinder um das 10. Lebensjahr als Folge des Geburtenanstiegs der Nachkriegszeit, den tiefen Einschnitt um das 25. Lebensjahr im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Wirtschaftskrise der 30er Jahre und einen weiteren nach dem 40. Lebensjahr als Folge des Ersten Weltkrieges.

Während die Kindersterblichkeit in den 1960er Jahren weiter zurückging, sank die weibliche Fertilität. Dadurch sank der Anteil der Kinder um vier Prozentpunkte. Am deutlichsten war der Rückgang in Westschlesien, z.B. in Bruntál um 8,4 Prozentpunkte. Auf der anderen Seite stieg die Zahl der Senioren, vor allem in den Regionen Místek, Frýdek und Jablunkov (bereits 11,4 %).
Die Vermehrungsmaßnahmen in den frühen 1970er Jahren halfen, das Leben junger Familien zu verbessern. Das Ergebnis war ein signifikanter, aber kurzlebiger Anstieg der Zahl der geborenen Kinder (die sogenannten Husák-Kinder). Der Anteil der Kinder an der Bevölkerung stieg letztmalig leicht auf ein Viertel des Landesdurchschnitts, aber der lange Prozess der Überalterung wurde nicht gestoppt. Die größte Auswirkung wurde in den Regionen Frýdek und Jablunkov (12 % der Älteren) sowie in der gesamten benachbarten Region Mähren festgestellt. Der Weg zu einer regressiven Bevölkerungsform tat sich immer deutlicher auf.
4.6 Bevölkerung nach Geschlecht und Alter 1991-2019
Die demografische Alterung kann als einer der bedeutendsten langfristigen demografischen Prozesse betrachtet werden, die heute stattfinden. Die meisten europäischen Länder erleben eine signifikante Veränderung in der Alterszusammensetzung ihrer Bevölkerungen. In der Region Tschechisch-Schlesien ist von 1991 bis 2019 ein progressiver Anstieg der Zahl der Senioren zu verzeichnen, insbesondere nach 2000. Durch die Erhöhung des Lebensstandards der Gesellschaft und die Verbesserung der Qualität der Gesundheitsversorgung hat sich die Lebensqualität verbessert und der Lebensstil der Bevölkerung hat sich verändert. Dies spiegelte sich in einer Senkung der Sterblichkeitsrate, einem Anstieg der Lebenserwartung und einem Anstieg des Anteils der Senioren in der Gesellschaft auf 20 % der Bevölkerung von Tschechisch-Schlesien wider, d. h. jeder fünfte Einwohner von Tschechisch-Schlesien ist über 65 Jahre alt. Eine der weiteren Manifestationen der Veränderung des Lebensstils der Bevölkerung nach 1991 ist ein deutlicher Rückgang der Fertilität, der sich in einem Rückgang des Anteils der Kinder auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien manifestiert, der im Jahr 2011 gestoppt wurde.
Darüber hinaus ist bei der Beurteilung des Alterungsprozesses in den Städten eine höhere Intensität der Alterung zu beobachten als in ihrem Umland. Dieser Vorgang wird durch zwei Fakten verdeutlicht. Erstens ziehen Menschen im Alter von 25 bis 35 Jahren mit ihren Kindern in die Ballungszentren von Städten. Im zweiten Fall leben Senioren in städtischen Gebieten aufgrund der besseren Erreichbarkeit aller Dienstleistungen und des weniger körperlich anstrengenden Lebensstils in einem höheren Alter. Aufgrund ihrer Abhängigkeit von sozialen Kontakten rund um ihren Wohnort haben sie ein geringes Bedürfnis, sich zu bewegen. Die Qualität des Wohnumfeldes hat für ältere Menschen eine geringere Priorität als die Befriedigung ihrer täglichen Bedürfnisse und die Verwirklichung ihrer sozialen Kontakte in der Nachbarschaft ihres Wohnortes. Basierend auf soziologischen Untersuchungen wurde kartiert, dass Senioren aufgrund ihrer Erreichbarkeit eine höhere Attraktivität für das Wohnen in Mehrfamilienhäusern mit Aufzügen haben als andere Bewohnergruppen. Eine weitere wichtige Tatsache ist die Menge an sensorischer Stimulation, die die Stadt den Senioren bietet. Es ist eine interessante Beobachtung, dass Senioren gerne in der Nähe von belebteren Orten leben, wo sie das Leben in der Umgebung beobachten und auf die vorbeifahrenden Autos achten, aus Fenstern blicken, vor Häusern sitzen, Passanten ansprechen, eine soziale Blickkontrolle durchführen, die Polizei, den Bürgermeister, die Familie, die Nachbarn über die Situationen informieren, die sie beobachten. Sie sind stets bemüht, den ständigen Fluss des Lebens mit der umliegenden Gemeinschaft zu teilen.
Demografische Prozesse haben langfristige Auswirkungen auf die Gesellschaft und werden durch historische Ereignisse im Gebiet beeinflusst. Die Altersstruktur des heutigen Territoriums von Tschechisch-Schlesien wird immer noch von der Nachkriegsvertreibung der Deutschen, der bevölkerungsfreundlichen Politik nach 1970 und dem Wechsel des politischen Regimes nach 1989 beeinflusst. Die Alterspyramide erfasst die folgenden demografischen Wellen nach Geschlecht. Im Jahr 1991 ist die größte Alterskohorte zwischen 15 und 19 Jahren; es handelt sich um Kinder, die zwischen 1972 und 1976 geboren wurden, d.h. um Husák-Kinder (teilweise beeinflusst durch die pronatale Politik der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei). Diese Kinder wurden in einer großen Alterskohorte geboren, die nach dem Krieg geboren wurde, d.h. sie sind 1991 40-44 Jahre alt. Bei der großen Alterskohorte der Husák-Kinder wiederholte sich diese Situation nicht, da die Menschen nach 1989 ihr Reproduktionsverhalten änderten, was zu einem Rückgang der Geburtenrate führte.
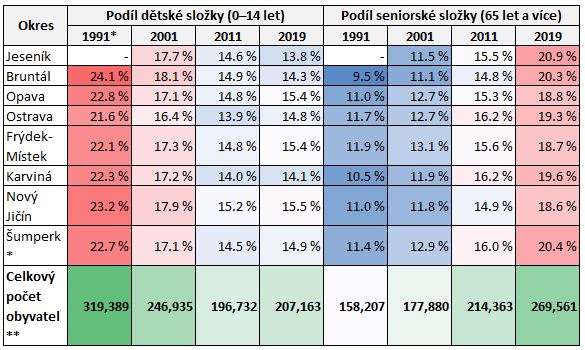
In Bezug auf das Geschlechterverhältnis gibt es ein wiederkehrendes Muster, dass immer mehr Jungen als Mädchen geboren werden, Frauen aber länger leben. Im Vergleich mit den Alterskohorten gibt es in Schlesien verschiedene Anomalien, z.B. in Osoblažsko gibt es einen deutlich höheren Anteil von Männern im Alter von 15-64 Jahren als Frauen. Das liegt an den ungünstigen Lebensbedingungen auf dem Land, wo die Männer bessere Arbeit finden und die Frauen eher in die Städte ziehen. Diese Situation wirkt sich weiter auf die Entwicklung des gesamten Gebietes aus. Einsame Männer entscheiden sich oft dafür, ihre Freizeit gemeinsam in Kneipen zu verbringen und Alkohol zu trinken. Auch in den kleineren Dörfern, in denen sich die Altenheime befinden, ist die Altersstruktur verzerrt. Eine weitere Anomalie manifestiert sich in den Städten mit großen Wohnsiedlungen in den 1950er Jahren, wo die Stadt der sogenannten Jungen zu einer Stadt der Alten wurde (Havířov).
4.7 Bevölkerung nach Religion 1869-1950
Während der Zeit der österreichischen Monarchie zeichnete sich Tschechisch-Schlesien durch eine vielfältigere religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung aus. Neben einer bedeutenden katholischen Mehrheit gab es eine große Minderheit von Protestanten (13-14%, meist Lutheraner, weniger Helvetier), und in einigen Städten waren jüdische Familien konzentriert. Personen, die keiner Religion angehören, wurden nicht erfasst; Menschen anderen Glaubens wurden als Einzelpersonen gezählt. Mähren war katholischer mit nur 2% Protestanten. Die Erste Republik brachte Veränderungen der Staatsgrenzen. Die Anpassungen spiegelten sich in der religiösen Situation in einem leichten Anstieg der Zahl der Katholiken aus Hlučín und einem Rückgang der Protestanten aus dem östlichen Teil von Těšín wider. Die Schrecken des Krieges fanden ihren Ausdruck in der Zunahme der Zahl nichtreligiöser Personen, besonders in den industriellen Zentren und unter der Intelligenz. Die neue tschechoslowakische Kirche, die 1920 gegründet wurde, gewann Anhänger unter der tschechischen Bevölkerung. Der Zweite Weltkrieg war verbunden mit dem Holocaust an den Juden, gefolgt von der Vertreibung der Deutschen, was zu einem bedeutenden Verlust an Katholiken und Protestanten, aber zu einem Anstieg der Mitgliederzahl der Tschechoslowakischen Kirche führte. Die Zahl der Andersgläubigen ist auf Kosten des Anteils der Atheisten gestiegen.
Seit dem Westfälischen Frieden (1648) dürfen Protestanten in Schlesien leben. Die evangelischen Gemeinden konzentrierten sich vor allem in den Bezirken Bílsko und Těšín, wobei die Stadt Těšín ein wichtiges Zentrum war, wo der Anteil der Protestanten zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf 42% angestiegen ist. Im Gerichtsbezirk Jablunkov waren bis zu 46% Protestanten vertreten, in Frýdek über 30%. Das protestantische Siedlungsgebiet erstreckte sich weiter in den Gerichtsbezirken Skočov und Bílsko. In Mähren lebten diese Gläubigen vor allem in den Gerichtsbezirken Fulnek und Nový Jičín. Im 16. Jahrhundert wurden die Juden nach und nach aus Schlesien vertrieben, bis 1752 konnten sich 119 geduldete jüdische Familien im österreichischen Schlesien niederlassen. Die volle Entwicklung des jüdischen Lebens fand ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt. Religiöse Gemeinden wurden in Opava, Krnov, Těšín, Ostrava (für mährische und schlesische Juden aus den umliegenden Ortschaften) und ähnlich in Frýdek und Místek gegründet. Religiöse Vereine wurden in Jeseník, Vidnava, Bruntál, Městě Albrechtice, Jablunkov, Příboř gegründet. Die religiöse Gemeinschaft in Osoblaha war eine lange Kontinuität.
Die Erste Republik war mit einer Reihe von Veränderungen in der Stellung der Kirchen im öffentlichen Bereich und auch im privaten Bereich verbunden. Es gab einen signifikanten Anstieg der Zahl der sogenannten matriarchalen Katholiken, die den Glauben nicht mehr praktizieren, ähnliche Tendenzen haben sich unter den Anhängern des Judentums entwickelt. Die Kreuze verschwanden aus den Schulen, und der Unterricht und sein Ende begannen und endeten nicht mehr mit dem Gebet. Nach dem so genannten "Kleinen Schulgesetz" von 1922 war der Religionsunterricht in den Schulen für Kinder, deren Eltern Mitglied einer staatlich anerkannten Kirche waren, verpflichtend. Im Bereich des Eherechts gab es eine gewisse Liberalisierung - Scheidung und Trennung waren weiterhin erlaubt, und zivile Eheschließungen wurden neben kirchlichen Eheschließungen praktiziert. Die katholische Kirche musste Bestattungen durch Verbrennung zulassen. Im Dezember 1918 fusionierten die tschechischen Protestanten die Augsburger (lutherische) und die helvetische (calvinistische) Konfession zu einer Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, die auf ihrem nationalen Erbe aufbauen wollte. Die deutschen Protestanten bildeten 1919 die selbständige Deutsche Evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien auf der Grundlage des Luthertums. Infolge der Grenzverschiebung stieg der Anteil der Protestanten in den traditionellen Zentren auf tschechischer Seite, vor allem im Gerichtsbezirk Jablunkov und Český Těšín, aber auch in Albrechtice, Krnov, Bohumín, Frýdek, Fryštát und Vítkov. In der Region Jablunkov gab es mehr Protestanten als Katholiken. Die mährischen Gemeinden blieben erhalten. Die neue Kirche der Tschechoslowakei verbreitete sich in folgendem Gebiet, dessen Zentren das industrielle Bohumínsko mit fast 10% der Bevölkerung wurde, aber vor allem der Bergbaugerichtsbezirk Slezská Ostrava, wo 27% der Bevölkerung dieser Kirche angehörten, einige Tausend in Frýdek, Fryštát, Hunderte in Příbor, Opava, Klimkovice, insgesamt über 25.500 Menschen.
Die größte Konzentration nicht-religiöser Menschen bildete sich in den Bezirken Moravská und Slezská Ostrava (7-8%), die das Epizentrum der gesamten Agglomeration Ostrava-Karviná darstellten; hier gab es auch eine Reihe von Bildungs-, Verwaltungs- und Kultureinrichtungen und eine große Konzentration von Arbeitern. In Bohumín, Českotěšín und Klimkovice waren etwa 2 % der nicht religiösen Menschen vertreten. Moravská Ostrava wurde zum wichtigsten Zentrum des Judentums, wo die drittgrößte jüdische Religionsgemeinschaft in den böhmischen Ländern wirkte und eine Reihe von nationalen Veranstaltungen sowie den Zionistischen Weltkongress organisierte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es auf dem gesamten Gebiet zu einem spürbaren Verlust an Katholiken, vor allem in den Regionen Ostrava und Karviná, wo knapp über 70 % der Bevölkerung katholisch waren. Hlučín blieb die katholischste Region mit 98 % der Kirchenmitglieder. Weniger als 50 % der Katholiken waren traditionell in Český Těšín zu finden, das das Hauptzentrum der Protestanten blieb (47 %). Mehr Protestanten lebten auch in Karviná (14 %), Nový Jičín (7,2 %), Vítkov (6,6 %) Regionen, etwa 5 % lebten in den Regionen Bruntál, Krnov, Jeseniky, Rýmařov und insgesamt gab es einen deutlichen Rückgang der Protestanten (von 123 866 auf 88 829). Andererseits gab es einen Zustrom neuer Mitglieder zur Tschechoslowakischen Kirche, die meisten davon in Ostrava (17,3%), über 7% in Karviná, Jeseniky, Krnov, Bruntál und weniger in Bílovec. Überraschenderweise sank die Zahl der Nichtreligiösen, vielleicht als Folge der Vertreibung der Deutschen und der Vernichtung der Juden, aber in Ostrava blieben über 5 %, in Bílovec und Krnov Regionen etwa 3 %, in allen anderen Verwaltungseinheiten waren die Atheisten mit 1,2-2,5 % vertreten. Es gab immer mehr Mitglieder anderer Kirchen, z.B. der orthodoxen. Es ist nicht möglich, aus der Statistik abzuleiten, wie das neue Regime, das mit dem Putsch vom Februar 1948 und dem Sieg der Kommunisten verbunden war und das streng atheistisch war, auf diese Situation "eingewirkt" hat.
Grafik 4.16: Entwicklung der Gläubigen nach Religion in Österreichisch/Tschechisch-Schlesien (1869-2011)
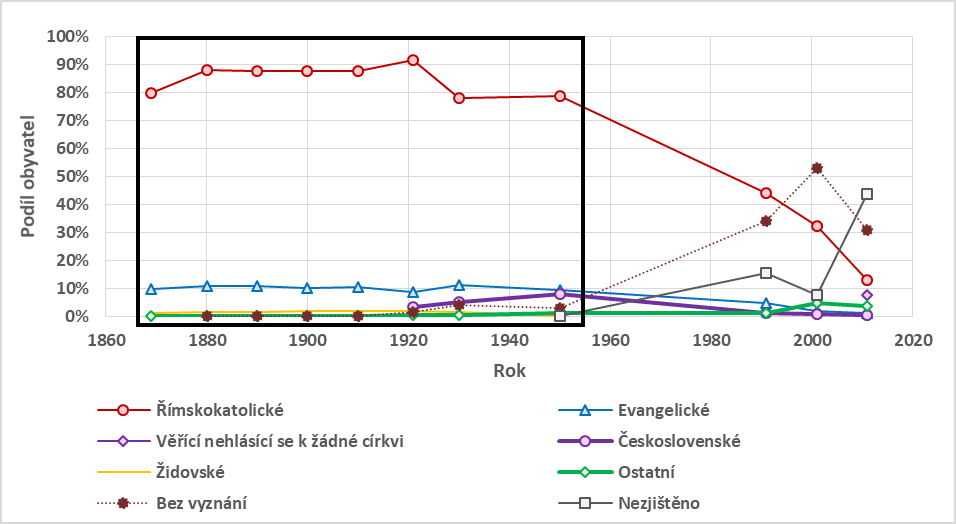
Zum Vergrößern auf das Bild klicken..
Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es auf dem gesamten Gebiet zu einem spürbaren Verlust an Katholiken, vor allem in den Regionen Ostrava und Karviná, wo knapp über 70 % der Bevölkerung katholisch waren. Hlučín blieb die katholischste Region mit 98 % der Kirchenmitglieder. Weniger als 50 % der Katholiken waren traditionell in Český Těšín zu finden, das das Hauptzentrum der Protestanten blieb (47 %). Mehr Protestanten lebten auch in Karviná (14 %), Nový Jičín (7,2 %), Vítkov (6,6 %) Regionen, etwa 5 % lebten in den Regionen Bruntál, Krnov, Jeseniky, Rýmařov und insgesamt gab es einen deutlichen Rückgang der Protestanten (von 123 866 auf 88 829). Andererseits gab es einen Zustrom neuer Mitglieder zur Tschechoslowakischen Kirche, die meisten davon in Ostrava (17,3%), über 7% in Karviná, Jeseniky, Krnov, Bruntál und weniger in Bílovec. Überraschenderweise sank die Zahl der Nichtreligiösen, vielleicht als Folge der Vertreibung der Deutschen und der Vernichtung der Juden, aber in Ostrava blieben über 5 %, in Bílovec und Krnov Regionen etwa 3 %, in allen anderen Verwaltungseinheiten waren die Atheisten mit 1,2-2,5 % vertreten. Es gab immer mehr Mitglieder anderer Kirchen, z.B. der orthodoxen. Es ist nicht möglich, aus der Statistik abzuleiten, wie das neue Regime, das mit dem Putsch vom Februar 1948 und dem Sieg der Kommunisten verbunden war und das streng atheistisch war, auf diese Situation "eingewirkt" hat.
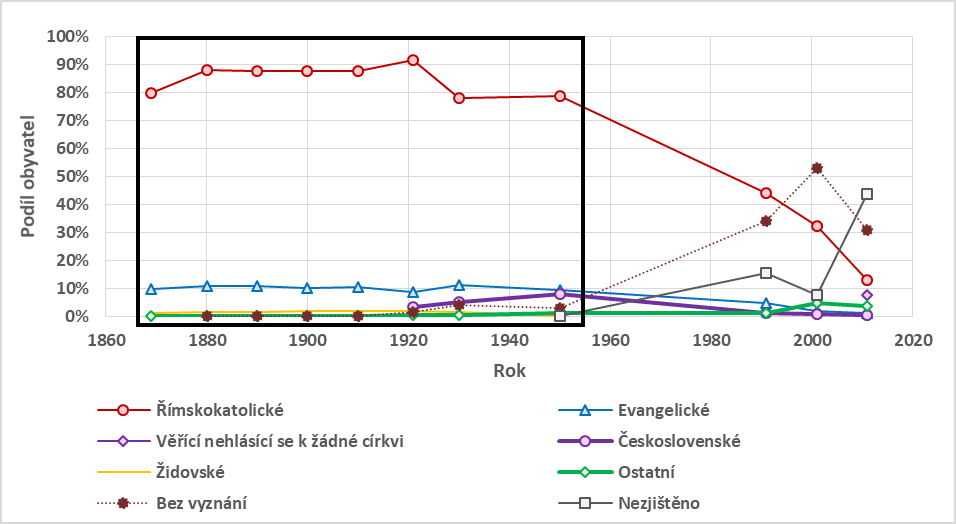
4.8 Bevölkerung nach Religion 1991-2011
Um die Zusammensetzung der Bevölkerung nach Religion zu beurteilen, ist es wichtig festzustellen, dass mit der Entwicklung der demokratischen Gesellschaften der religiöse Pluralismus allmählich zugenommen hat. Zwischen 1991 und 2021 verdoppelt sich die Zahl der beim Kulturministerium der Tschechischen Republik registrierten Kirchen und Religionsgemeinschaften von 19 auf 42 im Jahr 2021 (bzw. 32 im Jahr 2011 bei der SLDB). Ein neueres Phänomen in der Gesellschaft ist die Deinstitutionalisierung der Religion. Menschen betrachten sich selbst als gläubige Katholiken, sind aber keine Mitglieder der römisch-katholischen Kirchengemeinschaft. Im Allgemeinen gibt es ein Drittel der religiösen Menschen im Land, die keiner bestimmten Religion folgen.
Soziologische Untersuchungen zeigen, dass der traditionelle Glaube an Gott in der heutigen tschechischen Gesellschaft nicht sehr verbreitet ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Tschechen komplett atheistisch sind, wie einige Forscher in einer oberflächlichen Interpretation der Daten behaupten. Der Glaube an das Übernatürliche und an religiöse Phänomene ist in der tschechischen Gesellschaft weit verbreitet und sehr beliebt. Die meisten Menschen haben kein Problem damit, an die Fähigkeiten von Mystikern, Orakeln und Heilern oder an die Wirkung von Amuletten und Horoskopen zu glauben. Die Menschen glauben im Allgemeinen, dass einige Heiler Heilungsfähigkeiten von Gott haben, und weniger als 50 % der Befragten, die die erwachsene Bevölkerung repräsentieren, sind der Meinung, dass einige Heiler von Gott gegebene Heilungsfähigkeiten haben, laut ISSP-Umfrage von 2008 (Hamplová, 2010).
Die römisch-katholische Kirche ist die größte religiöse Organisation in der Tschechischen Republik, die laut SLDB im Jahr 2011 über 1 Million Gläubige hatte. Die zweitgrößte ist die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (51 858 Menschen) und die drittgrößte die Tschechoslowakische Hussitische Kirche (39 229). Alle diese Gemeinden haben seit 1991 einen Rückgang erlebt, was u.a. an den relativ älteren Mitgliedern dieser drei Gemeinden liegt. Im Gegenteil dazu hatten kleinere evangelische und charismatische Kirchen (z. B. die Einheit der Brüder, die Kirche der Brüder und die Apostolischen Kirchen) eine günstigere Altersstruktur und erlebten ebenfalls einen Anstieg der Mitgliederzahlen. Die Kirchen haben auch signifikant unterschiedliche Daten in ihrer Mitgliedermeldung in ihren Registern.
Trotz des festgestellten Rückganges der Zahl der Gläubigen, die sich formal zu einem institutionalisierten oder nicht-institutionalisierten Glauben bekannt haben, zeigen repräsentative soziologische Erhebungen eine relative Stagnation des Anteiles der Befragten, die mindestens einmal im Monat einen Gottesdienst besuchen, von 1993 bis 2008 lag dieser bei etwa 10 %. Dieser Indikator wird im Allgemeinen als ein genauerer Indikator für Religiosität angesehen, trotz einiger Einschränkungen aufgrund der Tatsache, dass einige Kirchen weniger Wert auf den Gottesdienstbesuch legen (Hamplová, 2010).
Trotz der oben genannten Interpretationsprobleme ist es angebracht, die räumlichen Unterschiede anhand der Daten aus der SLDB von 2011 zu untersuchen, wo auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien folgende Tatsachen festgestellt wurden:


Die höchsten Anteile von Personen ohne Glauben wurden in Jesenice (beide Teilregionen über 35%) und Ostrava (32,6%) festgestellt.
Die höchste Konzentration von Gläubigen ist in der Region Hlučín (47,1 %), in der Region Opava (27,3 %) und in Teschener Schlesien (29,0 % der Gläubigen sind vor allem in der Region Jablunkov), diese Gebiete zeichneten sich durch den höchsten Anteil an einheimischen Einwohnern aus.
Der größte Anteil der Gläubigen des römisch-katholischen Glaubens befindet sich in den Gemeinden der Regionen Hlučín und Jablunkov (ca. 70-90%), in den Gemeinden des Opava- und Mährischen Keils liegt dieser Anteil meist zwischen 50-70%.
Ein bedeutenderer Anteil von Gläubigen, die sich mit keiner Kirche identifizieren, ist in der Jeseniky Region konzentriert (in einigen Gemeinden mehr als 40 %), während in den Gemeinden Ostrava, Karviná und dem Mährischen Keil dieser Anteil meist zwischen 30-40 % liegt.
Einen Sonderfall stellen die Gläubigen der Schlesischen Evangelischen Kirche des Augsburger Bekenntnisses dar. Sie konzentrieren sich fast ausschließlich in Tschechien in den Gemeinden Třinec und Těšín, ihr Anteil liegt etwa zwischen 10-40%. Sie ist die größte lutherische Kirche in Tschechien. Sie vereint Gläubige sowohl tschechischer als auch polnischer Nationalität.
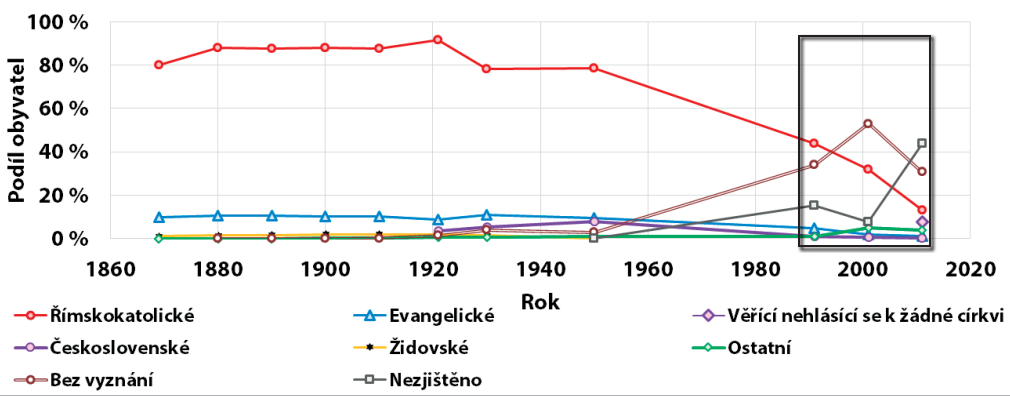
4.9 Bevölkerung nach Verkehrssprache 1880-1910
Drei ethnische Gruppen waren in Österreichisch-Schlesien signifikant vertreten. Nach der Volkszählung von 1880 war fast die Hälfte der Bevölkerung die Deutschen (48,9 %), mit einer dominanten Stellung in westlichen Schlesien und in vielen Städten, 28,1 % waren die Polen, und der kleinste Anteil - 23 % - war die Tschechen, vor allem in Frýdek, Místek und Bílovec. Bis 1910 gab es keine große Veränderung, der Anteil der Deutschsprachigen (43,9 %) ging etwas zurück, vor allem zugunsten der polnischen Bevölkerung (31,7 %) und teilweise auch der tschechischen (24,3 %). Am komplexesten war die nationale Zusammensetzung im Bezirk Těšín, wo die sogenannte Šlonzák-Bewegung dazu beitrug.
Betrachtet man die Entwicklung in den einzelnen Teilen der Region, so finden sich die geringsten Veränderungen bis zum Ersten Weltkrieg in Westschlesien, in den Bezirken Jeseník, Bruntál und Krnov, wo nur einzelne Personen, und zwar am häufigsten in der Region Krnov, stabil behaupteten, eine andere Sprache als Deutsch zu sprechen. Etwas anders war die Situation in der benachbarten Region Opava, wo die tschechische Bevölkerung die deutsche zunächst um einige Prozentpunkte übertraf, wobei der Anteil allmählich zunahm. Nach der Teilung der Region Bílovec als eigenständiger politischer Bezirk war es klar, dass dieser Teil der Region eine Zweidrittelmehrheit der tschechischen Bevölkerung hatte. Anders verhielt es sich jedoch in der Hauptstadt Österreichisch-Schlesiens - Opava, dem Sitz der Landesverwaltung, vieler Ämter, Schulen und Vereine, wo die Deutschen in deutlicher Mehrheit waren und nur etwa jeder Zehnte tschechisch und jeder Zwanzigste polnischsprachig gemeldet war. In den folgenden Volkszählungen stieg der Anteil der deutschsprachigen Bevölkerung, während der Anteil der tschechischsprachigen Bevölkerung sank, und bis zum Ersten Weltkrieg war die polnische Sprache fast vollständig verschwunden.
Die Bevölkerung des mährischen Bezirks Nový Jičín hatte einen gemischten Charakter. Die deutsche Bevölkerung behielt bis zum Krieg ein leichtes Übergewicht, vor allem dank der deutschsprachigen Bevölkerung von Fulnek und den Städten (Nový Jičín, Fulnek), während die Region Příbor überwiegend tschechisch war. Obwohl der Anteil der deutschsprachigen Bevölkerung leicht rückläufig war, überwogen sie über den gesamten Zeitraum (1880: 57,1 %; 42,8 %; 1910 53,0 % : 46,8 %).
Der höchste Anteil der tschechischen Bevölkerung befand sich in der Region Místek (1880 = 88,7 %); zunächst ging der Anteil leicht zurück, aber die Gründung des selbständigen politischen Bezirkes Moravská Ostrava zeigte, dass dies mit der Entwicklung in diesem am meisten industrialisierten Teil der Region stattfand. Während in der Region Místek bei der Volkszählung Weltkrieg 93,2 % der Einwohner angaben, Tschechisch zu sprechen, war die Situation viel schwieriger in der Region Mährisch-Ostrau vor allem durch die Einwanderung, aber auch durch die Germanisierung, einiger Werke, z.B. die Witkowitzer Eisenwerke, stieg der Anteil der deutschen ethnischen Gruppe auf fast zwei Fünftel und der der Polen auf mehr als ein Zehntel. Neben Místek hatte die tschechische Bevölkerung in Frýdek die stärkste Position. Im Gerichtsbezirk Frýdek erreichte ihr Anteil im Jahr 1880 97,5 %. Nach der Bildung eines eigenständigen politischen Bezirkes, der auch die stark von Zuwanderung betroffenen Bergdörfer um das damals polnische (schlesische) Ostrau umfasste, ging die tschechische Bevölkerung zugunsten von Deutschen (1910 = 7%) und vor allem Polen (1910 = 14,8%) zurück. Am härtesten traf die Germanisierung jedoch die Landesstadt Frýdek, wo sich 1880 noch vier Fünftel der Bevölkerung als Tschechen und nur weniger als ein Zwanzigstel als Deutsche bezeichneten, der Anteil der Tschechen aber immer weiter sank und vor dem Krieg nur noch zwei Fünftel betrug.
Fryštát wurde vollständig von der slawischsprachigen Bevölkerung dominiert, mit mehr als der Hälfte der Polen und mehr als einem Drittel der Tschechen. Besonders am Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieses Bergbaugebiet von der Einwanderung, vor allem aus Galizien, aber auch von der gestärkten polnischen Nationalbewegung beeinflusst, so dass die polnische Bevölkerung vor dem Krieg auf eine Zweidrittelmehrheit anwuchs, während nur jeder vierte Einwohner behauptete, Tscheche zu sein.
Die ethnische Zusammensetzung im Bezirk Těšín war am kompliziertesten, auch wegen der Nationalität der lokalen Bevölkerung. Die bei der Volkszählung von 1880 noch mehr als die Hälfte betragende Mehrheit der polnischen Volksgruppe (52,9 %) wuchs allmählich auf drei Viertel im Jahr 1910 (76,8 %) an, und auch der Anteil der Deutschen nahm zu; dazu trug die von Josef Koždon geleitete sog. Šlonzák-Bewegung bei, die die Idee der schlesischen Nationalität mit einer Neigung zum Deutschtum verband. Der Anteil der Tschechen ging proportional zurück (von 39,1 auf nur noch 6,2 %), was aber vor allem auf die Teilung des Gerichtsbezirkes Frýdek zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurückzuführen ist. Die höchste Repräsentation der polnischen Volksgruppe findet sich im Kreis Bílsko (83,5% im Jahr 1880), was im Gegensatz zur statutarischen Stadt Bílsko stand, die sich als deutsche Stadt mit einer relativ kleinen - nur 15% - polnischen Minderheit präsentierte.
Die ethnische Entwicklung Österreichisch-Schlesiens und des von ihm umschlossenen Mährischen Keils in den letzten Jahrzehnten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ist durch die Dominanz der deutschen Volksgruppe im Westen und der slawischen Volksgruppe im Osten gekennzeichnet, mit bedeutenden Veränderungen im industrialisierten Gebiet Ostrava-Karviná.
Abbildung 4.18: Bevölkerungsentwicklung nach Verkehrssprache in Österreichisch-Schlesien (1869-1910). Volkszählungen von 1869, 1880, 1890, 1900 und 1910
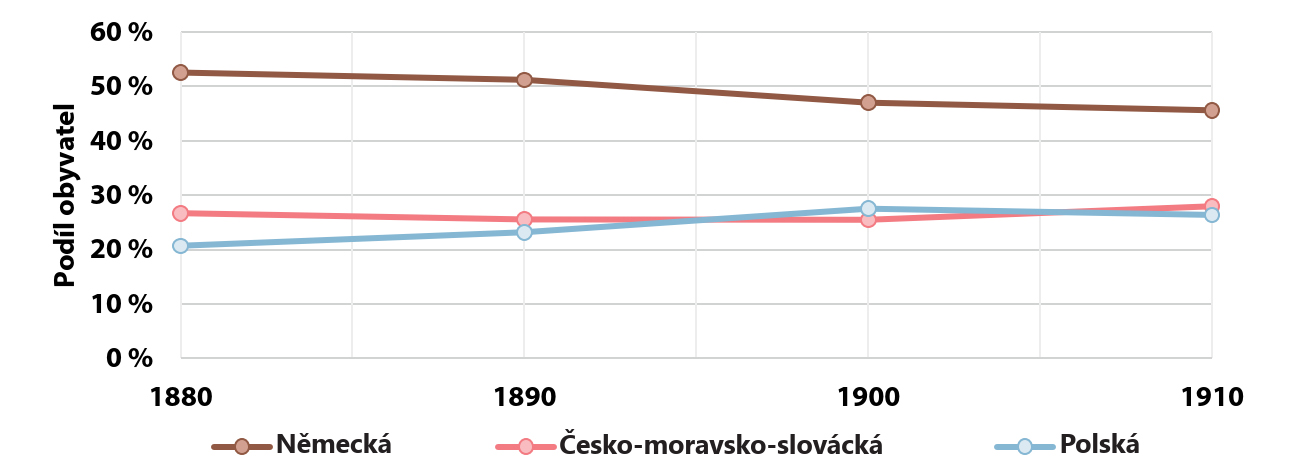
Zum Vergrößern auf das Bild klicken..
Die ethnische Zusammensetzung im Bezirk Těšín war am kompliziertesten, auch wegen der Nationalität der lokalen Bevölkerung. Die bei der Volkszählung von 1880 noch mehr als die Hälfte betragende Mehrheit der polnischen Volksgruppe (52,9 %) wuchs allmählich auf drei Viertel im Jahr 1910 (76,8 %) an, und auch der Anteil der Deutschen nahm zu; dazu trug die von Josef Koždon geleitete sog. Šlonzák-Bewegung bei, die die Idee der schlesischen Nationalität mit einer Neigung zum Deutschtum verband. Der Anteil der Tschechen ging proportional zurück (von 39,1 auf nur noch 6,2 %), was aber vor allem auf die Teilung des Gerichtsbezirkes Frýdek zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurückzuführen ist. Die höchste Repräsentation der polnischen Volksgruppe findet sich im Kreis Bílsko (83,5% im Jahr 1880), was im Gegensatz zur statutarischen Stadt Bílsko stand, die sich als deutsche Stadt mit einer relativ kleinen - nur 15% - polnischen Minderheit präsentierte.
Die ethnische Entwicklung Österreichisch-Schlesiens und des von ihm umschlossenen Mährischen Keils in den letzten Jahrzehnten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ist durch die Dominanz der deutschen Volksgruppe im Westen und der slawischen Volksgruppe im Osten gekennzeichnet, mit bedeutenden Veränderungen im industrialisierten Gebiet Ostrava-Karviná.
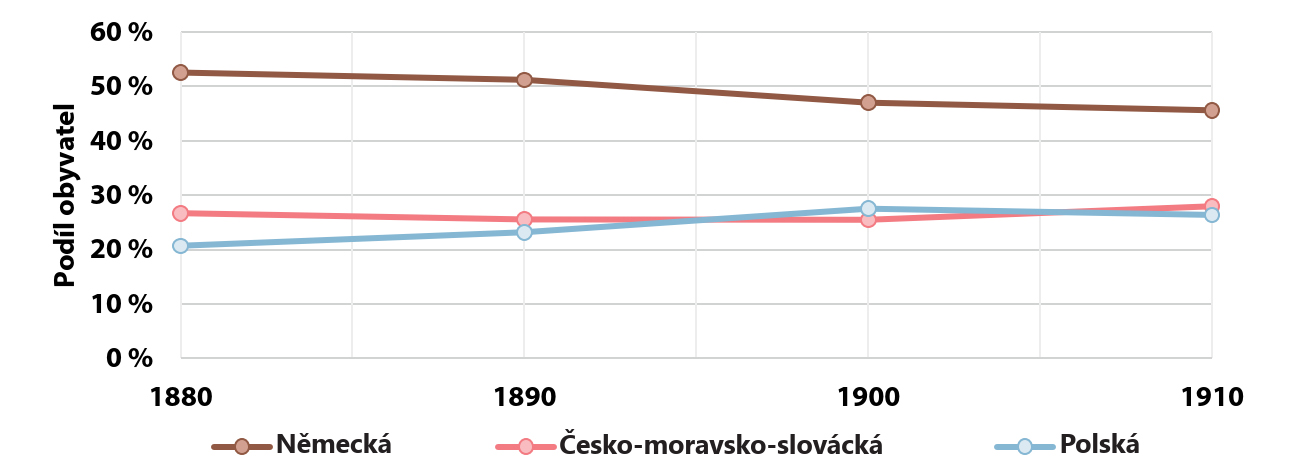
4.10 Bevölkerung nach Sprachen in Schlesien 1910
Nach dem Ersten Weltkrieg und der Gründung der Tschechoslowakei, als die Frage der Festlegung der Staatsgrenzen zwischen der Tschechoslowakei und Polen in Teschen (genauer: Teschener Schlesien, pol. Śląsk Cieszyński) geklärt wurde, verfassten die Vertreter deutscher Parteien und Gruppen aus Teschen und dem benachbarten Ostrauer Gebiet ein umfangreiches Memorandum, in dem sie sich an die Konferenz mit dem Vorschlag wandten, Teschen zu einem neutralen Staat zu machen, der unter internationaler Aufsicht verwaltet wird. Das Memorandum enthielt auch eine übersichtliche Karte (Karte der Bevölkerung des ostmährisch-schlesischen Industriegebietes), die die äußerst komplexen sprachlichen und nationalen Verhältnisse veranschaulichte, die sich in diesem Teil von Österreichisch-Schlesien vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt hatten.
Die österreichischen Daten zu den optierenden Sprachen aus dem Jahr 1910 sind nicht zu verwechseln mit den Daten zur tatsächlichen nationalen Ausrichtung der erfassten Bevölkerung. Ein bedeutender Teil der damaligen Teschener Bevölkerung war ethnisch indifferent. Wir sollten uns zum Beispiel fragen, ob wir auch die zahlreichen Anhänger der Schlesischen Landbewegung als Polen betrachten sollten (die Anteile der Anhänger der Bewegung an der Bevölkerung der einzelnen Teschener Gemeinden sind in Form von gelben Linien in den Kreisdiagrammen auf der Karte dargestellt). Die Schlesier sprachen meist einen gemischten Teschener Dialekt mit einem Übergewicht an polnischen Sprachelementen und wurden daher in der Regel als polnischer Dialekt erfasst. Sie betrachteten sich jedoch nicht als Polen. Sie betonten, dass ihre Familien oft schon seit Generationen im Teschener Teil von Schlesien lebten. Echte Polen sahen sie in den Scharen armer polnischer Einwanderer, die vor dem Ersten Weltkrieg in die industrialisierten Dörfer von Těšín kamen, wo sie in den hastig eröffneten neuen Kohlegruben, Stahlwerken und Maschinenfabriken Arbeit fanden.
Die Migration hat Dimensionen angenommen, die man sich heute kaum noch vorstellen kann. Von den 427.000 Menschen im Jahr 1910 hatten mehr als 101.000, d.h. 27,3 %, keine anerkannte Zugehörigkeit innerhalb der ursprünglichen Provinzgrenzen von Těšín. Die Volkszählung brachte den Schlesiern die Wahrheit, dass die Polen, meist aus dem benachbarten Galizien unter den Zuwanderern tatsächlich in der Überzahl waren. Aber auch Tschechen, Slowaken, Juden und in nicht geringer Zahl vertretene Deutsche gingen nach Těšín und in das mährische Ostrava und andere nordmährische Gemeinden. Österreichische Statistiker dokumentierten die territoriale Herkunft der Zuwanderer nach den vorherrschenden Sprachen der Heimatgemeinden, aus denen sie kamen. In den drei industrialisierten Bezirken, die vor dem Ersten Weltkrieg am stärksten von der Abwanderung betroffen waren (die beiden schlesischen Bezirke Fryštát und Frýdek sowie der mährische Bezirk Ostrava), lebten 1910 bereits 332.000 Menschen. Allerdings hatte nicht einmal die Hälfte von ihnen eine anerkannte Zugehörigkeit. Die ursprünglichen, indigenen Einwohner waren in diesen Bezirken nur 166.000, dh 49,9 %. In den galizischen und schlesischen Bezirken mit überwiegend polnischer Verkehrssprache (z. B. Biała, Bochnia, Chrzanów, Wadowice und Wieliczka) besaßen dagegen 25,7 % die heimische Staatsbürgerschaft, in den mährischen Bezirken mit überwiegend tschechischer Verkehrssprache 12,9 % und schließlich in mährischen, schlesischen oder galizischen Kreisen mit überwiegend deutscher Sprache 10,6 % der Anwesenden.
Der Vergleich der Ergebnisse der Volkszählung von 1910 mit der Volkszählung von 1880 zeigt die grundlegende Tendenz in der Entwicklung der Bevölkerung von Těšín im untersuchten Zeitraum. Der stetige Anstieg der Bevölkerung in diesem Kronland war vor allem auf die Zuwanderung in die industrialisierten Dörfer zurückzuführen. Dies spiegelte sich in einem dramatischen Anstieg der Bevölkerungsdichte und gleichzeitig in dramatischen Veränderungen in der sozialen und sprachlichen Zusammensetzung der Bevölkerung von Těšín wider. Während die Zahl der Menschen, die in Těšín die tschechische Sprache verwenden, abnahm, stieg die Zahl derer, die Deutsch oder Polnisch verwenden. Die Ergebnisse für die größte Stadt der Region - Těšín - sind ein Beispiel. Im Jahr 1880 lebten dort 12 294 Menschen, von denen 49,6% deutsch, 36,6% polnisch und 13,9% tschechisch sprachen. Im Jahr 1910 waren es bereits 21 850, von denen 60,7 deutsch, 31,3 % polnisch und nur 6,5 % tschechisch sprachen.

Die Konferenz hat sich nicht mit dem Memorandum der deutschen Parteien befasst. Obwohl es sich im Fall von Těšín de jure um tschechisches bzw. tschechoslowakisches Territorium handelte, strebten die Polen von Těšín seit Ende 1918 den Anschluss an das polnische Gebiet an. Auf der Pariser Friedenskonferenz gab es eine lange Diskussion über die neue Staatsgrenze zwischen der Tschechoslowakei und Polen. Die tschechoslowakische Diplomatie argumentierte mit staatsrechtlichen, wirtschaftlichen und vor allem verkehrstechnischen Gründen. Gleichzeitig gelang es aber erfolgreich, die hauptsächlich ethnographische Argumentation Polens herauszufordern, die auf der Behauptung der unbestreitbaren Vorherrschaft der polnischen Bevölkerung im größten Teil des Teschener Territoriums beruhte. Eine internationale Kommission kam aus Paris nach Teschen, um die Bedingungen für eine lokale Volksabstimmung, ein Plebiszit, vorzubereiten. Am 28. Juli 1920 teilte die Pariser Konferenz das umstrittene Gebiet zwischen Polen und der Tschechoslowakei durch die noch heute gültigen Staatsgrenzen auf. Neben Těšín wurden auf der Friedenskonferenz auch in zwei weiteren umstrittenen Grenzgebieten in der Nordslowakei die Staatsgrenzen der Tschechoslowakei und Polens festgelegt. Bevor die internationale Kommission Těšín verließ, übergab sie am 10. August 1920 auf dem Těšín-Platz feierlich die Verwaltung der zugestandenen Teile von Těšín, Orava und Spiš an die tschechoslowakischen und polnischen Behörden.
4.11 Nationalität der Bevölkerung 1918-1991
Die Erste Republik baute in der sprachlichen und ethnischen Zusammensetzung ihrer Bevölkerung kontinuierlich auf das österreichische Erbe. Der Zweite Weltkrieg brachte neben der Vernichtung von Juden und Roma die Germanisierung der Bevölkerung, die Emigration und die Beteiligung an der deutschen Armee in Hlučín und Těšín. Nach dem Krieg wurden die Deutschen vertrieben, was zu einer völligen Entsiedelung in Westschlesien und dessen allmählicher Heilung durch Zuwanderung aus dem Landesinneren führte. Die sog. sozialistische Industrialisierung von Ostrava und Karviná war die Ursache für die intensive Einwanderung von Slowaken. Die Zeit nach 1989 brachte mit der Einführung der Kategorien der schlesischen und mährischen Nationalität neue, nicht sehr glückliche Elemente in die Zensuspraxis des Staates.
Vergleicht man die Situation am Ende des Bestehens der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (Volkszählung 1910) mit der Situation im neuen Staat (Volkszählung 1921), so stellt man fest, dass in Tschechisch-Schlesien die Zahl der Deutschen, Tschechen und Polen zunahm, wobei die Deutschen überwogen (46%), Tschechen und Polen hatten fast die gleichen Anteile (Tschechen 28%, Polen 26%). Die Erste Republik änderte ihre Dominanz - 48,4 % der Bevölkerung gaben bei der Volkszählung ihre tschechoslowakische Nationalität an, während die Zahl der Deutschen leicht abnahm, ihr Anteil sank auf 39,1 %. Die größte Veränderung fand bei den Polen statt, unter denen sich auch eine Reihe von Galiziern befand, die eine neue Staatsangehörigkeit erklärten, von denen viele in ihre Heimat auswanderten, andere erwarben keine neue Staatsangehörigkeit und wurden als Ausländer registriert, was insgesamt zu einem spürbaren Rückgang und dem Entstehen einer Minderheit führte, die nur noch 11,8 % der Bevölkerung ausmachte. Weniger als ein Prozent vertraten andere Nationalitäten. Die Juden wurden überwiegend zu einer städtischen Bevölkerung mit der Tendenz, in die Städte zu ziehen und ins Ausland zu gehen. Städte mit einer größeren jüdischen Gemeinde waren Český Těšín, Nový Bohumín, Fryštát und Moravská Ostrava.
Die langjährige, jahrhundertelange Vorherrschaft der Deutschen in westlichen Schlesien, wo sie bis zu 97,8 % der Bevölkerung ausmachten, blieb bestehen, der Anteil der Tschechen betrug 1,6 % (Bezirke Jeseník, Bruntál, Krnov). In der Region Opava gab es ein leichtes Übergewicht der deutschen Volksgruppe gegenüber der tschechischen Volksgruppe (51,2 % Deutschen, 48,6 % Tschechen). In allen anderen schlesischen Bezirken und in nordöstlichen Mähren dominierte die tschechische Bevölkerung, wobei der Anteil der deutschen Minderheit zwischen 5,3 % in Frýdek und 31,7 % in Bílovec lag. Die Polen waren auf die Region Českotěšínsko konzentriert. Die größte Konzentration war im Bezirk Český Těšín, wo sie die Mehrheit bildeten, anderswo nur eine Minderheit in unterschiedlicher Anzahl. Auch Russen und Weißrussen, Ungarn und Slowaken waren in geringer Zahl vertreten. Bis 1930 stiegen die Zahl und der Anteil der tschechoslowakischen Nationalität, während die deutsche Nationalität zahlenmäßig unverändert blieb und die polnische Nationalität einen leichten Anstieg verzeichnete.
Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Bevölkerung stark eingedeutscht und entvölkert, und der Völkermord an Juden und Roma wurde wieder aufgenommen. Die Auswirkungen auf Schlesien waren noch verheerender als in Böhmen und Mähren. Nach dem Krieg wurde das Problem der deutschen Staatsangehörigen (während des Krieges wurden die Männer Wehrmachtssoldaten) in Hlučín und der Inhaber der sogenannten Volksliste in Těšín in einem Kompromiss gelöst. Die Nachkriegsvertreibung der Deutschen führte zu einer Störung der bestehenden nationalen Zusammensetzung der Region, und Westschlesien wurde nach und nach von Tschechen aus dem Landesinneren besiedelt. Während der sogenannten sozialistischen Industrialisierung nahm die Einwanderung von Slowaken und Roma zu, vor allem nach Ostrava und Karviná. Die Volkszählung von 1950 registrierte den tiefsten und grundlegendsten Strukturwandel der nationalen und sprachlichen Verhältnisse in der Tschechoslowakei überhaupt. Der Anteil der tschechischen Bevölkerung in Schlesien stieg auf 86,3 %, während der Anteil der deutschen Bevölkerung durch die Vertreibung auf 1,1 % sank. Die polnische Volksgruppe ging deutlich auf 7,9 % zurück. Ein neues, wachsendes Element war die dynamische Einwanderung von Slowaken, die eine Minderheit von 30 000 Menschen darstellten.
Abbildung 4.19: Bevölkerungsentwicklung nach Nationalität in Tschechisch-Schlesien (1921-1991). Volkszählungen von 1869, 1880, 1890, 1900 und 1910
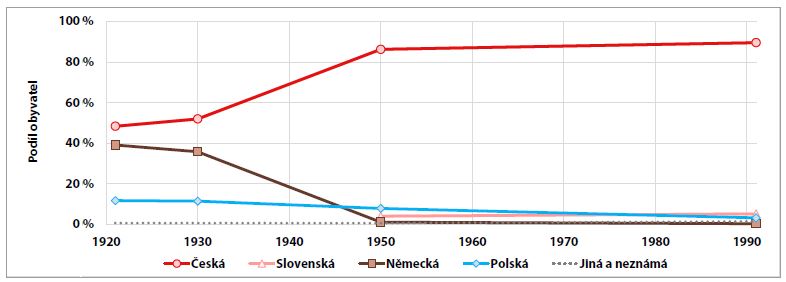
Zum Vergrößern auf das Bild klicken..
Der Wechsel des politischen Regimes nach 1989 spiegelte sich nicht sehr glücklich in der Volkszählungspraxis des Staates wider, der bei der Volkszählung 1991 neue Sektionen einführte - mährische und schlesische Nationalität. Es gab auch administrative und verwaltungstechnische Änderungen, die es unmöglich machen, kleinere Gebietseinheiten und die darin lebende Bevölkerung zu vergleichen. Daher können nur die grundlegenden Entwicklungstrends genannt werden. Die tschechische Bevölkerung wuchs weiter auf einen Anteil von fast 90 %, die polnische Minderheit verringerte sich in der Zahl auf einen Anteil von 3,2 %, während die Vertretung der Slowaken recht dynamisch wuchs (5,2 %). Die deutsche Minderheit ist fast verschwunden und macht weniger als ein halbes Prozent der Bevölkerung aus, während andere Nationalitäten 1,5 % der Gesamtbevölkerung ausmachen.
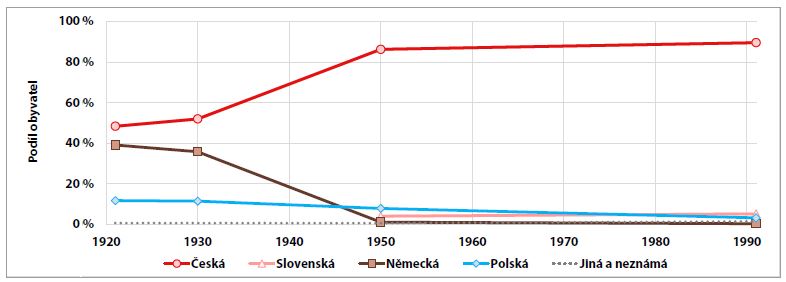
Der Wechsel des politischen Regimes nach 1989 spiegelte sich nicht sehr glücklich in der Volkszählungspraxis des Staates wider, der bei der Volkszählung 1991 neue Sektionen einführte - mährische und schlesische Nationalität. Es gab auch administrative und verwaltungstechnische Änderungen, die es unmöglich machen, kleinere Gebietseinheiten und die darin lebende Bevölkerung zu vergleichen. Daher können nur die grundlegenden Entwicklungstrends genannt werden. Die tschechische Bevölkerung wuchs weiter auf einen Anteil von fast 90 %, die polnische Minderheit verringerte sich in der Zahl auf einen Anteil von 3,2 %, während die Vertretung der Slowaken recht dynamisch wuchs (5,2 %). Die deutsche Minderheit ist fast verschwunden und macht weniger als ein halbes Prozent der Bevölkerung aus, während andere Nationalitäten 1,5 % der Gesamtbevölkerung ausmachen.
4.12 Einwanderungstrends zwischen 1869 und 1910
An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert dominierten in Österreichisch-Schlesien und nordöstlichen Mähren zwei Migrationsrichtungen. Viele Menschen aus Těšín und Galizien wanderten in die sich schnell entwickelnde Region Ostrava und Fryštát (Karviná) ab, während junge Männer aus den wirtschaftlich rückläufigen Bezirken in der Region Gesenke (Bruntál, Krnov, Jeseník) hauptsächlich nach Niederösterreich zogen. In den 1880er und 1890er Jahren kam es zu einem enormen Zustrom von Galiziern in die Bergwerke und Hütten, so dass es im Jahr 1900 im Bezirk Moravská Ostrava 23.127 von ihnen gab (einschließlich der Kinder).
In den anderen Bezirken überschritt der Anteil von Personen aus anderen Ländern nicht die 10 %-Schwelle und es handelte sich überwiegend um Zuwanderer aus den Nachbarländern. Auch im Bezirk Bruntál überwogen völlig die Einwanderer aus Mähren (fast 72 %), an die der Bezirk Bruntál direkt angrenzte. In den Bezirken Jeseník und Krnov überwogen dagegen die Einwanderer aus den deutschen Ländern (vor allem aus Preußisch-Schlesien). Im Bezirk Bílsko war der größte Anteil an "Ausländern" wiederum Personen mit Heimatland Galizien (61,1 %). Es gab, kurz gesagt, eine natürliche Grenzbewegung, die umso leichter war, als es sich im Fall von Mähren und Schlesien um eine eher formale Grenze handelte. Etwas anders war die Situation in den Städten, vor allem in einer so wichtigen Stadt wie Opava, dem Zentrum von Österreichisch-Schlesien. Die Einwohner mit einer Heimatnationalität außerhalb Schlesiens bildeten sogar die Mehrheit (54 %). Wiederum kamen sie meist aus Mähren und deutschen Ländern. Neben verschiedenen Kaufleuten, Handwerkern usw. kamen auch Verwaltungsangestellte in beträchtlicher Zahl nach Opava.
Bis 1880 änderte sich an der Situation nicht viel, obwohl in die Bergwerke und Hütten in Karviná und Ostrava vermehrt Menschen aus Galizien kamen. Sie übertrafen die Einwanderer aus Schlesien und Mähren zwar nicht, aber im Bezirk Fryštát waren es bereits 2.771 (Menschen mit einer Heimatzugehörigkeit in Galizien) und im Bezirk Místek 2.255. Vor allem in den 1880er- und 1890er-Jahren kam es hier zu einem großen Zustrom von Einwanderern aus Galizien in die Schwerindustrie, was natürlich einen großen Einfluss auf die Repräsentation von Menschen mit ausländischer Nationalität hatte. Im Jahr 1900 existierte bereits der politische Bezirk Moravská Ostrava (Mährisch-Ostrau) und es gab 23.217 Personen mit einem Heimatrecht in Galizien, was mehr war als die Anzahl der Personen mit einem Heimatrecht in Schlesien (20.413), obwohl Schlesien nicht nur direkt an den Bezirk Moravská Ostrava (Mährisch-Ostrau) angrenzte, sondern in das schlesische Gebiet eingekeilt war. Der mährische Bezirk Ostrau war damals das Gebiet mit der größten Vertretung von Menschen von außerhalb Mährens (59%). Dies bedeutet nicht, dass alle von ihnen Einwanderer sind. Tatsächlich haben die Kinder von Einwanderern ihr Geburtsrecht von ihren Eltern erworben. Doch selbst die Städte Bílsko, Frýdek und Opava hatten nicht solche Anteile an "Ausländern", Opava sogar nur 28%. Der einzige Bezirk, der mit einem Wimpernschlag mithalten konnte, war Fryštát mit 33 % der Bevölkerung, die das Heimatrecht für ein Land außerhalb Schlesiens besaßen (44.694 Personen), von denen 29.329 aus Galizien (65,6 %) und nur 8.168 aus Mähren (18,3 %) stammten.
Moravská Ostrava und Fryštát waren Bezirke mit großer Zuwanderung. Keiner der anderen politischen Bezirke in Österreichisch- Schlesien und im nordöstlichen Mähren konnte auch nur annähernd mithalten. Im Gegenteil, ein großer Teil von ihnen war in dieser Zeit eher von der Auswanderung betroffen. Dies betraf vor allem die deutschsprachigen Bezirke Jeseník, Bruntál und Krnov, aus denen junge Männer im produktiven Alter vor allem nach Niederösterreich, insbesondere nach Wien, abwanderten. Das Industriegebiet von Ostrava und Karviná zog sie nicht so sehr an, vielmehr zogen die Menschen aus den Ausläufern der Beskiden dorthin. Immer mehr Menschen nutzten auch die Pendelmigration, d.h. sie pendelten von ihrem ständigen Wohnsitz außerhalb des industriellen Kerngebietes zur Arbeit in den Industrieanlagen. Dies geschah jedoch erst mit der Verbesserung der Verkehrssituation, insbesondere mit der Errichtung von Eisenbahnlinien.
Heimatstaat der Einwanderer. mapsforyoufree
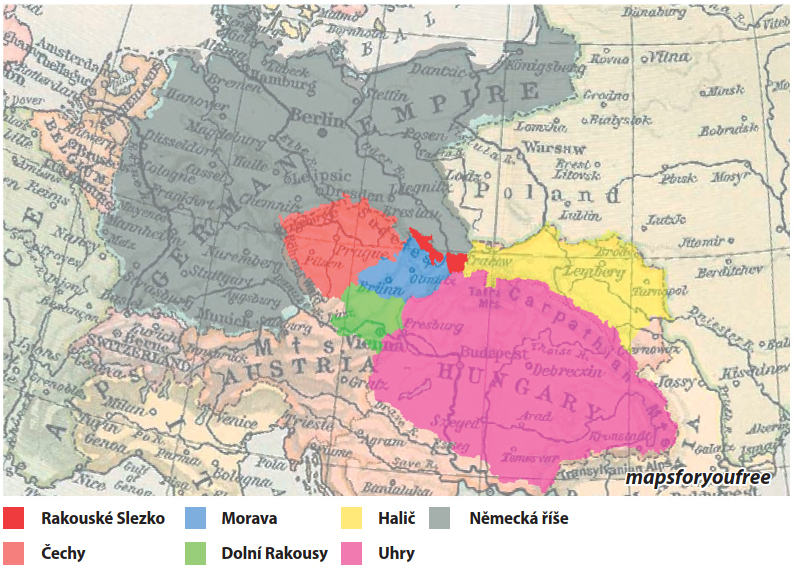
Zum Vergrößern auf das Bild klicken..
Die Einwanderung aus Galizien erreichte ihren Höhepunkt zu Beginn des 20. Jahrhunderts (um 1902), danach hörte der Zustrom auf. Die Bevölkerung stabilisierte sich, und allmählich erlangten die Galizier auch Heimatrechte an den Orten, in denen sie sich niederließen. So stieg die Zahl der Einwohner mit Heimrecht bis zum Ersten Weltkrieg nicht wesentlich an, sondern stagnierte eher. Die meisten von ihnen lebten im Bezirk Moravská Ostrava (23 418), dann im neu geschaffenen Bezirk Frýdek (20 071), wo die bedeutenden Bergbauorte von Ostrava (Polská Ostrava, Michálkovice u.a.) annektiert wurden, und weniger im Bezirk Fryštát (15 456), doch waren es mehr als im Bezirk Bílsko (7394), der direkt an Galizien angrenzte. Wenn die Zahl der Personen mit galizischer Zugehörigkeit zunahm, dann eher durch Geburten - Geburten von neuen Kindern mit galizischem Heimatrecht von ihren Vätern.
Abbildung 4.20: Bevölkerung in den Bezirken von Österreichisch-Schlesien nach Heimatgebiet (1869-1910). Volkszählungen von 1869, 1880, 1890, 1900 und 1910

Klicken Sie auf das Bild um die Galerie zu öffnen..
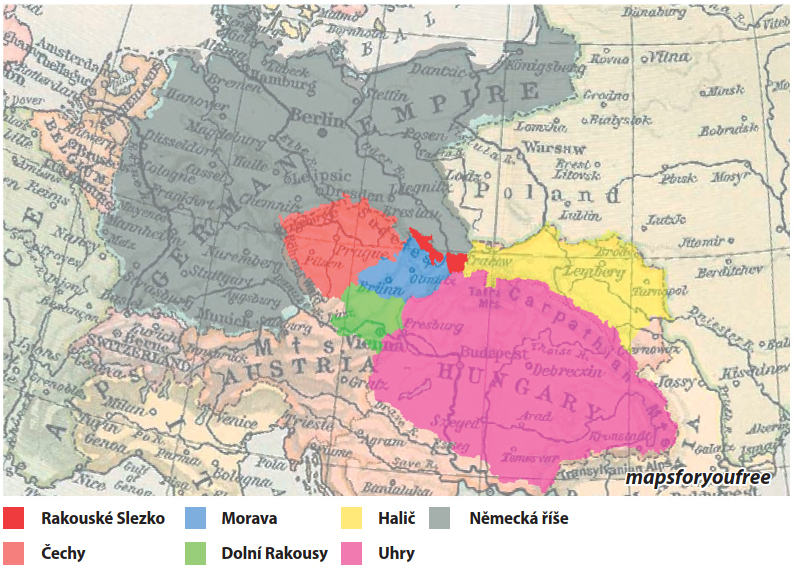
Die Einwanderung aus Galizien erreichte ihren Höhepunkt zu Beginn des 20. Jahrhunderts (um 1902), danach hörte der Zustrom auf. Die Bevölkerung stabilisierte sich, und allmählich erlangten die Galizier auch Heimatrechte an den Orten, in denen sie sich niederließen. So stieg die Zahl der Einwohner mit Heimrecht bis zum Ersten Weltkrieg nicht wesentlich an, sondern stagnierte eher. Die meisten von ihnen lebten im Bezirk Moravská Ostrava (23 418), dann im neu geschaffenen Bezirk Frýdek (20 071), wo die bedeutenden Bergbauorte von Ostrava (Polská Ostrava, Michálkovice u.a.) annektiert wurden, und weniger im Bezirk Fryštát (15 456), doch waren es mehr als im Bezirk Bílsko (7394), der direkt an Galizien angrenzte. Wenn die Zahl der Personen mit galizischer Zugehörigkeit zunahm, dann eher durch Geburten - Geburten von neuen Kindern mit galizischem Heimatrecht von ihren Vätern.

4.13 Zusammensetzung der Nationalitäten 1991-2011
Das Gebiet von Tschechisch-Schlesien hat immer noch eine vielfältigere ethnische Zusammensetzung als andere Regionen der Tschechischen Republik. Historisch gesehen war es großen Migrationsströmen ausgesetzt, die durch die Notwendigkeit der Besiedlung des Gebietes ausgelöst wurden (z.B. die Ankunft deutscher Siedler in der Region Jesenicko ab dem 13. Jahrhundert, walachisch-golarische Besiedlung der höheren Lagen in den Beskiden nach 1500), sowie Arbeitsmigration (vor allem im 19. und 20. Jahrhundert) zur sich entwickelnden Schwerindustrie in Ostrava und Karviná. Diese historischen externen Migrationsströme, die wir heute als international bezeichnen würden, beeinflussten die heutige ethnische Zusammensetzung des Gebietes von Tschechisch-Schlesien.
1. Befristete Arbeitsmigration von jungen Arbeitnehmern und fortgesetzte Orientierung am Heimatland;
2. Verlängerung des Aufenthaltes und Entwicklung von Netzwerken gegenseitiger Beziehungen und Bindungen, die auf gemeinsamen Affinitäten oder gemeinsamen Herkunftsgebieten und dem Bedarf an gegenseitiger Unterstützung in einer neuen Umgebung basieren;
3. der Familiennachzug, das wachsende Bewusstsein für eine langfristige Ansiedlung, die zunehmende Orientierung am Aufnahmeland und das Entstehen nationaler Gruppen mit eigenen Institutionen (Vereine, Geschäfte, Cafés);
4. Die dauerhafte Ansiedlung, die von der Regierungspolitik und dem Verhalten der Bevölkerung des Aufnahmelandes abhängt, führt entweder zur Gewährung von Rechtsstatus und Staatsbürgerschaft oder zur Ausgrenzung und Bildung dauerhafter nationaler Minderheiten.
Auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien wurden mehrere Prozesse der Bildung nationaler Minderheiten festgestellt, z. B. die Bildung der polnischen Minderheit. Gegenwärtig lassen sich ähnliche Prozesse in der Herangehensweise der Vietnamesen und Ukrainer erkennen. Darüber hinaus gibt es Minderheiten, die ihr Herkunftsland aufgrund von Kriegen und Konflikten in ihrem Heimatland verlassen haben, z.B. Griechen, die sich nach dem Bürgerkrieg 1948-1949 hauptsächlich in der Region Jesenicko niederließen. Armenier verließen in den Jahren 1988-1994 während des Kriegskonflikts mit Aserbaidschan die Stadt und gingen auch nach Ostrava, aber diese Daten erscheinen nicht in der SLDB. Obwohl im Jahr 2011 die traditionellen nationalen Minderheiten (Polen, Slowaken, Deutschen) in der SLDB einen Rückgang verzeichneten, wurde dennoch ein Anstieg der Anzahl der Personen festgestellt, die eine bestimmte Nationalität angeben. Einer der Gründe dafür war die steigende Zahl von Ausländern, die sich langfristig oder dauerhaft in der Tschechischen Republik aufhalten. Vor allem die Zahl der Personen mit ukrainischer und vietnamesischer Staatsangehörigkeit ist im Laufe des Jahrzehnts gestiegen.
Von 1991 bis 2011 war die tschechische Nationalität auf dem Gebiet der Bezirke völlig vorherrschend, siehe die Tabelle unten. Zwischen 2001 und 2011 war der fakultative Charakter dieser Frage direkt im Gesetz verankert, was sich auf die Interpretation der Ergebnisse, ebenso wie die Möglichkeit, bei diesen Umfragen zwei Nationalitäten anzugeben auswirkte. Es ist festzustellen, dass sich der langfristige Trend einer Abnahme der Zahl traditioneller nationaler Minderheiten fortsetzt, allerdings gibt es einen Effekt durch die fehlende Angabe der Nationalität, so dass sich nicht eindeutig sagen lässt, ob sich dieser Prozess beschleunigt hat oder tatsächlich in etwa gleichem Tempo weitergeht. Die slowakische Nationalität hat seit der Gründung der unabhängigen Republiken einen stärkeren Rückgang erfahren. Eine Reihe von Personen mit slowakischer Staatsangehörigkeit wählte die slowakische Staatsangehörigkeit und kehrte in die unabhängige Slowakische Republik zurück, während andere Slowaken die tschechische Staatsangehörigkeit wählten und in der Tschechischen Republik blieben. Im Jahr 1991 wurde im Bezirk Opava ein höherer Anteil (11,2 %) schlesischer Nationalität festgestellt, der später auf 2,5-2,8 % sank. In den anderen Bezirken lag die schlesische Nationalität in den Jahren 2001-2011 unter 1 %. Es ist zu beachten, dass im Laufe jeder SLDB ein Anstieg des Anteiles der nicht näher bezeichneten Widersprüche zu verzeichnen ist, der für einzelne Bezirke im Jahr 2011 zwischen 20 und 28,3 % schwankte. Wenn wir die Verteilung dieses Anteiles der Nichtnennung nach Gemeinden betrachten, gibt es einen überraschend hohen Anteil an Nichtnennung (bis zu über 33,5%) in den Gemeinden der Region Jesenicko, was entweder auf eine Zurückhaltung der Bevölkerung beim Ausfüllen dieser Daten oder auf eine geringere Zugehörigkeit zur nationalen Identität schließen lässt. Der Niedergang der traditionellen Minderheiten auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien wird auch durch eine 2018 durchgeführte soziologische Umfrage bestätigt, die das geringere Bedürfnis der jungen Generation nach Identifikation mit der nationalen Zugehörigkeit abbildet, der Einfluss der Globalisierung der Gesellschaft manifestiert sich in der Erwähnung der europäischen Identität durch die Befragten.
Tabelle 4.6: Prozentualer Anteil der Bevölkerung nach aufgelisteter Nationalität im Jahr 2011

Klicken Sie auf das Bild um die Galerie zu öffnen..

4.14 Ausländer 1991-2020
Das Gebiet von Tschechisch-Schlesien war das Ziel der Arbeitsmigration aus dem Ausland in die sich entwickelnde Schwerindustrie in Ostrava und Karviná. Für die ankommenden Arbeitskräfte aus den Nachbarländern wurde in Ostrava eine Infrastruktur geschaffen, sowohl für die dauerhafte Ansiedlung in Form von intensivem Wohnungsbau als auch für die vorübergehende Ansiedlung in Form von großen Herbergen mit einer Kapazität von über 7.000 Personen in der Agglomeration Ostrava, die bis heute Unterkunftsdienste leisten (z. B. in Ostrava das Hotel Vista, Hlubina, Vítek, Metalurg). Nach 1991 ist die wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes von Tschechisch-Schlesien auch mit der Entwicklung der Zahl der Ausländer verbunden. Die Zahl der Ausländer steigt tendenziell bei Wirtschaftswachstum und sinkt bei wirtschaftlicher Rezession. Insbesondere gab es einen Rückgang nach der Rezession im Jahr 1999 und nach 2008. Der Anstieg der Zahl der Ausländer nach 1994 ist vor allem in Gebieten mit entwickelter Industrie zu verzeichnen, d.h. in den Regionen Ostrava und Karviná.
Die angezeigten Daten werden von der Direktion der Fremdenpolizei der Tschechischen Republik durch die Statistik der Ausländer mit einem erlaubten Aufenthalt in der Tschechischen Republik auf Kreisebene überwacht (d.h. Ausländer mit einem dauerhaften Aufenthalt auf der Grundlage eines Visums für mehr als 90 Tage, die Zahl der Ausländer mit einem gültigen Asyl ist hier nicht enthalten).
Im Jahr 1996 gab es 23 102 Ausländer auf dem Gebiet der untersuchten Bezirke. Ende 2019 gab es einen Anstieg auf 29 760 Ausländer, wobei nach Nationalitäten die meisten Bürger der Slowakischen Republik waren (9 742). Die nächstgrößte Gruppe waren Bürger aus Polen (5.739) und die drittgrößte Gruppe waren Vietnamesen (4.473). Der Anstieg der Zahl der Ausländer ist auf das Wirtschaftswachstum zurückzuführen, insbesondere im Bezirk Ostrava-Stadt. Im Jahr 1996 lag der Anteil von Ostrava an allen untersuchten Bezirken bei 35 % und damit genauso hoch wie im Bezirk Karviná, aber im Jahr 2019 stieg der Anteil von Ostrava auf 41 %, während der Anteil des Bezirkes Karviná auf 24 % sank. Der Rückgang der Zahl der Ausländer im Bezirk Karviná ist vor allem auf die Schließung von Bergwerken zurückzuführen, die mehr polnische Bergleute beschäftigten. Auch im Bezirk Frýdek-Místek nahm die Zahl der Ausländer zu, was vor allem durch den Bau eines Automobilwerkes in Nosovice bedingt war. Die Daten berücksichtigen nicht das tägliche Pendeln der Grenzgänger (sog. Pendler), die zu den Bergwerken in Tschechisch-Schlesien pendeln. Zum Beispiel fährt regelmäßig ein Bus mit polnischen Arbeitern zur Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., die sich in Vrbno pod Pradědem befindet. Es handelt sich um ein ehemaliges Kunststoffspritzgusswerk, das von einem schwedischen Unternehmen gekauft wurde.
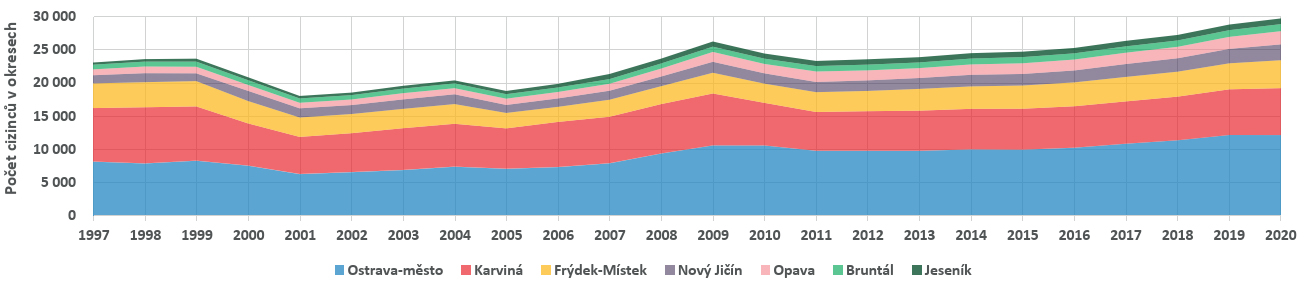
Ein wichtiger Teil der Ausländer sind auch hochqualifizierte Personen (Wissenschaftler, Forscher, die an Universitäten und Forschungsinstituten arbeiten, Doktoranden), Führungskräfte ausländischer Unternehmen, Studenten von Universitäten und weiterführenden Schulen, Familien und Kinder von Ausländern, die in Tschechisch-Schlesien arbeiten. Aus den oben genannten Gründen entstehen vor allem in Ostrava Kindergärten, Grund- und Mittelschulen mit Englischunterricht sowie Hochschulprogramme in englischer Sprache.
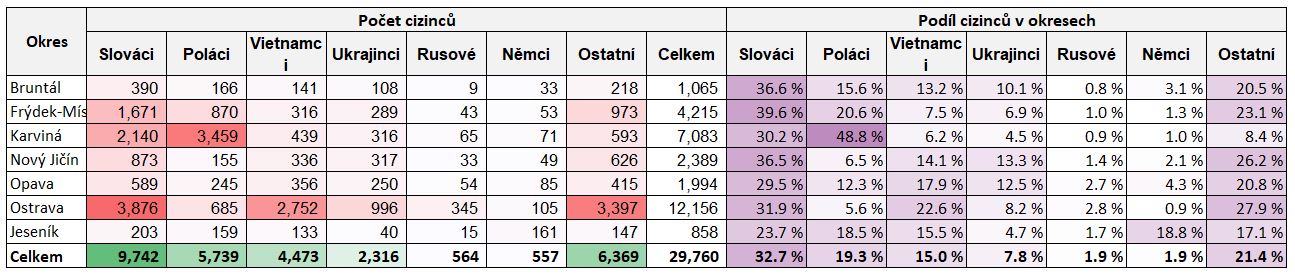
4.15 Ureinwohner (Anteil der autochthonen Bevölkerung)
Die heute auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien lebende Bevölkerung wurde historisch durch eine Mischung aus einheimischen Einwohnern und Neuankömmlingen gebildet. Als autochthone Bevölkerung werden Einwohner bezeichnet, die über einen relativ langen Zeitraum in einem bestimmten Gebiet ansässig sind. Die Kartenausgabe zeigt den Anteil der Bevölkerung, der zum Zeitpunkt der Volkszählung in einer bestimmten Gemeinde geboren wurde und dort lebt. Diese sind die einheimische Bevölkerung. Ein wichtiges Ereignis, das die Stabilität der Siedlung immer noch beeinträchtigt, ist der Nachkriegsumzug der deutschen Bevölkerung, vor allem aus der Region Jesenicko. Die Tatsache, dass aufeinanderfolgende Generationen eine persönliche Bindung an das Gebiet haben, ist für die Stabilität der Siedlung wichtig. Aus soziologischer Sicht sind die Fragen wichtig, woher die Eltern stammen, wo die Großeltern begraben sind, der Ort, an dem die Bewohner bis zum Erwachsenenalter aufgewachsen sind, da sie hierzu eine lebenslange Bindung haben. Auf diese Weise wird die territoriale Identität der Bewohner geformt. Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen haben in der Regel eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kultur und eine gemeinsame Mentalität.
Opava. Die autochthone Komponente der Bevölkerung ist in der Region ungleichmäßig vertreten, sie ist in der Stadt Opava und in den Gemeinden Těškovice, Větřkovice, Písek, Skřipov, Březová, Pustějov höher. Das Gebiet hat eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte und eine durchschnittliche Wohnfunktion des Territoriums. Es ist ein Gebiet mit einem geringeren Anteil an Kindern, dafür aber einem hohen Anteil an Senioren. Es gibt ein leichtes Wachstum von Wohn- und Gewerbegebieten.
Region Hlučín. Der autochthone Anteil ist im gesamten Gebiet hoch. Das Gebiet hat eine höhere Bevölkerungsdichte, die durch Zuwanderung verstärkt wird und mit einer Zunahme von Wohngebieten einhergeht. Die Wohnfunktion des Gebietes wächst, obwohl die Mehrheit der Einwohner in Familienhäusern lebt. Die im Gebiet lebende Bevölkerung hat einen bedeutenden autochthonen Anteil, was auf die Stabilität der Siedlung hinweist. Die Bevölkerung ist durch das deutsche oder preußische Verhaltensmodell geprägt. Dieses Verhaltensmodell äußert sich in einer höheren Arbeitsaktivität, einer größeren Religiosität und Konservativität der Bevölkerung und einer großen Aktivität bei der Gestaltung der eigenen und öffentlichen Flächen und Räume (starke Bindung an das Land). Das Gebiet ist geprägt von der Einhaltung kultureller Traditionen. Im südlichen Teil der Gemeinde (Ludgeřovice, Markvartovice und Hlučín) gibt es einen spürbaren Suburbanisierungsprozess durch die Bevölkerung aus Ostrava.
Es ist daher von einem immer stärkeren Zuzug der Bevölkerung in das gesamte Gebiet auszugehen, was einen Druck auf den Bau neuer Familienhäuser und damit verbunden auch eine Stärkung des Wohnpotenzials des Gebietes zur Folge haben wird.
Schlesien. Die autochthone Komponente der Bevölkerung ist im Gebiet unterschiedlich vertreten. Der westliche Teil des Gebietes hat niedrigere Werte der autochthonen Komponente aufgrund der intensiven Migration, vor allem aus Ostrava. Das gesamte Gebiet hat eine hohe Bevölkerungsdichte, mit Ausnahme des südlichen Teiles des Gebietes, wo sich Ausläuferdörfer befinden. Die Wohngebiete wachsen in den Regionen Třinec, Jablunkov und Frýdek-Místek. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Gebiet von Třinec, Těšínsko, Jablunkovsko ist autochthon, es besteht eine relativ bedeutende Beziehung zum Territorium, was sich durch viele soziokulturelle und sportliche Aktivitäten im Territorium manifestiert. Das Territorium der Städte Karviná, Orlová zeigt ein erhöhtes Auftreten von sozialen, sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen Risiken, die die Instabilität der Siedlung verstärken. Ein weiterer Indikator für Instabilität kann in der höheren Scheidungsrate beobachtet werden.

Ostrava. Die in diesem Gebiet lebende Bevölkerung hat einen etwas höheren Anteil der autochthonen Komponente. Das gesamte Gebiet hat eine hohe Wohnfunktion, was auch auf die hohe Bevölkerungsdichte zurückzuführen ist. Der östliche Teil des Gebietes von den Flüssen Ostravice und Odra ist von der lockeren schlesischen Entwicklung beeinflusst, die durch unterschiedliche Bauordnungen verursacht wurde, die für den mährischen und schlesischen Teil des Ostrauer Gebietes unterschiedlich waren. Die Mährische Bauordnung von 1894 förderte die kompakte Bauweise im Ortsinneren, andererseits galt in Schlesien die Schlesische Bauordnung von 1883 Nr. 26, die eine lockere Bauweise, die sogenannte schlesische Bauweise, erlaubte. Diese nicht kompakte Bebauung wird derzeit verdichtet und die Wohngebiete wachsen.
4.16 Migration im 21. Jahrhundert (2001-2019)
Die Industriegesellschaft wurde auf Industrieregionen aufgebaut, die sich durch eine starke Bevölkerungskonzentration auszeichnen. Der Prozess der Industrialisierung und Stadtentwicklung war mit einer Zunahme der räumlichen Mobilität der Bevölkerung verbunden. In der Tschechischen Republik ist die Migration mit einem Wechsel des ständigen Wohnsitzes verbunden. Migrationsbewegungen erzeugen eine Reihe wichtiger demographischer, wirtschaftlicher, sozialer und politischer Effekte, sowohl im Prozess der Auswanderung als auch im Prozess der Einwanderung und sie sind ein sensibler Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region. Das Wachstum der Migration hat sich, mit starken konzentrativen Tendenzen während der Industrieperiode, als die Menschen einseitig in die Industriestädte zogen fortgesetzt. Das postindustrielle Zeitalter ist durch eine wechselseitige Bewegung (zwischen dem Kern und dem Hinterland) gekennzeichnet. Während in der vorindustriellen Zeit die natürlichen Gegebenheiten der bestimmende Faktor für die Ansiedlung waren, nahm in der Industriezeit der mit dem Arbeitsmarkt verbundene Einfluss zu. In der aktuellen Phase des gesellschaftlichen Wandels gibt es in der Verteilung der Bevölkerung, die zum Teil durch Suburbanisierung unterstützt werden und der Konzentration von Arbeitsplätzen in Ballungsräumen entgegenstehen deutliche Dezentrierungstendenzen. Auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien manifestieren sich diese Prozesse durch die Abwanderung der Bevölkerung in das Umland der Städte, wo sich die Arbeitsplätze konzentrieren.
Hier werden wir uns nur auf die interne Migration konzentrieren. Von 2001 bis Ende 2019 verlor das Gebiet von Tschechisch-Schlesien fast 50.000 Einwohner, wobei die Abwanderung 61 % dieses Verlustes ausmachte (der durchschnittliche jährliche Wanderungsverlust betrug 1.451 Einwohner). Die größten Wanderungsverluste gab es nach 2008, als das Gebiet von der globalen Rezession betroffen war (der extreme jährliche Wanderungsverlust betrug 2.060 Einwohner im Jahr 2009 und weitere 2.861 Einwohner im Jahr 2010 auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien). Ab 2018 liegen die Wanderungsverluste nur noch unter 1.000 Einwohnern.
Andere Migrationsprozesse, die auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien stattfanden, waren vor allem auf das Hinterland der großen Städte mit einer guten Umweltqualität gerichtet, was sich im Anstieg der Einwohnerzahl der SO ORP Kravaře, Hlučín, Frýdlant, Frýdek-Místek, Třinec widerspiegelt. Die größte relative Abwanderung von Einwohnern war aus SO ORP Orlová, dann SO ORP Jeseník, Bruntál, Karviná, Havířov, Kopřivnice. Die oben genannten Bereiche umfassen zwei Arten von Bereichen mit Migrationsverlusten. Erstens sind die von der industriellen Umstrukturierung betroffenen Gebiete (d.h. das Hinterland, das für die Unterbringung der in dieser Industrie tätigen Personen genutzt wird) SO ORP Orlová, Havířov, Karviná, Kopřivnice. Im zweiten Fall sind es die Vorgebirgsgebiete, insbesondere SO ORP Jeseník und Bruntál.
Um die Prozesse der Suburbanisierung zu erfassen, ist es notwendig, Migrationsprozesse auf kommunaler Ebene abzubilden. Ein spezifisches Gebiet mit Bevölkerungswachstum ist der nördliche Teil der Region Ostrava-Karviná, bestehend aus den Gemeinden Dolní Lutyně, Dětmarovice und Petrovice u Karviná, die relativ angenehmes Wohnen in einer lockeren Landschaft bieten. Ein weiteres spezifisches Gebiet ist Horní Bludovice, das den negativen Trend im SO ORP Havířov deutlich positiv kompensiert. Ein bedeutenderer Migrationsstrom kann auch in südlicher Richtung innerhalb des Mährischen Keils beobachtet werden, vor allem südlich von Frýdek-Místek zu den Gemeinden Palkovice, Baška, Staré Město, die verkehrstechnisch gut erreichbar sind. In weiterer Folge sind attraktive Gemeinden SO ORP Frýdlant nad Ostravicí, insbesondere die Gemeinden Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem und im SO ORP Frenštát pod Radhoštěm die Gemeinde Trojanovice. Im SO ORP Nový Jičín ist es die Gemeinde Starý Jičín, im SO ORP Opava die Gemeinde Hradec nad Moravicí. Das SOP ORP Třinec hat einen signifikanten Anstieg der Zahl der Migranten, vor allem in der Gegend von Vendryně und Komorní Lhotka, wo sich ein Seniorenheim befindet, was diesen Anstieg positiv beeinflussen kann.
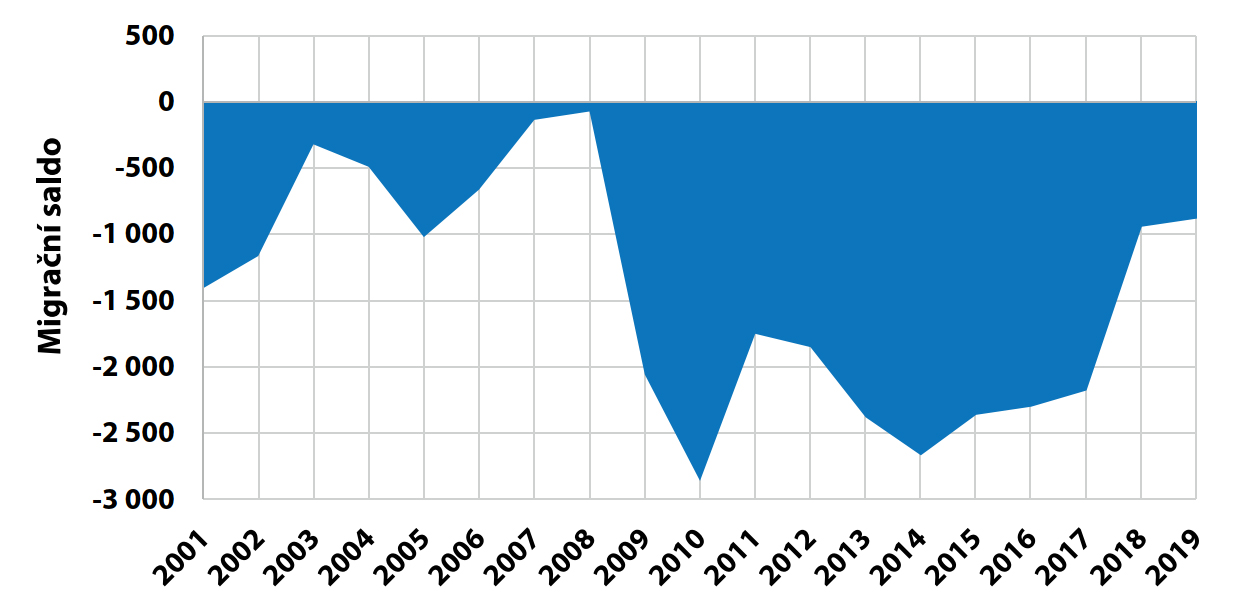
Bei der Auswertung der Migrationsströme aus Ostrava lassen sich verschiedene Tendenzen erkennen. Der Anstieg der Einwohnerzahl in kleinen Dörfern ist nicht so signifikant. Die bedeutenderen Migrationsströme sind vor allem im Hinterland von Ostrava, wo auch die Dominanz der östlichen Richtung bedeutend ist, d.h. der Anstieg der Bevölkerungsmigration in den Gemeinden Šenov, Petřvald, Rychvald und Vratimov. Dies ist vor allem eine Verdichtung der lockeren schlesischen Wohnbebauung. Ein deutlicher Anstieg der Bevölkerung ist in Klimkovice, Vřesina und Velká Polom zu verzeichnen. In diesem Fall handelt es sich um eine Abwanderung der einkommensstärkeren Bevölkerungsschichten, die sich in höheren Grundstückspreisen für den Bau von Einfamilienhäusern niederschlägt. Ein ähnlicher Prozess findet in den Gemeinden Ludgeřovice, Krmelín und Brušperk statt. Diese Trends zeigen, dass es eine Zunahme von Siedlungen vor allem in der Größenklasse bis 10 000 Einwohner gibt, wie bereits in Kapitel 4.1 Gesamtbevölkerung erwähnt.
Um den Migrationsprozess zu bewerten, wurde die folgende Typologie der Gebiete auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien und des Mährischen Keils erstellt, die sowohl die kurzfristige als auch die langfristige Entwicklung der Migration bzw. den Migrationssaldo berücksichtigt und auch die Gründe für die Migration, die sich aus den Bedingungen des Gebiets ergeben, mit einbezieht:
A - migrationsbegünstigte Gebiete
- Mährischer Keil, gut zugänglich für die Agglomeration - gut erreichbares Gebiet zu Ostrava (in der Nähe von Ostrava hauptsächlich Richtung Norden und Westen)
B – Gebiete mit relativ stabiler Migration
C – Gebiete mit Wanderungsverlusten
- dies sind stark verstädterte Gebiete, die von Umstrukturierungen mit großen Wanderungsverlusten betroffen sind
- innere und äußere Peripherie der Region von Bevölkerungsabwanderung aufgrund fehlender Arbeitsmöglichkeiten betroffen.
4.17 Natürlicher Anstieg im 21. Jahrhundert (2001-2019)
Die Analyse der Bevölkerungsgröße ist der grundlegende Rahmen für die Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung. Die spezifischen Ursachen für den regionalen Bevölkerungswandel ergeben sich aus einer Reihe von Quellen. Grundlage der Analysen ist der natürliche Zuwachs, also die Differenz zwischen der Anzahl der Geburten und Sterbefälle im gleichen Zeitraum. Da die Differenz zwischen den beiden Prozessen jedoch negativ sein kann, handelt es sich dann logischerweise um eine natürliche Abnahme. Theoretisch analysieren wir jedoch immer noch den Prozess des natürlichen Wachstums im Allgemeinen. Obwohl die Bevölkerungsgröße auf den ersten Blick eine quantitative Größe ist, ist klar, dass sie einen fundamentalen Einfluss auf die entscheidenden räumlichen Beziehungen hat: soziale, wirtschaftliche und sozio-ökonomische. Die Bevölkerungsgröße ist auch das Ergebnis der qualitativen Parameter des sozialen und wirtschaftlichen Umfeldes der menschlichen Gesellschaft.
Die Entwicklung der natürlichen Zunahme wird für den Zeitraum von 2001 bis 2019 betrachtet. Daraus ist offensichtlich, dass sich die Regionen in dieser langfristigen Betrachtung hinsichtlich des natürlichen Wachstums in zwei Gruppen unterteilt haben. Eine Gruppe besteht aus den SO ORP mit einem positiven natürlichen Zuwachs, zu denen die SO ORP Kopřivnice, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kravaře und Český Těšín gehören. Von diesen befinden sich nur die SO ORP Kravaře und Český Těšín, teilweise Frýdek-Místek, auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien. Die jährliche Rate der natürlichen Bruttozunahme von 2001 bis 2019 für diese SO ORP reicht von 0,1 ‰ bis 1,3 ‰. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Gebiete mit einem hohen Anteil an Neuankömmlingen aus Großstädten. Gleichzeitig sind diese Gebiete verkehrstechnisch gut erschlossen, was im Hinblick auf das tägliche Pendeln wichtig ist.
Die zweite Gruppe besteht aus anderen SO ORP, die eine negative natürliche Zunahme oder Abnahme haben. Die höchsten Werte des natürlichen Rückgangs sind in den SO ORP Ostrava und Karviná zu verzeichnen, die im Durchschnitt bei -9 ‰ bis -12 ‰ liegen. Auch im Jahr 2018 erreichten die Werte für die Karviná SO ORP -18 ‰. Am Ende des Betrachtungszeitraumes werden in Karviná weniger Kinder geboren und auch die Sterblichkeitsrate ist höher. Junge Menschen verlassen die Region und gründen Familien in Gebieten mit höherer Umweltqualität und besser zugänglichen Arbeitsplätzen. Ähnlich ist die Situation in SO ORP Orlová. Im Fall von SO ORP Krnov sind die negativen Werte des natürlichen Anstiegs durch die schlechte Verfügbarkeit von Arbeit verursacht.
Der erste Faktor, der das natürliche Wachstum beeinflusst, ist die Anzahl der geborenen Kinder, die durch den Anteil der Frauen im gebärfähigen Alter, aber auch durch die Verzögerung des Alters bei der Geburt des ersten Kindes, wenn die Wahrscheinlichkeit, ein weiteres Kind zu bekommen, abnimmt beeinflusst wird. Insbesondere in der Region Bruntál, wo in der Vergangenheit aufgrund des langfristigen negativen Wanderungssaldos, der vor allem durch den Wegzug der jüngeren Generation verursacht wurde, viele Kinder geboren wurden, ist die Zahl der Geburten gesunken und das gesamte Gebiet befindet sich in einem negativen natürlichen Wachstum.
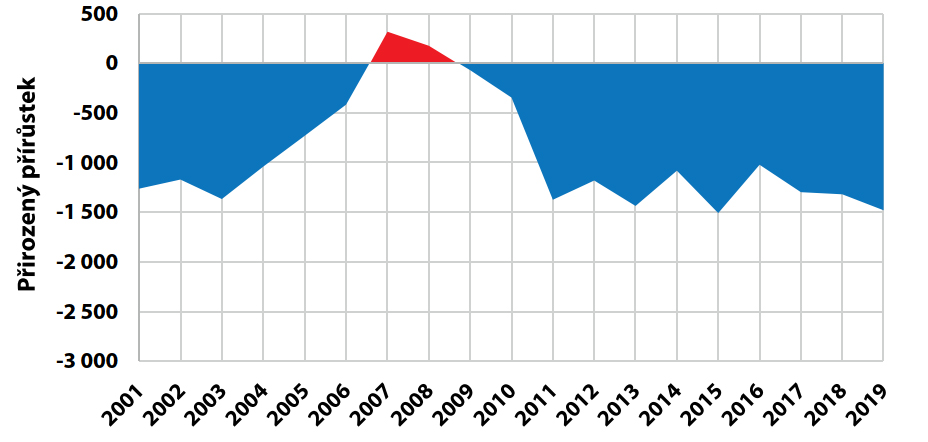
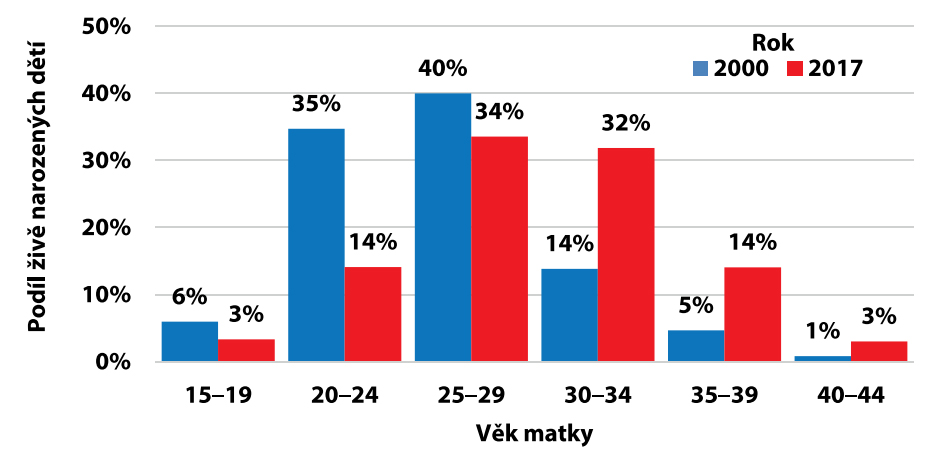
Der zweite Faktor, der die natürliche Zunahme beeinflusst, ist die Gesamtsterblichkeitsrate in den betreffenden Regionen. Im Gürtel der ehemals sozialistischen Staaten von den baltischen Republiken bis zum Schwarzen Meer ist sie höher als im Rest der EU. Im Gegensatz dazu wurden die niedrigsten Gesamtsterblichkeitsraten für beide Geschlechter in den meisten Teilen Frankreichs, Italiens, Spaniens und im Süden des Vereinigten Königreiches sowie in Schweden gefunden. Die gesamte standardisierte (d.h. altersbereinigte) Sterblichkeitsrate in Tschechisch-Schlesien ist etwas höher als der EU-28-Durchschnitt. Die häufigste Todesursache für beide Geschlechter waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von bösartigen Tumoren (Krebs), Erkrankungen der Atemwege, Lungenkrebs (ICD-10 Bronchial-, Bronchial- und Lungenkrebs) und die letzte häufige Todesursache waren chronische Erkrankungen der unteren Atemwege.
5. SOZIALE UND KULTURELLE ENTWICKLUNG
INHALT DES KAPITELS
5.1 Die Revolution 1848-1849 (Wahlen zum Reichstag und zum Frankfurter Landtag)
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (OU)
5.2 Provinzial- und Reichstagswahlen in Schlesien 1861-1918
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (OU)
5.3 Parlamentswahlen in Schlesien 1918-1938
prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. (OU)
5.4 Der Prozess der Urbanisierung - die Geburt der modernen Stadt
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (OU)
5.5 Entwicklung des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (OU)
5.6 Mittel-, Berufs- und Fortbildungsschulen in Schlesien bis 1914
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (OU)
5.7 Ethnographische und industrielle Ausstellungen in Schlesien
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (OU)
5.8 Änderungen in der Kirchenverwaltung in Schlesien - Katholische Kirche
PhDr. David Pindur, Ph.D. (OU)
5.9 Veränderungen in der Kirchenverwaltung in Schlesien - Evangelische Kirchen
PhDr. David Pindur, Ph.D. (OU)
5.10 Veränderungen in der Kirchenverwaltung in Schlesien - Juden und andere
PhDr. David Pindur, Ph.D. (OU)
5.11 Printmedien als Träger der schlesischen Identität
PhDr. Radim Jež, Ph.D. (OU)
5.12 Tschechische Emanzipation
doc. PhDr. Andrea Pokludová (OU), Ph.D. prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (OU)
5.13 Polnische Emanzipation
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (OU)
5.14 Schlosskultur
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (OU)
5.15 Spuren des Adels in der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (OU)
5.16 Streit um Těšín 1918-1920
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (SZM), Mgr. Ivana Kolářová (SZM)
5.17 Region Hlučín in der Zwischenkriegszeit
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (OU)
5.18 Tschechisch-Schlesien (1938-1939)
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (SZM)
5.19 Ostrava-Opava Operation
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (SZM)
5.20 Underground in Tschechisch-Schlesien 1970-1989
Mgr. Tomáš Herman (OU)
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (OU)
5.2 Provinzial- und Reichstagswahlen in Schlesien 1861-1918
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (OU)
5.3 Parlamentswahlen in Schlesien 1918-1938
prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. (OU)
5.4 Der Prozess der Urbanisierung - die Geburt der modernen Stadt
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (OU)
5.5 Entwicklung des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (OU)
5.6 Mittel-, Berufs- und Fortbildungsschulen in Schlesien bis 1914
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (OU)
5.7 Ethnographische und industrielle Ausstellungen in Schlesien
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (OU)
5.8 Änderungen in der Kirchenverwaltung in Schlesien - Katholische Kirche
PhDr. David Pindur, Ph.D. (OU)
5.9 Veränderungen in der Kirchenverwaltung in Schlesien - Evangelische Kirchen
PhDr. David Pindur, Ph.D. (OU)
5.10 Veränderungen in der Kirchenverwaltung in Schlesien - Juden und andere
PhDr. David Pindur, Ph.D. (OU)
5.11 Printmedien als Träger der schlesischen Identität
PhDr. Radim Jež, Ph.D. (OU)
5.12 Tschechische Emanzipation
doc. PhDr. Andrea Pokludová (OU), Ph.D. prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (OU)
5.13 Polnische Emanzipation
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (OU)
5.14 Schlosskultur
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (OU)
5.15 Spuren des Adels in der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (OU)
5.16 Streit um Těšín 1918-1920
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (SZM), Mgr. Ivana Kolářová (SZM)
5.17 Region Hlučín in der Zwischenkriegszeit
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (OU)
5.18 Tschechisch-Schlesien (1938-1939)
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (SZM)
5.19 Ostrava-Opava Operation
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (SZM)
5.20 Underground in Tschechisch-Schlesien 1970-1989
Mgr. Tomáš Herman (OU)
5.1 Die Revolution 1848-1849 (Wahlen zum Reichstag und zum Frankfurter Landtag)
Die Revolution von 1848/49 wird manchmal vereinfachend als "Frühling der Nationen" bezeichnet. Tatsächlich brach sie nicht in erster Linie über nationale Fragen aus, sondern war eine Reihe von Teilrevolutionen - politisch, wirtschaftlich, sozial, national und kulturell.
In der zweiten Juniwoche 1848 fanden in Wien die Wahlen zum Reichstag statt, dessen Hauptaufgabe es war, die Verfassung vorzubereiten und die nationalen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu regeln. Das Wahlrecht wurde männlichen österreichischen Staatsbürgern gewährt, die mindestens 24 Jahre alt waren und seit mindestens sechs Monaten im Wahlbezirk wohnten. Arbeiter, die für einen Tages- oder Wochenlohn arbeiteten, waren nicht wahlberechtigt. Die Wahlen waren indirekt - die einzelnen Gemeinden wählten Wähler, die dann in das Zentrum des Wahlkreises gingen und den Abgeordneten wählten. In Schlesien gab es neun ländliche Wahlkreise mit jeweils etwa 50.000 Einwohnern und den städtischen Wahlkreis Opava. Es gab sechs Wahlkreise in der Region Opava und vier in der Region Těšín. Die Gesamtzahl der Wahlberechtigten betrug 45 885, also fast ein Zehntel der Bevölkerung. Unter den gewählten Wählern waren in den ländlichen Wahlbezirken vor allem Bauern, Gärtner, Hausbesitzer, erbende Vogte und Handwerker vertreten, in Opava dagegen Kaufleute, Gewerbetreibende, Freiberufler und Angestellte. Einer der gewählten Abgeordneten, Hans Kudlich, ein Jurastudent aus Úvalno, reichte beim Reichstag in Wien einen Antrag zur Abschaffung des Frondienstes und der Leibeigenschaft ein.
Das Gesetz über die Abschaffung des Frondienstes und der Leibeigenschaft gegen Entschädigung wurde dann am 7. September 1848 erlassen. Für das Land, d.h. für die große Mehrheit der damaligen Bevölkerung, war die Frage der Fronarbeit und der Leibeigenschaft am wichtigsten. Im Landesarchiv in Opava sind Beschwerden und Forderungen von 21 schlesischen Gemeinden (und Belege für Beschwerden von drei weiteren Gemeinden und drei Städten) aufbewahrt, die in den Monaten April bis Juli an den schlesischen Volkskonvent (Landesversammlung) geschickt wurden - auf der Karte markiert . Die Bauern forderten die Abschaffung des Frondienstes, der Geld- und Sachleistungen, der Einzahlungen in die Hauskasse, des Zehnten, beschwerten sich über die Schäden, die die herrschaftlichen Tiere auf ihren Feldern anrichteten, und über das drückende Laudemium (eine Gebühr, die bei der Übertragung von Grund und Boden gezahlt wurde).
Die nationale Situation in Österreichisch-Schlesien war so, dass die Tschechen zahlenmäßig und politisch die schwächste der drei Nationalitäten darstellten. Die im mittleren und östlichen Teil Österreichisch-Schlesiens lebende slawische Bevölkerung war überwiegend nationalistisch unbestimmt, und die Agitation spielte eine entscheidende Rolle für ihr nationales Profil. Die polnische Agitation in Teschen war viel aktiver als die tschechische Agitation im Jahr 1848, und dasselbe gilt für die Rolle der Polen aus Schlesien auf dem Slawenkongress. Die Vertreter der tschechischen Intelligenz in Těšín unterstützten eher die Idee der slawischen Solidarität, während die Vertreter des polnischen Lagers das polnische Nationalprogramm betonten. Die Deutschen kamen politisch besser vorbereitet in die Revolution von 1848, unterstützt durch das Umfeld in Opava. In Opava war das Eindringen der Ideen des deutschen Nationalismus mit Kontakten nach Wien und einer beträchtlichen Fluktuation der Intelligenz (Angestellte, Lehrer, Juristen usw.) verbunden. Das Jahr 1848 bedeutete für Österreichisch-Schlesien eigentlich das Ende der Möglichkeiten - die Menschen wurden mehr und mehr in Deutschen, Tschechen und Polen aufgeteilt.
In Těšín begannen Ludwik Klucki, Andrzej Ciencała und Paweł Stalmach im Mai 1848 mit der Herausgabe des Tygodnik Cieszyński. Jan Kozánek, Gerichts- und Rechtsreferendar in Opava, und Arnošt Plucar, Professor am Evangelischen Gymnasium in Těšín, arbeiteten im tschechischen Geist. Die Opavauer Deutschen reagierten missbilligend auf die Prager Staatsforderungen (die Vereinigung der Länder der böhmischen Krone unter der Zentralbehörde in Prag) und schickten Anfang April 1848 eine Abordnung unter der Leitung von Franz Heine nach Wien. Waren die Deutschen mit der Wiederherstellung der böhmischen Krone nicht einverstanden, so lehnten die Tschechen ihrerseits die Eingliederung der böhmischen Länder in das großdeutsche Projekt ab und verweigerten die Teilnahme an den Beratungen des Frankfurter Parlaments. In Schlesien wurden jedoch, anders als in Böhmen und Mähren, in allen sieben Wahlkreisen Wahlen nach Frankfurt abgehalten. Die wohl bekanntesten schlesischen Abgeordneten in Frankfurt waren Lichnovský, Kalchberg, Demel und Kudlich. Felich Lichnovský von Voštice hatte Güter sowohl im österreichischen (Hradec nad Moravicí) als auch im preußischen Schlesien und wurde für den preußischen Wahlbezirk Ratiboř nach Frankfurt gewählt. Josef von Kalchberg, ehemaliger Professor für Staatskunde an der Theresianischen Ritterakademie, war der Verwalter der Güter Karl Ludwigs von Österreich-Teschen und Erzieher der Söhne von Karl. Der Těšíner Jurist (und spätere Těšíner Bürgermeister und Landes- und Reichsbotschafter) Johann Demel von Elswehr war eine der Säulen des deutschen liberalen Lagers in Těšín. Josef Hermann Kudlich (später auch Landes- und Reichsabgeordneter) war der ältere Bruder von Hans Kudlich. Schließlich wurde auch ein Tscheche in das Frankfurter Parlament gewählt, allerdings aus der Region Hlučín im preußischen Schlesien. Das war der Hlučín-Kaplan Cyprian Lelek. Die Revolution in den habsburgischen Ländern wurde schließlich niedergeschlagen (genau wie die Revolution in den deutschen Ländern), der österreichische Reichstag und das Frankfurter Parlament wurden aufgelöst. In den habsburgischen Ländern brachte die Revolution jedoch wesentliche Errungenschaften - die Abschaffung von Frondienst und Leibeigenschaft und die Einführung der kommunalen Selbstverwaltung. Für Schlesien brachte die Revolution einen weiteren wichtigen Aspekt - die Trennung von Mähren und damit die Wiedererlangung des Status eines unabhängigen Kronlandes (den Schlesien unter Joseph II. verloren hatte).

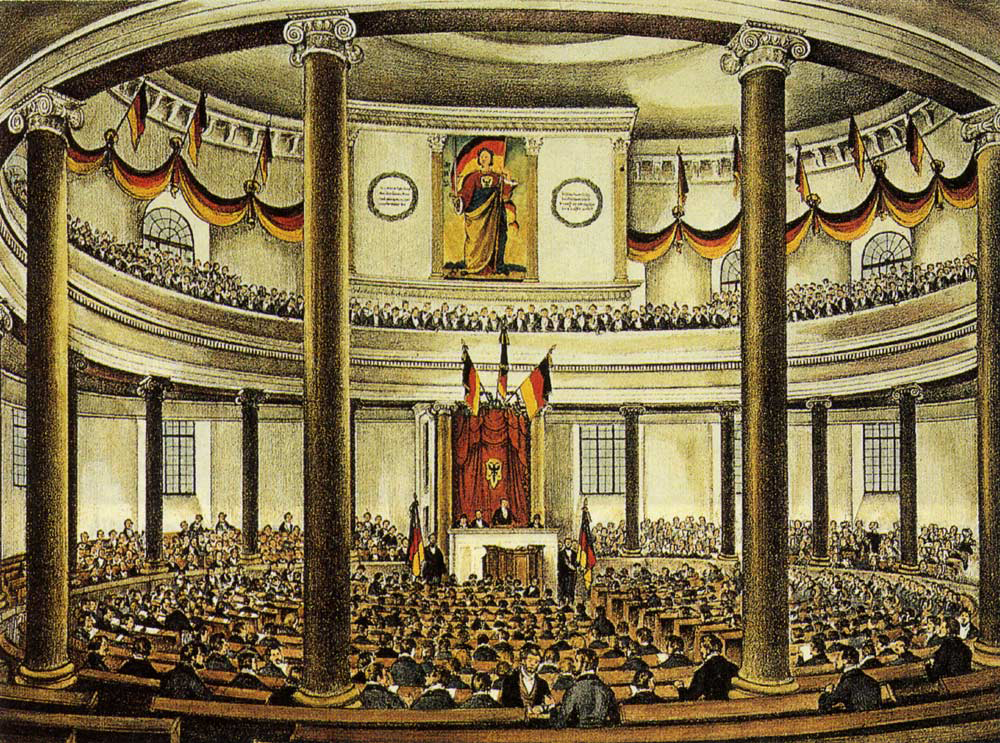
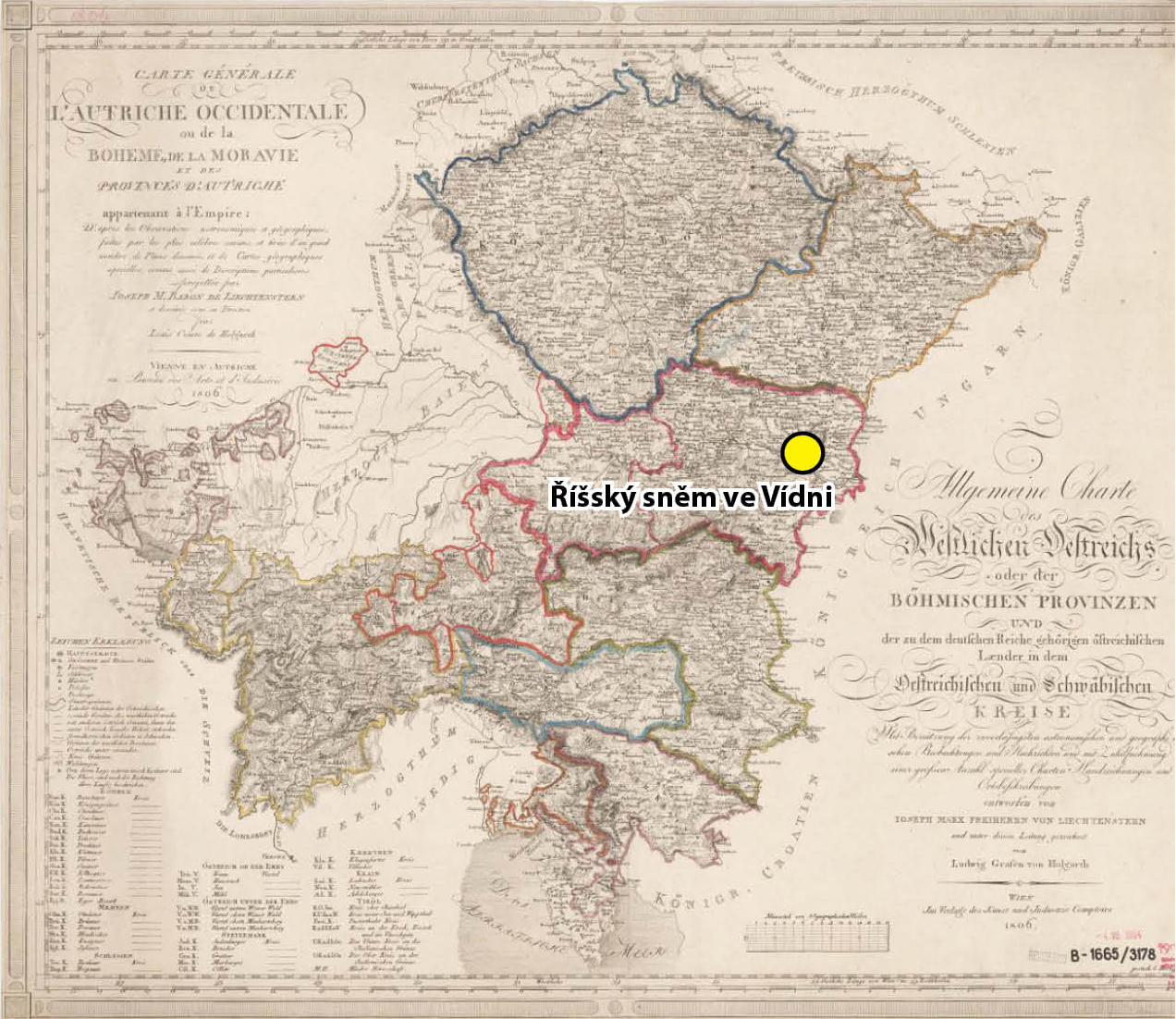
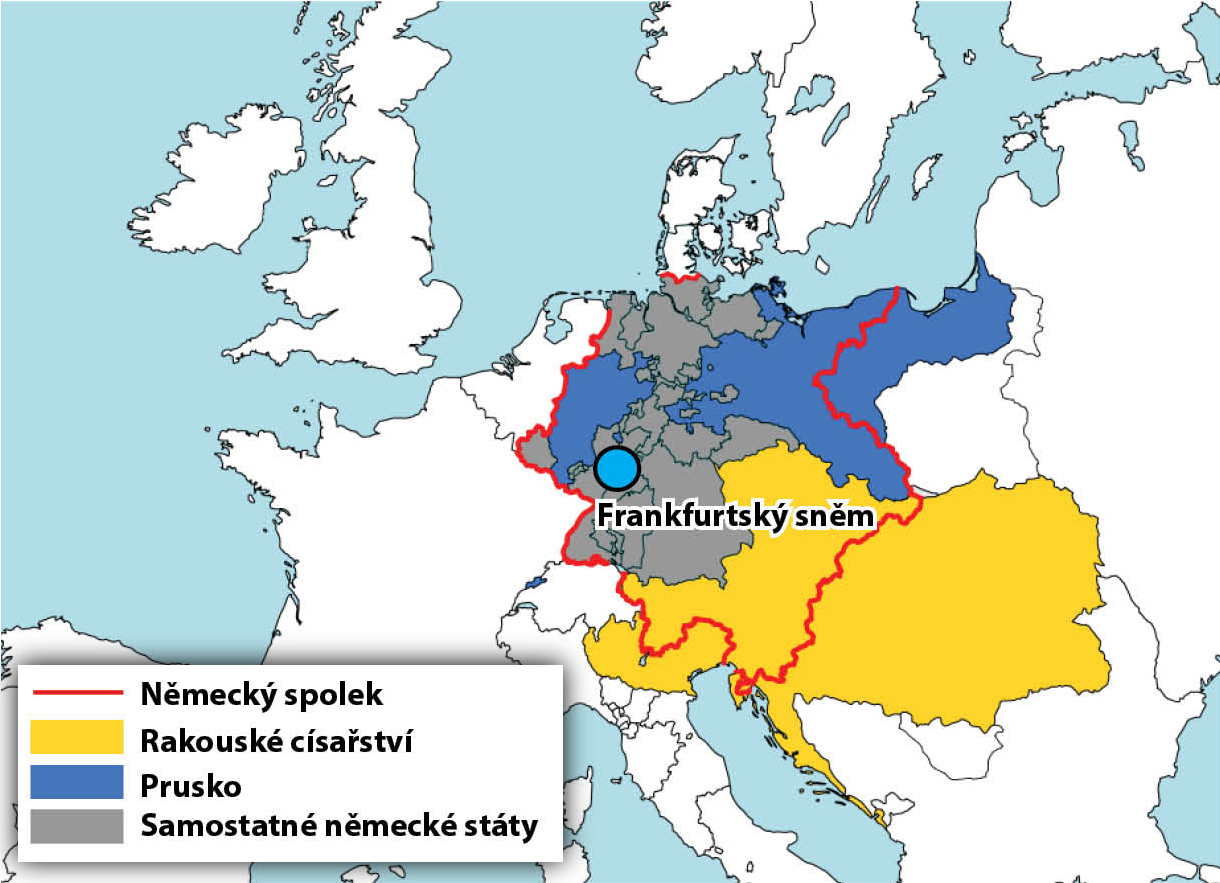
5.2 Provinzial- und Reichstagswahlen in Schlesien 1861-1918
Nach dem Vorspiel von 1848 wurde 1861 der Parlamentarismus in der Habsburgermonarchie dauerhaft etabliert. Er wurde zu einer konstitutionellen Monarchie mit einem zentralistischen System, in dem die Provinzbehörden eher begrenzte Befugnisse hatten. Nach dem Landesgesetz von 1861 waren die obersten Befugnisse des Landtags folgende: landwirtschaftliche Angelegenheiten, aus dem Landeshaushalt finanzierte öffentliche Gebäude, aus dem Landeshaushalt finanzierte karitative Einrichtungen und Angelegenheiten des Landeshaushaltes. Der Landtag hatte begrenzte Befugnisse (er musste nach den allgemeinen Gesetzen handeln) in den Angelegenheiten der Gemeinden, der Kirchen, des Schulwesens und der Armee.
Ab 1861 bestand die Landesversammlung aus dem Bischof von Wrocław, neun Mitgliedern der Kurie der Großgrundbesitzer, 10 Mitgliedern der Stadtkurie, zwei Mitgliedern der Handels- und Gewerbekammer Opava und neun Mitgliedern der Kurie der Landgemeinden. Es gab nur einen Wahlkreis für ganz Schlesien, und die Wahl wurde in Opava abgehalten.
In der Kurie der Städte und in der Kurie der Landgemeinden durften jene Männer wählen, die den sogenannten Steuerzensus erfüllten, d.h. wenn sie direkte Steuern von mindestens 10 Zloty pro Jahr abführten. Im Jahr 1897 wurde die Steuerzählung um die Hälfte reduziert, d.h. auf 5 Zloty. direkte Steuern pro Jahr. Neben den Steuerwählern hatten die so genannten Intelligenzwähler, d.h. Geistliche, Hof-, Staats- und Provinzbeamte und Beamte des öffentlichen Fonds, pensionierte Offiziere, dienende und pensionierte Soldaten ohne Offiziersrang, Inhaber von Doktortiteln, die an einer örtlichen Universität erworben wurden, und Lehrer, das Recht, in der Kurie der Städte und Landgemeinden zu wählen, unabhängig von der Zahlung von Steuern. Die Wahlen in der Landkurie waren zunächst indirekt (die Wähler wählten die Wahlmänner, und nur die Wahlmänner wählten die Abgeordneten), ab 1897 dann direkt.
Im Reichsrat hatte das kleine österreichische Schlesien eine geringe Vertretung - ab 1861 waren es sechs Abgeordnete von 343, ab 1873 10 Abgeordnete von 353, ab 1897 12 Abgeordnete von 425 und ab 1907 15 Abgeordnete von 516. In den Jahren 1861 bis 1873 gab es keine gesonderten Wahlen, sondern die Mitglieder des Reichsrates wurden von der Landesversammlung aus ihrer Mitte gewählt - zwei Mitglieder wurden vom Gutsherrenbezirk, eines von der Stadt Opava und der Handels- und Gewerbekammer Opava, eines von den Städten außerhalb Opavas und zwei von den Landkreisen entsandt.
Badenis Wahlrechtsreform fügte 1897 Schlesien hinzu zwei neue Sitze für die Reichsratswahlen und damit zwei neue Wahlkreise in der neu geschaffenen fünften Generalkurie, in der alle erwachsenen männlichen Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft stimmten, unabhängig davon, welche Steuern sie zahlten. Zu den 32 833 Wählern, die in diesem Jahr im Kurium der Landstände oder im Kurium der Städte oder im Kurium der Landgemeinden stimmberechtigt waren, kamen 77 939 Wähler, die nur zwei Abgeordnete entsandten. Das Wahlrecht in der Kurie der Städte und in der Kurie der Landgemeinden war bis 1907, wie bei den Provinzwahlen, an einen Steuerzensus gebunden, der ursprünglich 10 Zloty betrug, und ab der Wahl von 1885 auf 5 Zloty reduziert wurde. und ab den Wahlen von 1897 auf 4 Zloty. Im Jahr 1907 wurde das allgemeine, geheime, direkte und gleiche Wahlrecht für Männer bei den Reichsratswahlen eingeführt. Die Gesamtzahl der Wahlberechtigten betrug 126.668 bei einer Einwohnerzahl von 634.800. Das Kuriensystem wurde damit abgeschafft. Schlesien wurde in sechs städtische und neun ländliche Wahlkreise aufgeteilt. Auch nach der Abschaffung des Kuriensystems hatte nicht jede Wählerstimme das gleiche Gewicht. Zum Beispiel hatte der städtische Wahlbezirk Opava 4 498 Wähler, während der städtische Wahlbezirk Radvanice 14 154 Wähler hatte.
In Österreichisch-Schlesien dominierten die politischen Vertreter der deutschsprachigen Klassen vollständig, während sich die viel schwächeren Vertreter der Tschechen und Polen in Schlesien in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts von der gegenseitigen Zusammenarbeit, basierend auf einer Progression gegen die privilegierte Stellung der deutschen Eliten, über die gegenseitige Rivalität um die Jahrhundertwende bis hin zum erbitterten Antagonismus in den letzten Jahren vor dem Krieg abwandten.
Die Vertreter der Tschechen und Polen waren seit der Einführung des allgemeinen Wahlrechtes im Reichsrat stärker vertreten als in der schlesischen Provinzialversammlung, was angesichts ihrer geringeren Repräsentation in der Mittel- und Oberschicht logisch ist - der Reichsrat hatte ab 1907 einen weniger ehrenamtlichen, d.h. weniger elitären Charakter. 1907 wurden in Schlesien neben neun deutschen Abgeordneten drei Tschechen in den Reichsrat gewählt (der sozialdemokratisch-zentralistische Petr Cingr, der sozialdemokratisch-autonome Čeněk Pospíšil und der alte Mann Karel Rolsberg) und drei Polen (die Sozialdemokraten Tadeusz Reger und Ryszard Paweł Kunicki und der katholische Priester Józef Londzin von der Union der polnischen Katholiken).
Unter den tschechischen Abgeordneten der Landesversammlung sind Antonín Gruda, ein Pfarrer aus Opava, Mitbegründer der Opauer Matrix, Věnceslav Hrubý, ein in den staatlichen Diensten in Těšín und Opava tätiger Jurist und Herausgeber der ersten tschechischen Zeitung in Těšín seit 1894, und František Stratil, der erste tschechische Jurist in Opava und ein wichtiges Mitglied der Opauer Matrix, zu nennen. Wichtige polnische Vertreter waren der Skočov-Lehrer und Gründer der Shlonzakov-Bewegung Josef Kozdon, der Těšíner Rechtsanwalt Jan Michejda (ein Vertreter der Protestanten) und der katholische Katechet am Těšíner Gymnasium Ignacy Świeży.
5.3 Parlamentswahlen in Schlesien 1918-1938
Die Ergebnisse der Wahlen zur Abgeordnetenkammer der Nationalversammlung der Tschechoslowakei sind am besten geeignet, die politischen Sympathien und die politische Orientierung der Bevölkerung in der Zwischenkriegszeit zu verstehen.
Die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Schlesien in die Abgeordnetenkammer der Nationalversammlung der Tschechoslowakei enthalten einige Besonderheiten im Vergleich zu den Ergebnissen der Parlamentswahlen in den südlichen Regionen der tschechischen Länder. Einer der Gründe für diese Unterschiede ist der wirtschaftliche Charakter der einzelnen Bezirke, der sich in den starken Positionen der Parteien widerspiegelte, die in den Bezirken des Ostrauer Industriegebietes als Arbeiterparteien auftraten (KSČ, ČSSD); in Bezirken mit einer starken Vertretung oder Vorherrschaft der deutschen Bevölkerung in Jesenicko, Krnov, Bruntál war es die DSAP (in den 1920er Jahren), bzw. im gleichen Zeitraum und in den gleichen Bezirken die DNSAP. Die KSČ dominierte oft in den Bezirken und Städten des Kohlereviers und hatte auch eine bedeutende Stellung in Frýdek und in den Gerichtsbezirken Český Těšín und Jablunkov, mit einer großen Bevölkerung polnischer Nationalität.
Agrarparteien: Die tschechische Partei (REP) war schwächer als der Durchschnitt der tschechischen Länder; sie fand relativ am meisten Sympathisanten in den Gerichtsbezirken Frýdek, Opava, Klimkovice und Bílovec, etwas weniger in den Bezirken Vítkov und Český Těšín. Der Deutsche Bauernbund (BdL), der die stärkste der deutschen Aktivistenparteien in der Tschechoslowakei war, hatte in Schlesien keine Tradition; in den 1920er Jahren war er in den Gerichtsbezirken Albrechtice, Osoblaha und Jindřichov aktiv.
Die nationalen und national orientierten tschechischen Parteien waren viel schwächer als im nationalen Maßstab. Die tschechoslowakischen Nationalsozialisten (CSNS) waren am stärksten im Gerichtsbezirk Opava, teilweise in Klimkovice vertreten und Mitte der 1930er Jahre, in einer Zeit steigender nationaler Spannungen, etablierten sie sich auch in einigen Städten des Kohlereviers, in Českotěšín und Jablunkov.
Die Nationaldemokraten (ČND) und die von ihnen inspirierte Partei der Nationalen Einheit gewannen 1935 in den Gerichtsbezirken in der Regel nicht mehr als 5 % der Stimmen; relativ am erfolgreichsten waren sie 1935 im Gerichtsbezirk Fryštát (6,27 %) und auch in den 1930er Jahren vor allem in den Städten und größeren Gemeinden des Kohlereviers (Karviná, Orlová, Petřvald usw.). Die anderen tschechischen Parteien waren bei den Wahlen im Allgemeinen erfolglos, wobei die Volkspartei (CSL) in den meisten Bezirken nicht mehr als 6 % der Stimmen erhielt; am stärksten war sie 1935 in den Gerichtsbezirken Opava (weniger als 15 %), Klimkovice (fast 17 %) und Frýdek (weniger als 13 %) vertreten.
Die deutschen Parteien wurden in aktivistische (mit dem herrschenden Regime kooperierende) und nicht-aktivistische (nicht-kooperierende, die Zerschlagung der Tschechoslowakei anstrebende) Parteien unterteilt. Bei den Parlamentswahlen im April 1920, bei denen sie in einer Koalition auftraten, gewannen die negativistischen Parteien (DNP, DNSAP) mehr als die Hälfte aller Stimmen in einer Reihe von Bezirken in den bergigen Regionen Jeseník, Krnov und Bruntál, weniger in den Regionen Opava und Bílovec. Nach der Einstellung der Tätigkeit bzw. Auflösung dieser Parteien im Jahr 1933 dominierte Henleins SdP die Parlamentswahlen im Mai 1935 in allen Bezirken mit überwiegend deutscher Bevölkerung; selbst im tschechisch dominierten Bezirk Hlučín erhielt die SdP 64,35 % der abgegebenen Stimmen.
Von den deutschen sog. aktivistischen Parteien war die stärkste Partei bei diesen Wahlen die Sozialdemokratie (DSAP), die in den Bezirken Vrbno (30,83 %) und Bruntál (21,83 %) die meisten Stimmen erhielt, gefolgt von der Christlich-Sozialen Partei (DCV), die nur im Bezirk Zuckmantl, 26,01 %) mehr als 20 % hatte. Die deutschen Agrarier waren am stärksten im Bezirk Osoblaha (16,13 %) vertreten. In den Bezirken und Gemeinden mit überwiegend deutscher Bevölkerung konnte die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei nirgends nennenswert Fuß fassen. Die polnischen Parteien agierten meist in Koalition, 1935 schlossen sie sich sogar einem autonomen Block an, in dem die stärksten slowakischen Parteien das Sagen hatten. Diese Koalition gewann fast 35 % der Stimmen im Gerichtsbezirk Český Těšín und fast 57 % im Gerichtsbezirk Jablunkov. Die grundlegenden Gebietseinheiten für die Auswertung der Wahlergebnisse wurden als statistische Daten über Gerichtsbezirke und Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern ausgewählt, was auch einen Vergleich in Bezug auf die schlesische Region oder sogar die tschechischen Länder ermöglicht. Aus der Sicht eines nationalen Vergleiches können wir z. B. feststellen, dass Henleins SdP 1935 im schlesischen Gerichtsbezirk Frývaldov von allen Gerichtsbezirken in den böhmischen Ländern am stärksten war, oder dass von allen Gemeinden in den böhmischen Ländern mit mehr als 5.000 Einwohnern die Kommunistische Partei in den Jahren 1929 und 1935 den größten Stimmenanteil in der Gemeinde Lazy gewann.
Abkürzungen der erfolgreichsten Parteien mit Angabe der gebräuchlichsten Namen
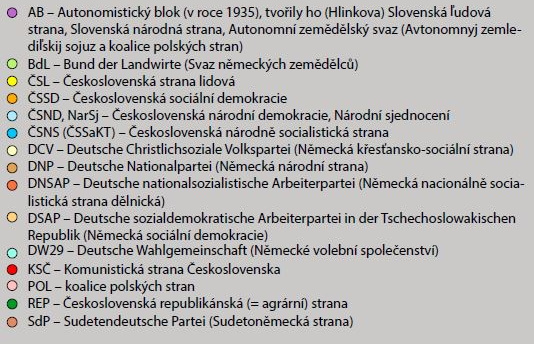
Zum Vergrößern auf das Bild klicken..
Von den deutschen sog. aktivistischen Parteien war die stärkste Partei bei diesen Wahlen die Sozialdemokratie (DSAP), die in den Bezirken Vrbno (30,83 %) und Bruntál (21,83 %) die meisten Stimmen erhielt, gefolgt von der Christlich-Sozialen Partei (DCV), die nur im Bezirk Zuckmantl, 26,01 %) mehr als 20 % hatte. Die deutschen Agrarier waren am stärksten im Bezirk Osoblaha (16,13 %) vertreten. In den Bezirken und Gemeinden mit überwiegend deutscher Bevölkerung konnte die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei nirgends nennenswert Fuß fassen. Die polnischen Parteien agierten meist in Koalition, 1935 schlossen sie sich sogar einem autonomen Block an, in dem die stärksten slowakischen Parteien das Sagen hatten. Diese Koalition gewann fast 35 % der Stimmen im Gerichtsbezirk Český Těšín und fast 57 % im Gerichtsbezirk Jablunkov. Die grundlegenden Gebietseinheiten für die Auswertung der Wahlergebnisse wurden als statistische Daten über Gerichtsbezirke und Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern ausgewählt, was auch einen Vergleich in Bezug auf die schlesische Region oder sogar die tschechischen Länder ermöglicht. Aus der Sicht eines nationalen Vergleiches können wir z. B. feststellen, dass Henleins SdP 1935 im schlesischen Gerichtsbezirk Frývaldov von allen Gerichtsbezirken in den böhmischen Ländern am stärksten war, oder dass von allen Gemeinden in den böhmischen Ländern mit mehr als 5.000 Einwohnern die Kommunistische Partei in den Jahren 1929 und 1935 den größten Stimmenanteil in der Gemeinde Lazy gewann.
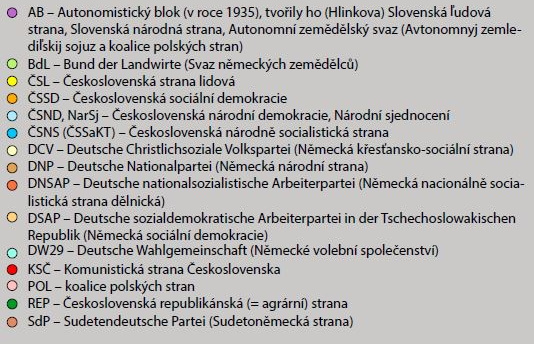
5.4 Der Prozess der Urbanisierung - die Geburt der modernen Stadt
An der Schwelle zur Neuzeit, d.h. zu Beginn des 19. Jahrhunderts, war die Region Tschechisch-Schlesien durch ein relativ dichtes Netz von Kleinstädten und ländlichen Siedlungen gekennzeichnet. Nach topographischen Erhebungen hatte keine dieser Städte eine Einwohnerzahl von mehr als 10 000.
Die Revolutionsjahre 1848/49 markierten einen bedeutenden Wendepunkt im Leben der Städte, die durch ein provisorisches Gemeindegesetz (Gemeindegesetz von 1862) die Selbstverwaltung erhielten. Es wurde der Prozess der Verschmelzung der Stadtkerne mit den Vororten eingeleitet (Opava, Těšín usw.; der Prozess der funktionalen Verschmelzung der Städte mit den umliegenden Gemeinden setzte sich während des gesamten 20. Jahrhunderts fort - Schlesisches Ostrau, Karviná, Bohumín, Třinec). In der Mitte des 19. Jahrhunderts übertraf nur die Stadt Opava die Zahl von 10.000 Einwohnern, die infolge von Verwaltungsänderungen zur Hauptstadt des Herzogtums Ober- und Niederschlesien wurde, was ihre städtische Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten stimulierte. Das Wachstum der Stadtbevölkerung gilt als einer der Indikatoren der Urbanisierung; es fand in der Region bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt und verstärkte sich durch die gleichzeitigen Auswirkungen der Migration und des demografischen Übergangs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In Orten mit einer Konzentration von Schwerindustrie entstanden in der Nähe von traditionellen Verwaltungszentren wie Fryštát Industriestädte, z.B. Karviná. Die dynamische Entwicklung am Ende der Monarchie brachte weitere industrielle Städte hervor, wie das polnische Ostrava, Frýdek, Krnov. Andere Kleinstädte stagnierten in ihrer Entwicklung. Die Einwohnerzahl am Ende der Monarchie war kein Attribut für eine moderne Stadt, sondern für eine moderne Infrastruktur und ein entwickeltes kulturelles Leben. Wasserversorgungs- und Kanalisationsnetze wurden in den Verwaltungszentren gebaut, d.h. in Opava, Frýdek, Těšín, Bohumín, Krnov, Bruntál. Das war nicht für alle Kleinstädte üblich. Gaswerke zur Verteilung von Gas an das öffentliche Netz gab es in Opava (1859), Krnov (1866) und Těšín (1882). Das älteste Kraftwerk wurde in Frýdek (1890/91) gebaut; bis zum Ende der Monarchie waren noch städtische Kraftwerke in Polska Ostrava (1895), Krnov (1903), Opava (1904) und Těšín (1911) in Betrieb. Der Bau eines Kraftwerks war in der Regel mit dem Betrieb von Straßenbahnen in der Ortschaft verbunden.
Die Kriegsereignisse des 20. Jahrhunderts wirkten sich auch auf die Entwicklung der schlesischen Städte aus, z. B. die Teilung von Těšín in Cieszyn und Český Těšín im Jahr 1920. Mit der Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach 1945 vertiefte sich die Entvölkerung der Städte im westlichen Teil der Region (Jesenicko), die trotz der Siedlungspolitik der Nachkriegszeit aufgrund der stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung der Region bis heute anhält. Bis 1989 wurden innerhalb der Städte der industriellen Agglomeration intensive Wohnsiedlungen gebaut, z.B. Orlová-Lutyně, Karviná-Ráj. Infolge der Unterhöhlung und der intensiven Industrietätigkeit befanden sich einige traditionelle Städte auf dem Zenit ihrer Entwicklung, z.B. Slezská Ostrava, Orlová, Fryštát. Havířov wurde zu einer neuen Stadt, gebaut auf der grünen Wiese, für die die Entvölkerung in der Ära der postsowjetischen Transformationswirtschaft symptomatisch wurde. Heute erfüllen alle Städte der Region die Kriterien eines modernen Wohnortes, trotz der Luftverschmutzung, eine der Folgen der industriellen Produktion, der lokalen Verschmutzer und des Autoverkehrs. Die Städte in der Region durchliefen und durchlaufen auf ihrem Weg zu modernen Siedlungen mehrere Entwicklungsphasen (z.B. derzeit die Suburbanisierung), und selbst in den Städten, die jetzt im Bevölkerungswachstum stagnieren oder sich entvölkern, ist dieser Prozess möglicherweise nicht von Dauer.
Frystat, auf Polnisch Frysztat, auf Deutsch Freistadt, ist ein historischer Teil der statutarischen Stadt Karviná. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war es der Verwaltungssitz des gleichnamigen Landkreises, d.h. Sitz des Landratsamtes und des Gerichtes.
Im Jahr 1939 entstand durch den Zusammenschluss von Fryštát mit der Berggemeinde Karviná (heute nicht mehr existent) die Partnerstadt Karwin-Freistadt. Nach dem Krieg wurde Fryštát zum "Zentrum" des Nachkriegskarviná, gebaut nach der damaligen Raumplanung, die den Bau von Wohnvierteln und später der typischen Wohnsiedlungen der Stadt betonte.

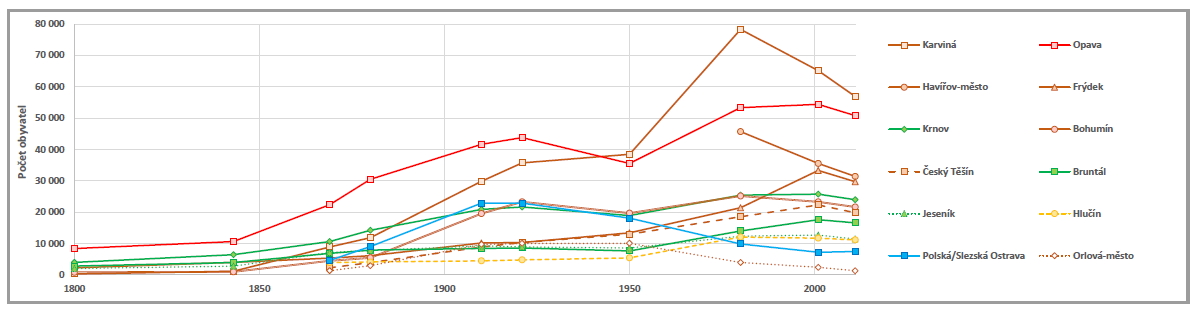

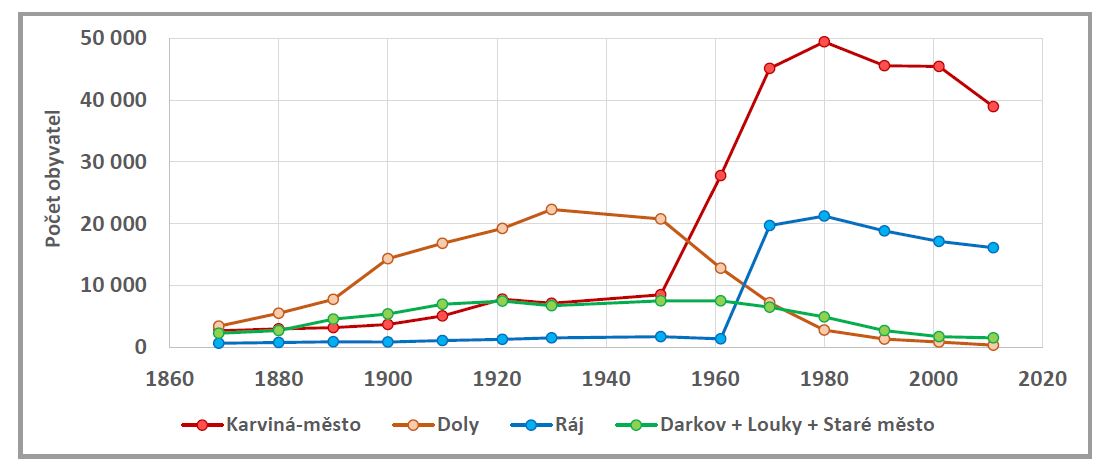
5.5 Entwicklung des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens
Anfang der 1870er Jahre bewertete der Provinzialgesundheitsrat, MUDr. Eduard Mestenhauser, den Gesundheitszustand der Bevölkerung und deren Lebensstandard mit pessimistischen Worten: "Ich kann keinen Trost anbieten; die Geschichte des Gesundheitswesens in dieser Zeit ist eine Geschichte großer sanitärer Nöte, die aus erblicher Armut resultieren, eine Geschichte des Desinteresses an der Etablierung des Gesundheitswesens, eine Zeit mit wenigen Erfolgen, die zu verbesserten sanitären Bedingungen führen." Die folgenden Jahrzehnte sahen eine Modernisierung des Gesundheitswesens vor, die durch die Ereignisse des Ersten Weltkrieges unterbrochen wurde, aber in vielerlei Hinsicht erfolgreich in den Zwischenkriegsjahren der Ersten Republik fortgesetzt wurde. Viele der zwischen 1848 und 1938 erbauten medizinischen Einrichtungen sind heute noch in Betrieb.
In den Jahren 1872-1881 sorgten dreizehn Krankenhäuser, die hauptsächlich von Städten und Orden betrieben wurden, für die medizinische Versorgung auf dem Land: in Opava (2), Odry, Krnov, Těšín (2), Bruntál, Bílsko, Mnichov pod Pradědem, Skočov, Frýdek, Jablunkov, Osoblaha. Nur das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Opava hatte das sogenannte Öffentlichkeitsrecht, das es verpflichtete, Patienten ohne Unterschied des Zustandes, der Religion oder der Krankheit aufzunehmen. Die Krankenhausversorgung wurde weitgehend von den Patienten selbst bezahlt; das Krankenversicherungssystem war erst im Entstehen begriffen. Nur die Armen waren von der Zahlungspflicht für eine solche Behandlung befreit.
Bis 1910 stieg die Zahl der Krankenhäuser auf dem Land auf 29; auch Industrieunternehmen und Bergbauunternehmen gründeten neue medizinische Einrichtungen. Einige Einrichtungen hatten nur wenige Betten, wie das Städtische Krankenhaus in Jablunkov; die größten, wie das in Opava, konnten mehr als 250 Patienten auf einmal aufnehmen. Die modernsten Krankenhauseinrichtungen waren vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs die allgemeinen Krankenhäuser in Těšín, Bílsko und Bruntál, die über isolierte infektiöse Stationen, Notfall-Trauma-Stationen, chirurgische Abteilungen, moderne Einrichtungen für Die stationäre und ambulante Versorgung verfügten. Die Schlesische Landesanstalt für Geisteskranke in Opava, die 1889 gebaut wurde, war ebenfalls eine moderne Krankenhauseinrichtung.
In der Zwischenkriegszeit wurden sporadisch neue Krankenhäuser errichtet und es wurde hauptsächlich in die Erweiterung der Bettenkapazität bestehender Einrichtungen und in deren Modernisierung investiert. Die Einrichtung von Krankenhäusern für Lungenkrankheiten, d.h. vor allem für Tuberkulose, wurde zu einer der Prioritäten der öffentlichen Fürsorge. Kinderheilkunde, Geburtshilfe, Pflege für Langzeitkranke und moderne Kurbehandlungen wurden entwickelt. Das Kurwesen,, das auf der Nutzung natürlicher Heilmittel zur Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten basiert, wird als integraler Bestandteil des öffentlichen Gesundheitssystems gesehen. Einige der im Laufe des "langen" 19. Jahrhunderts auf dem Gebiet von Österreichisch-Schlesien gegründeten Kurbäder sind bis heute in Betrieb (Jeseník, Darkov, Karlova Studánka, Dolní Lipová), andere haben vor kurzem ihre Tätigkeit eingestellt (Jánské Koupele).
5.6 Mittel-, Berufs- und Fortbildungsschulen in Schlesien bis 1914
Die Rolle der Bildung hatte seit der Aufklärung an Bedeutung gewonnen und wurde durch die Einführung der allgemeinen Schulpflicht wieder aufgegriffen. Im 19. Jahrhundert stieg mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der Bürokratisierung der Bedarf an Bildung. Qualifikationszertifikate und Abschlüsse - in Pierre Bourdieus Worten: institutionalisiertes kulturelles Kapital - verbesserten die Position des Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt erheblich. Die Hochschulbildung war auch aus nationalistischer Sicht entscheidend - in einer Zeit der Konkurrenz zwischen den drei (deutschen, polnischen und tschechischen) Nationalgesellschaften war sie von strategischer Bedeutung, da sie deren weitere Entwicklung garantierte.
Obwohl die Reform von 1849/54 den Unterricht der klassischen Sprachen in den Gymnasien reduzierte, nahmen sie immer noch über 40% der Unterrichtsstunden ein. Mathematik, Physik und Naturwissenschaften erhielten eine höhere Stundenzahl als in der früheren Periode. Geschichte, Erdkunde, Deutsch, eine Regionalsprache, Religion und Wahlfächer wurden ebenfalls unterrichtet. Realschulen bildeten in handwerklichen Berufen aus und boten Möglichkeiten für technische Studien. Sie haben keine klassischen Sprachen gelehrt. Deshalb wurde den lebenden Sprachen, der Naturgeschichte, der Physik, dem Zeichnen, der Geografie, der Geschichte usw. mehr Platz eingeräumt. Realgymnasien entstanden in den letzten Vorkriegsjahren. Sie kombinierten die Lehrpläne von klassischen Gymnasien und Realschulen, waren jedoch etwas näher an den Gymnasien. Die Absolventen können an alle Arten von Universitäten und Hochschulen gehen. In den Mädchenlyzeen wurden keine klassischen Sprachen unterrichtet. Viel Raum wurde den modernen Sprachen gewidmet, und der Lehrplan umfasste Geografie, Geschichte, Religion, Mathematik, Naturwissenschaften, Zeichnen und Rechtschreibung. Zu den nicht-obligatorischen Fächern gehörten z.B. Frauenhandwerk, Hauswirtschaft, Stenografie.
Vor dem Ersten Weltkrieg wurden in Schlesien insgesamt 11 Gymnasien und Realgymnasien eingerichtet - sieben mit Deutsch als Unterrichtssprache (eines davon wurde bald wieder geschlossen), zwei mit Polnisch und zwei mit Tschechisch. Die weiterführenden Schulen waren meist deutsch. In Schlesien konnten männliche Lehramtskandidaten in allen drei Landessprachen ausgebildet werden, während Frauen nur Deutsch studieren konnten. In den letzten Jahren vor dem Krieg wurden drei Mädchenlyzeen gegründet, zwei deutsche und ein tschechisches.

Die berufliche Aus- und Weiterbildung mit dem Ziel, praktische Fähigkeiten zu entwickeln, war für die wirtschaftliche Entwicklung von großer Bedeutung. Die Staatliche Gewerbeschule wurde in Bílsko, die Landwirtschaftliche Landesschule in Horní Heřmanice, die zweijährige Landwirtschaftliche Landesschule in Chotěbuzi und zweijährige Gewerbeschulen (alle deutschen) in Opava und Těšín gegründet. In fünf oder sechs Landwirtschaftsschulen hatte die bäuerliche Jugend die Möglichkeit, sich ausbilden zu lassen. Am dichtesten (66, mit zwei Gewerbeschulen in mehreren Städten) war das Netz der Handelsschulen und kaufmännischen Schulen, die an Wochentagabenden und Sonntagvormittagen unterrichteten. Es gab deutsche, polnische und tschechische Berufsschulen. Schließlich gab es noch Webereischulen, eine Korbflechterschule, eine Berufsschule für Marmor und eine Berufsschule für die Granitindustrie.
5.7 Ethnographische und industrielle Ausstellungen in Schlesien
Die Wurzeln des modernen europäischen Ausstellungswesens lassen sich bis zur Großen Ausstellung der Industriewerke aller Nationen, der Crystal Palace Exhibition, bekannt als Weltausstellung, zurückverfolgen, die 1851 in London stattfand. Die Ausstellung präsentierte die Errungenschaften der industriellen Revolution und die Kultur der ausstellenden Länder. In den folgenden Jahren gab es einen weltweiten Boom bei der Durchführung von Welt-, Regional- und Landesausstellungen. In Schlesien und nordöstlichen Mähren waren die regionalen Ausstellungen untrennbar mit dem Kulturnationalismus verbunden und bildeten den Ursprung für die Entstehung der regionalen Museumsausstellungen.
der Darstellung der Volkskultur und des Alltagslebens der ländlichen und städtischen Bevölkerung gewidmet hat. Eine der frühesten tschechischen Ausstellungen in der Region, die über eine kurzfristige Ausstellung von einigen wenigen Exponaten hinausging, war die Wirtschaftsausstellung in Místek vom 7. bis 10. September 1876. Im Geiste des wachsenden kulturellen Nationalismus in der Region reagierte die "tschechische" Ausstellung auf eine Reihe von deutschen Wirtschaftsausstellungen, die seit 1863 in Nový Jičín stattfanden. Man kann von der Etablierung der Ausstellungstradition in der malerischen Textilstadt Pobeskydí sprechen; Ausstellungen, die die Entwicklung der Industrie und des tschechischen Kulturlebens präsentieren, wurden in den folgenden Jahren 1894 und 1926 veranstaltet.
Die Präsentation der Errungenschaften in der Entwicklung der modernen Landwirtschaft und Industrie war auch der Ursprung der Ersten österr.-schlesischen Gewerbe-, Industrie-, Land- und Forstwirtschaftsausstellung in Teschen, die vom 5. bis 19. September 1880 in Těšín stattfand. Die Landesausstellung war in vielerlei Hinsicht der Anstoß für die Organisation von tschechischen Ausstellungen, die sich mit der Exposition der Tschechoslowakischen Ethnographischen Ausstellung in Prag (1895) intensivierte. Am 3. September 1893 wurde in Opava die erste tschechische ethnographische Ausstellung eröffnet, die von der Opava Matrix in Zusammenarbeit mit dem Akademikerclub Opava organisiert wurde. In acht Abschnitten wurden die Vorgeschichte, die Geschichte der Region und die Volkskultur, wie Trachten und ländliche Behausungen, vorgestellt. Die Ausstellung endete am 13. September 1893 und regte in der Folge die Sammeltätigkeit zur schlesischen Volkskunst an.
Die Aufmerksamkeit der tschechischen Kulturschaffenden richtete sich dann auf die Region Těšín. Die bevorstehende Ausstellung in Orlova, einem wichtigen Wallfahrtsort in der Region und einem neu entstehenden Industriezentrum, sollte der Öffentlichkeit ein umfassendes Bild vom Leben der Lachener in Ostschlesien vermitteln. Die Ausstellung umfasste: I. prähistorische Objekte, II. historische, literarische und künstlerische Denkmäler, III. Bergbau, IV. Kirchenobjekte, V. Brauchtumsabteilung, VI. Volksliteratur, VII. Volksmusik, VIII. Lachischer Haushalt, IX. Volkstrachten und Stickerei, X. Schulabteilung. Die Orlov-Ausstellung fand vom 2. bis 12. September 1894 statt. Die Ausstellung umfasste wertvolle Objekte aus der Sammlung des Lehrers und ethnographischen Mitarbeiters K. J. Bukovanský aus Polnisch Ostrava. Für die Orlová-Ausstellung wurde ein Modell einer schlesischen Hütte angefertigt, das auch für die ethnographische Ausstellung in Prag bestimmt war. Zur Adler-Ausstellung gehörten auch ethnographische Tage mit einem reichhaltigen Musikprogramm. Die Ausstellung wurde an 10 Tagen von 8.123 Besuchern besucht. Karel J. Bukovanský kommentierte: ''Die Schlesier kamen, um der Vergangenheit zu huldigen, nicht nur um die archaische Lebensweise ihrer Eltern und Großeltern kennen zu lernen, sondern auch die alten Elemente des traditionellen Lebens, die in der schlesischen Region noch existierten oder lebten.'' Jahre später, 1926, fand in Orlova eine zweite Ausstellung statt.

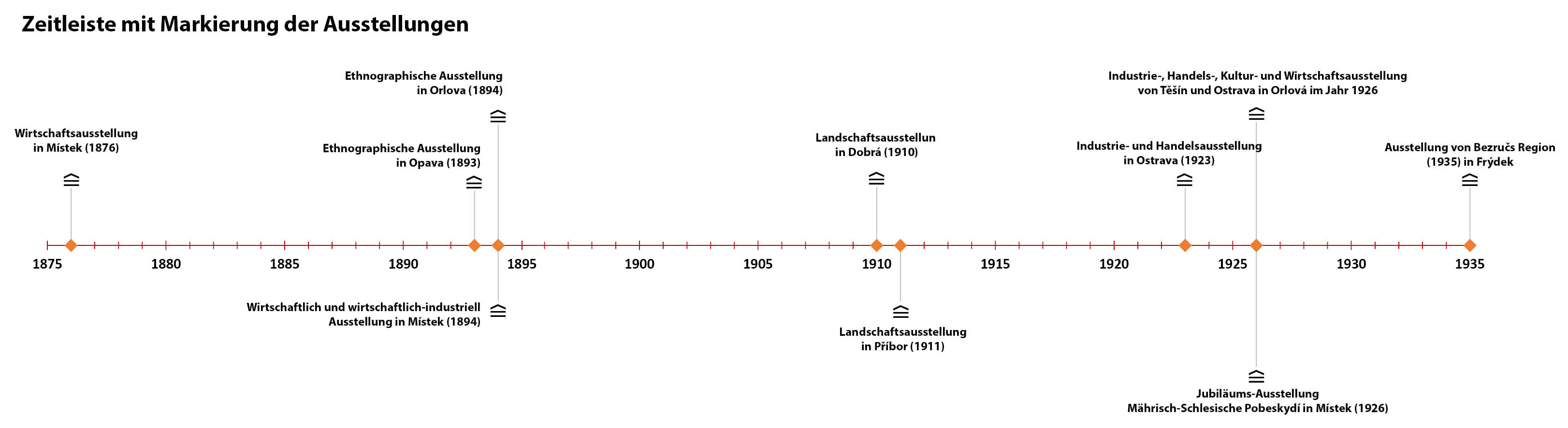
Zu den bedeutenden regionalen Ausstellungen der Vorkriegszeit können wir auch die sogenannten Landschaftsausstellungen zählen, die im Dorf Dobrá (1910) und in Příbor (1911) stattfanden. In der Zwischenkriegszeit prägten die Industrieausstellung in Mährisch Ostrau im Jahr 1923 und die Bezruč-Bezirksausstellung in Frýdek im Jahr 1935 mit ihren großen Ausstellungsflächen und hohen Besucherzahlen die Geschichte der Region. Einige der Exponate aus den oben genannten Ausstellungen befinden sich in den Sammlungen der regionalen Museen und bilden einen wichtigen Teil des regionalen Kulturerbes.
5.8 Änderungen in der Kirchenverwaltung in Schlesien - Katholische Kirche
Die preußische Annexion eines großen Teils von Schlesien während des Ersten Schlesischen Krieges beeinflusste die ohnehin komplizierte kirchliche und administrative Entwicklung dieses Territoriums grundlegend. Von der Diözese Olmütz fielen die Dekanate Hlučín, Ketř, Opavice mit einer Fläche von 1.283 km2 an Preußen. Für ihre weitere Verwaltung wurde das Amt des bischöflichen Kommissars für den preußischen Teil der Olmützer Diözese eingerichtet (1755). Der größte Teil des Territoriums des sog. Bischofskommissariats von Těšín wurde von der Diözese Wrocław an Österreich abgegeben. Es bestand aus Erzpriesterschaften (Dekanaten) mit Sitzen in Bílsko, Frýdek, Fryštát, Těšín und Vladislav ab 1654 und in Strumen ab 1738. Ein Teil des Territoriums der letzten beiden fiel an Preußen.
Im Jahr 1773 wurde die Teilung der bestehenden großen Olmützer Diözese in drei Teile - Brünn, Olmütz und Opava - vorbereitet. Durch die Bulle Pius' VI. vom 5. Dezember 1777 wurde die Diözese Olmütz zur Erzdiözese mit zwei Bistümern - Brünn und Olmütz - erhoben. Der erste Erzbischof war Antonín Theodor Colloredo-Waldsee (1729-1811). Die Diözese Opava wurde auch formell vom Papst genehmigt, aber sie wurde wegen einer Reihe von Problemen nicht ins Leben gerufen. Die Errichtung des Bistums Opava wurde (wiederum erfolglos) im Jahr 1868 nach dem verlorenen Krieg mit Preußen aktuell.
Die josephinischen Kirchenreformen brachten eine Verschlankung des veralteten und unzureichenden Modells der Pfarrorganisation durch Aufteilung in kleinere Pfarren und örtliche Kaplaneien, insbesondere in den Berggebieten der Beskiden und des Gesenkes. Die josephinische Auflösung der Klöster in Österreichisch-Schlesien betraf nur die Dominikaner (1786) und Klarissen (1782) in Opava. Die Dominikaner setzten ihre Aktivitäten fort (bis 1790), die Barmherzigen Brüder und die Elisabethaner in Těšín, die Minoriten in Opava und Krnov, die Deutschritter in Opava und Bruntál und die Piaristen in Bílá Voda und Bruntál. In Österreichisch-Schlesien wurden im Zuge der josephinischen Reformen 54 Ordensbruderschaften abgeschafft. Wie im Fall der abgeschafften religiösen Gebäude und Institutionen wurde deren Eigentum an einen religiösen Fonds übertragen, der die Errichtung neuer Kirchen und geistlicher Verwaltungseinheiten subventionierte.
Vor allem in der Region Těšín wurden aus verschiedenen Gründen (Abgeschiedenheit, demografische und industrielle Entwicklung) vor dem Ersten Weltkrieg eine Reihe neuer Pfarren und Kirchen gegründet. Im Jahr 1914 bestand der österreichische Teil der Diözese Vratislav, der vom Generalvikariat verwaltet wurde, aus 12 Erzpriesterschaften und 111 Einheiten der geistlichen Verwaltung. Ab 1899 sollte die theologische Schule in Vidnava eine eigene Priesterausbildung anbieten. Těšín wurde im Jahr 1855 zum ständigen Sitz des Generalvikariats (bis zur Auflösung der Institution im Jahr 1925). Der einzige Generalvikar, der die Bischofsweihe erlangte (30. September 1883), war der in Těšín geborene Franciszek Śniegoń (1809-1891). Neben den oben erwähnten Orden gab es in der Gegend auch Jesuiten, Böhmen, Vinzentiner und Vorsilkas. Zu den wichtigsten lokalen Wallfahrtsorten gehörten die Marienkirchen in Frýdek und bei Zlaté Hory (Mariahilf).
Vor dem Ersten Weltkrieg bestand das Erzpriestertum Opava aus acht Dekanaten (Bílovec, Bruntál, Hradec, Jakartovice, Krnov, Odry, Opava, Osoblaha) mit 96 Pfarren. Unter den Geistlichen spielte der Deutsche Ritterorden, der über einen großen Grundbesitz und Einrichtungen in der Gegend verfügte, in der örtlichen geistlichen Verwaltung eine bedeutende Rolle. Unter den anderen Orden und Kongregationen, die in diesem Gebiet tätig sind, sind die Minoriten, die Schwestern des Deutschen Ritterordens, die Töchter der Göttlichen Liebe, die Schwestern der Nächstenliebe des Dritten Ordens des hl. Zu den wichtigsten Wallfahrtsorten in diesem Gebiet gehören Cvilín und Hrabyně.
Die Verwaltung des tschechoslowakischen Territoriums des ehemaligen Generalvikariats für den österreichischen Teil der Diözese Vratislav (ab 1929 Erzdiözese) wurde 1920 durch die sog. Fürst(erz)bischöflichen Co-Missionen für das tschechoslowakische Westschlesien (Nisza, 35 Pfarren) und Ostschlesien (Těšín, 45 Pfarren) ersetzt, die von Kommissaren mit den Befugnissen von Generalvikaren geleitet wurden. Nach dem modus vivendi (1928) sollten beide Territorien zur Erzdiözese Olmütz gehören, was aber erst im Herbst 1938 geschah. Die Erzdiözese Olmütz verwaltete in den Jahren 1938-1945 vorübergehend die Erzdiözese Frýdek und Schlesisch Ostrau. In den Jahren 1938-1939 wurden 29 Pfarren aus dem von Polen annektierten Teil des tschechoslowakischen Těšín-Gebietes in die Diözese Kattowitz und am 1. Januar 1940 erneut nach Vratislav übertragen. Für den deutsch besetzten schlesischen Teil der Erzdiözese Olmütz wurde ein Generalvikariat mit Sitz in Branice geschaffen. Sie wurde von Josef Martin Nathan (1867-1947) geleitet, der seit dem 6. Juni 1943 Weihbischof war.

In den Jahren 1945-1947 wurde der tschechoslowakische Teil der Erzdiözese Wrocław von František Onderek (1888-1962) als erzbischöflicher Sonderbeauftragter verwaltet. Am 26. Juni 1947 wurde aus diesem Gebiet eine dem Vatikan unterstellte apostolische Verwaltung mit Sitz in Český Těšín geschaffen. An ihre Spitze wurde der bereits erwähnte Onderek gesetzt, mit den vollen Befugnissen eines residierenden Bischofs mit der Befugnis, höhere Weihen zu erteilen. Die Apostolische Verwaltung von Český Těšín wurde am 30. Dezember 1977 von Papst Paul VI. aufgehoben. Sein Gebiet, das damals aus den Dekanaten Frýdek, Jeseník, Karviná und Schlesisch-Ostrau bestand, wurde der Erzdiözese Olomouc angegliedert.
Papst Johannes Paul II. errichtete am 30. Mai 1996 die Diözese Ostrava-Opava mit Sitz in Ostrava. Gleichzeitig ernannte er František Václav Lobkowicz zu ihrem Bischof. Das Gebiet der neuen Diözese besteht aus den Dekanaten Bílovec, Bruntál, Frýdek, Hlučín, Jeseník, Karviná, Krnov, Místek, Nový Jičín, Opava und Ostrava mit insgesamt 276 Pfarren. Die Schutzpatronin der Diözese ist die heilige Hedwig, die auch die Schutzpatronin von Schlesien ist.
5.9 Veränderungen in der Kirchenverwaltung in Schlesien - Evangelische Kirchen
Die reiche Reformationstradition Schlesiens hat trotz der Rekatholisierung unauslöschliche Spuren hinterlassen, vor allem in Těšín. Der Vertrag von Altranstädt (1707) und die Rezession Kaiser Josephs I. (1709) brachten den schlesischen Protestanten (Augsburger Konfession, Lutheraner) teilweise Toleranz. In den Jahren 1710-1723 wurde in Těšín eine Gnadenkirche gebaut. Die sogenannte Jesuskirche, die einzige in Oberschlesien, wurde bis 1781 von Protestanten aus ganz Těšín und den angrenzenden oberschlesischen Gebieten besucht. Sie wurde auch von ihren heimlichen Gläubigen aus Mähren und Böhmen besucht. In den Jahren 1749-1785 befand sich das evangelische Konsistorium in Těšín.
Erst das sogenannte Protestantenpatent vom 8. April 1861 brachte die Gleichstellung der Protestanten. In den Jahren 1861-1914 wurden in Österreichisch-Schlesien eine Reihe weiterer Augsburger Gemeinden gegründet (Bohumín, Bruntál, Frýdek, Jeseník, Krnov, Meziříčí u Bílska, Opava, Orlová, Skočov, Staré Hamry, Třinec, Vráclavek) und eine Helvetische Gemeinde (Spálené). Unter den schlesischen Protestanten waren Deutsch und Polnisch die dominierenden Sprachen.
Während des Ersten Weltkrieges waren die tschechischen Gemeinden von der Notwendigkeit überzeugt, die evangelischen Kirchen des Augsburger und des helvetischen (reformierten) Bekenntnisses auf nationaler Basis unter Berufung auf die Traditionen der tschechischen Reformation zu vereinen. Im Dezember 1918 wurde die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (im Folgenden CCE) gegründet, die deutschen und polnischen Gemeinden haben sich jedoch nicht angeschlossen. Die bestehenden Superintendenturen und Seniorate wurden aufgelöst. Vier CCE-Gemeinden aus Schlesien (Český Těšín, Frýdek, Orlová, Staré Hamry) waren Teil des Mährisch-Schlesischen Seniorats. Die Gemeinden in Český Těšín und Orlová wurden während der polnischen Annexion nach München 1938 liquidiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie erneuert. Darüber hinaus wurden in Schlesien neue Gemeinden gegründet, von denen viele die Gebäude der aufgelösten Deutschen Evangelischen Kirche übernahmen. Derzeit besteht das Mährisch-Schlesische Seniorat der CCE aus 25 Gemeinden; in Schlesien sind es die Gemeinden Bruntál, Český Těšín, Frýdek-Místek, Javorník, Jeseník, Krnov, Odry, Opava, Orlová, Ostravice (bis 1951 Staré Hamry), Šenov u Ostravy und Vítkov.
Die meisten Protestanten in der Region Těšín nach dem Ersten Weltkrieg bekannten sich zur polnischen Nationalität. Bereits am 20. Dezember 1918 wurde das schlesische Seniorat (Seniorat Śląski) unter der Aufsicht des Konsistoriums in Warschau errichtet. Bei einem Treffen in Třinec am 16. August 1920 bildeten sechs Gemeinden aus dem tschechoslowakischen Teil von Těšín (Bystrice, Dolní Bludovice, Komorní Lhotka, Návsí, Orlová, Třinec) die Augsburger Evangelische Kirche in Ostschlesien in der Tschechoslowakei, die erst am 13. Juli 1923 von der Regierung anerkannt wurde. Nach dem Kloster schloss sie sich am 7. November 1938 der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in der Polnischen Republik an. Bald nach dem Fall Polens im September 1939 wurden die Gemeinden in dem von den Deutschen besetzten Gebiet von Těšín Teil der sogenannten Schlesischen Evangelischen Kirchenprovinz in Wrocław. Dies war eine Zeit der Germanisierung der Kirche und der Verfolgung der polnischen evangelischen Geistlichen und Laien.
Die ersten Jahre nach der Befreiung waren geprägt von der Tendenz, die Augsburger Gemeinden in Těšín der CCE anzuschließen. Die Gemeinden lehnten dies jedoch ab, konsolidierten sich und garantierten gleiche Rechte für Tschechen und Polen. Erst am 19. Mai 1948 wurde die Augsburger Kirche staatlich anerkannt. Im Jahr 1950 nahm sie den neuen Namen "Schlesische Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses" (SCEAV) an, an deren Spitze ein Bischof und ein siebenköpfiger Kirchenvorstand mit Sitz in Český Těšín stehen. Es wurden mehrere neue Gemeinden gegründet und die Kirche wurde in zwei Seniorate geteilt, das tschechische Těšín (1969-1998 oben) und das Ostrava-Karviná (1969-1998 unten).
Ein langwieriger innerkirchlicher Konflikt zwischen der illegalen Gründerbewegung der Mission und der gegenüber dem kommunistischen Regime freundlichen Führung der SCEAV führte im März 1991 auf einer außerordentlichen Synode in Třanovice zur Absetzung des Bischofs und seines Stellvertreters. Sie erkannten die Synode jedoch nicht an und lösten ein Schisma aus. Die Anhänger der ehemaligen Leitung gründeten schließlich die Lutherische Evangelische Kirche in der Tschechischen Republik (LECAV), die am 19. Januar 1995 registriert wurde. Ihr Bischof hat seit 2000 seinen Sitz in Bystřice. Derzeit gibt es fünf Gemeinden innerhalb des LECAV (Český Těšín, Bystřice, Hrádek, Prag, Třinec). Der SCEAV wurde 1998 in fünf Seniorate (Jablunkov, Trinec, Frýdek, Těšín-Havířov, Ostrava-Karviná) mit 21 Gemeinden aufgeteilt.

Am 26. Oktober 1919 bildeten die deutschen Protestanten in den Böhmischen Ländern die Deutsche Evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien (nachfolgend DEK). Ihre schlesische Landeskirchliche Gemeinschaft, die von einem Kirchenrat (Ältesten) und einem Vorstand geleitet wurde, bestand aus den Pfarrgemeinden Bohumín (Nový), Bruntál, Český Těšín, Frýdek, Holčovice, Jeseník, Krnov, Moravská Ostrava, Opava, Spálené und Vráclavek. Die DEK hörte nach dem Abzug der Deutschen praktisch auf zu existieren. Die Tatsache wurde rechtlich durch das Gesetz vom 6. Mai 1948 bestätigt, dass die Auflösung der Kirche am 4. Mai 1945 erklärte.
Zu den kleinen protestantischen Kirchen, die heute in Schlesien tätig sind, gehören die Kirche der Siebenten-Tages-Adventisten (mit Ursprüngen in Těšín im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts), die christlichen Gemeinden und die Apostolische Kirche, deren formeller Sitz sich in Těšín befindet. Die Kirche der Brüder verwaltet das Gebiet Schlesiens innerhalb zweier Seniorate (genannt Těšín und Nordmähren).

5.10 Veränderungen in der Kirchenverwaltung in Schlesien - Juden und andere
Seit dem Mittelalter sind die Juden die ausgeprägteste religiöse Gruppe in Schlesien. Auf der Grundlage des Toleranzpatents von Kaiser Karl VI. aus dem Jahr 1713 siedelten sich Juden vor allem in Teschen an. Am 17. April 1752 wurde ein Toleranzpatent für Juden in Österreichisch-Schlesien ausgestellt, das 119 jüdische Familien schützte, die meisten von ihnen (87) in Teschen. Trotz vieler Einschränkungen wuchs die jüdische Bevölkerung. Das Toleranzpatent von Josef II. vom 15. Dezember 1781 garantierte ihnen die Religionsausübung, galt aber nicht für Synagogen und Rabbiner. Erst 1847 wurde ein Rabbiner für die Region Teschen offiziell bestätigt.
Die Verfassung der Tschechoslowakischen Republik vom 29. Februar 1920 garantierte den Anhängern des Judentums gleiche Rechte. Der Dachverband der lokalen JRG war die Union der JRG in Schlesien, und die höchste Verwaltungseinheit in den böhmischen Ländern war ab 1927 der Oberste Rat der JRG in Böhmen, Mähren und Schlesien. In der Zeit der Ersten Republik lag die Zahl der JRG in Schlesien bei etwa 10 (1922 kam z.B. in Český Těšín ein weiteres hinzu). Die staatliche Kultusverwaltung war mit der Aufsicht über die jüdische Gemeinde betraut. Die Annexion von Teilen von Tschechisch-Schlesien im Herbst 1938 durch Deutschland und Polen verschlechterte sich die Lage dieser Bevölkerung erheblich. Nach der Besetzung der restlichen böhmischen Länder durch Deutschland im März 1939 begann die Anwendung der antisemitischen Nürnberger Gesetze auch im Protektorat. Nach und nach wurden Synagogen und Gotteshäuser, Friedhöfe und andere Gebäude, die dem jüdischen Volk gehörten, zerstört oder für die Öffentlichkeit geschlossen. Nur wenige schlesische Anhänger des Judentums überlebten den Völkermord der Nazis. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden nur die Jüdische Gemeinde Ostrava und einige Synagogengemeinden in einigen schlesischen Städten (Bohumín, Český Těšín, Krnov, Opava, Orlová) wiederhergestellt, die meisten verschwanden jedoch nach und nach. Heute unterstehen die Juden in Tschechisch-Schlesien der religiösen Verwaltung der Jüdischen Gemeinde von Olmütz (Bezirke Bruntál und Jeseník) und Ostrau (alle anderen).
Tschechoslowakische Hussitische Kirche. Von den anderen größeren christlichen Kirchen prägte die Tschechoslowakische Kirche der Tschechoslowakei (CČS, seit 1971 Tschechoslowakische Hussitische Kirche) das religiöse Profil Tschechisch-Schlesiens im 20. Jahrhundert maßgeblich. Ein Teil des tschechischen römisch-katholischen Klerus forderte seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Modernisierung der Kirche. Diese Tendenzen und Ideen verstärkten sich nach der Gründung der Tschechoslowakischen Republik, und ihr Träger war der Klub der Reformpfarrer. Im Januar 1920 wurde die CČS mit einem nationalen und reformistischen ideologischen Inhalt gegründet. Sie fand auch zahlreiche Anhänger in Schlesien, vor allem in den politischen Bezirken Frýdek-venkov und Fryštát und im angrenzenden Teil Mährens. Die Geschichte der CČS wurde in Radvanice geprägt, wo die erste CČS-Religionsgemeinschaft überhaupt am 15. Januar 1920 von dem ehemaligen katholischen Pfarrer Ferdinand Stibor (1869-1956) gegründet wurde. Seit 1922 war Radvanice auch der Sitz der Ostrauer Diözese der CČS und Stibor war der Bischof. Seit den 1920er Jahren wurde die Wiese in der Nähe des Winklerschen Glockenturms in Staré Hamry (seit 1951 Kataster der Gemeinde Ostravice) als diözesaner Wallfahrtsort genutzt, wo 1937 die Hus-Kapelle errichtet wurde. Nach München 1938 traten mehrere Religionsgemeinschaften in Tschechisch-Schlesien in das abgetretene Gebiet, ein, die meisten wurden liquidiert und ihre Mitglieder verfolgt.

Im Jahr 1950 wurde der CCC in sechs Diözesen aufgeteilt. Die Diözese Ostrava (Schlesien) bestand aus drei Bezirken (Ostrava, Orlová, Svinov). Im Jahr 1962 wurden die Diözesen Olomouc und Ostrava zu einer Diözese vereinigt, die seit 1963 Olomouc-Diözese heißt. 2020 gab es die Ordensgemeinschaften von Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Krnov, Opava, Orlová-Doubrava, Ostrava-Heřmanice, Ostrava-Moravská und Slezská Ostrava, Ostrava-Michálkovice, Ostrava-Polanka, Ostrava-Radvanice, Ostrava-Svinov, Petřvald, Rychvald, Studénka und Vratimov.
Alte katholische Kirche. Sie ist im deutschen Umfeld aus der Widerstandsbewegung gegen das auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 verkündete Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit entstanden. Vor dem Ersten Weltkrieg drang der Altkatholizismus nicht so weit in das Gebiet des heutigen Tschechisch-Schlesien ein, dass er das Bedürfnis nach einer Organisationsstruktur schuf. In Bohumín gab es jedoch eine größere altkatholische Gemeinde. Erst im Jahr 1925 wurde in Jeseník eine selbständige Ordensgemeinschaft gegründet (sie verschwand im Jahr 1945). Seit 2005 gibt es in Český Těšín eine aktive altkatholische Diaspora unter dem Pfarrer der Pfarre in Šumperk, die jetzt eine eigenständige Gemeinde ist.
5.11 Printmedien als Träger der schlesischen Identität
Gedruckte Medien - Bücher und Zeitschriften - als spezifischer Typus von Informationsträgern und eine weit verbreitete Plattform zur Pflege und Gestaltung des Ansehens der geographisch-lokalen Zugehörigkeit ihrer Leser entwickelten sich in der Region ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Allerdings wurden bis zur Mitte des folgenden Jahrhunderts nur wenige Titel veröffentlicht, und dann auch nur in deutscher Sprache. Erst nach der Verkündung des Pressegesetzes im Jahr 1862 kam es zu einem verlegerischen Aufschwung. In den folgenden Jahrzehnten begannen verschiedene thematische und politische Publikationen nicht nur in deutscher, sondern auch in tschechischer und polnischer Sprache zu erscheinen, um der Bevölkerung aller Nationalitäten zugänglich zu sein. Der liberale Ansatz während der Ersten Republik führte zu einem weiteren Anstieg der Anzahl der veröffentlichten Titel. In den Jahren 1938-1945 wurde die tschechische und dann die polnische Presse verboten, und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die deutschen Zeitschriften eingestellt. Nach einer kurzen Entspannung der Situation in den Jahren 1945-1948 galten während des kommunistischen Regimes eine Reihe von restriktiven Maßnahmen, insbesondere die Pressezensur. Einige Zeitschriften werden jedoch auch heute noch herausgegeben und versuchen, neben den digitalen Medien, den traditionellen Ansatz der Aufrechterhaltung der schlesischen Identität zu verfolgen, indem sie Artikel mit regionalen oder historisch-weltlichen Themen veröffentlichen.
Die Entwicklung des polnischen Nationalbewusstseins war mit der Gründung der Zeitschrift Tygodnik Cieszyński im Jahr 1848 verbunden, die drei Jahre später unter der Redaktion von Paweł Stalmach als Gwiazdka Cieszyńska (1851-1939) herausgegeben wurde. In Těšín, Fryštát und Ostrava wurde eine Reihe von politischen, geschäftlichen, religiösen und gesellschaftlichen Zeitschriften herausgegeben, wie Nowy Czas (1877-1927), Rolnik Śląski (1885-1939), Kresowiec (1896-1903), Głos Ludu Śląskiego (1897-1931), Dziennik Cieszyński (1906-1935), Ślązak (1909-1923), Poseł Ewangelicki (1910-1938) und Głos Robotniczy (1920-1938). Ein bedeutender Niedergang der polnischen Presse kam mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs; nach der Befreiung konnten die meisten Titel nicht wiederhergestellt werden. Unter den neueren Zeitschriften, die der in der Region Těšín lebenden polnischen Minderheit gewidmet sind, sind insbesondere Głos Ludu (seit 1945, seit 2018 nur noch Głos) und Zwrot (seit 1949) zu nennen.
Die ersten Versuche, eine tschechischsprachige Zeitschrift herauszugeben, gehen auf das Jahr 1846 zurück, als in Hlučín die Monatszeitschrift Holubice (Die Taube) erschien. Die erste regelmäßig erscheinende tschechische Zeitschrift, die auf die Stärkung des Nationalbewusstseins des schlesischen Volkes abzielte, war Opavský besedník (Oppauer Geplauder) (1861-1865). Nach ihrem Untergang wurde die Opavský týdeník (Oppauer Wochenzeitung) (1870-1913) gegründet, die zu einer publizistischen Plattform für viele tschechische Gymnasiallehrer und national orientierte Intellektuelle wurde. Eine ähnliche Funktion erfüllte im östlichen Teil Österreichisch-Schlesiens die Těšínské Noviny (Teschener Zeitung) (1894-1919), die u. a. von Vincenc Prasek, Josef Zukal und František Sláma herausgegeben wurde. Zu den politischen Zeitschriften gehörten Naše Slezsko (Unser Schlesien) (1910-1937), Slezské slovo (Das schlesische Wort) (1911-1918), Slezský venkov (Das schlesische Land) (1912-1916, 1919-1920), Opavan (Der Oppauer) (1919-1928), Svobodná republika (Die freie Republik) (1920-1938), usw. Die turbulente Entwicklung der Ostrauer Agglomeration am Ende des 19. Jahrhunderts führte zur Gründung von mehreren Dutzend Zeitungen. In Moravská Ostrava, Vítkovice oder Přívoz wurden Zeitungen speziell für die Arbeiter herausgegeben - Přítel dělníků (Der Freund der Arbeiter) (1883-1894), Práce (Die Arbeit) (1891-1898), Zájmy dělnictva (Die Interessen der Arbeiter) (1894-1897), Ostravice (1893-1897), Duch času (Der Geist der Zeit) (1899-1938), Ostravan (Ostrauer) (1901-1912), usw. Später wurden sie durch die Zeitungen České slovo (Das tschechische Wort) (1929-1945), Ostravský večerník (Die Ostrauer Abendzeitung) (1900-1941) und Ostravský kraj (Die Region Ostrau) ersetzt. Nach dem Krieg entstanden in der Region regionale Mutationen der landesweiten Zeitungen mit Specials, die auf einzelne Siedlungsgebiete ausgerichtet waren (z.B. Region Bruntálský, Krnovské noviny, Region Karvinsko, Hlasy Havířova usw.).
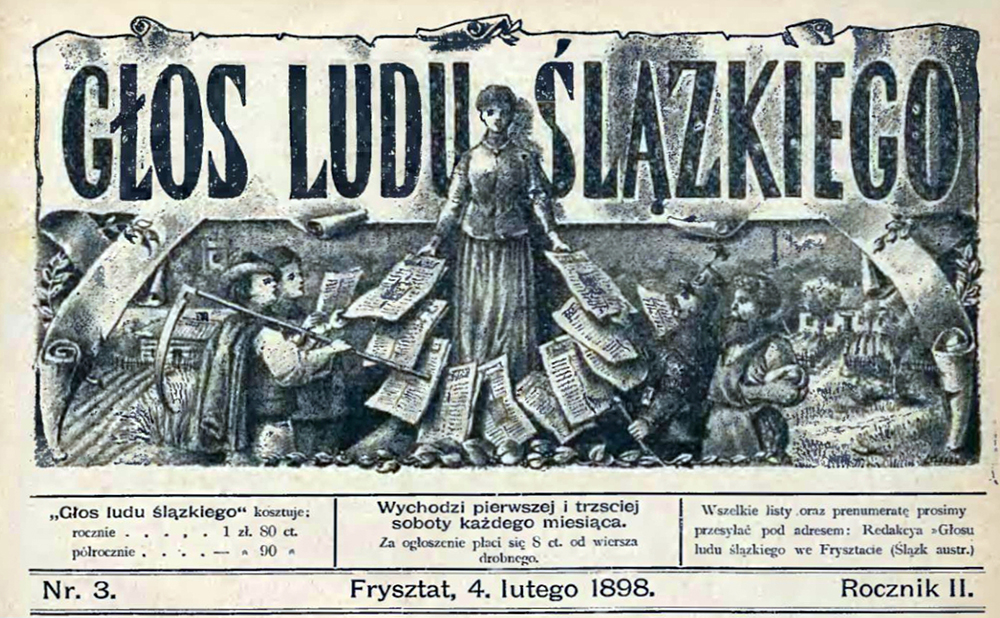
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trug die Entwicklung der Geschichte als wissenschaftliche Disziplin zur Festigung der schlesischen Identität auf der Provinz- und Lokalebene und zur Reflexion der eigenen Vergangenheit in Bezug auf das historische Land bei. Neben den Monographien zu den einzelnen historischen Regionen von Österreichisch-Schlesien und seiner unmittelbaren mährischen Umgebung (von Gottlieb Biermann, Anton Peter, Karl Knaflitsch, J. Zukal, V. Prasek, Franciszek Popiołek, Józef Londzin, Alois Adamus usw.), wurden mehrere Fachzeitschriften gegründet, von denen einige auch heute noch erscheinen - z. B. das Bulletin der Matice Opavská (seit 1878, seit 1936 als Schlesisches Sammelwerk), Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens (1905-1933) oder Zaranie Śląskie (ab 1907). Zu den neueren Fach- und Heimatgeschichtszeitschriften gehören die Zeitschrift des Schlesischen Landesmuseums (seit 1951), Těšínsko (seit 1957) oder Vlastivědné listy Slezska (Die Heimatkundeblätter Schlesiens) (seit 1975). Die Identifikation mit der Heimat wird bei den Nachkommen der Heimatvertriebenen durch die in ihren Zentren in Deutschland gegründeten Vereine und Organisationen gestärkt, die auch eigene Zeitschriften herausgeben - z.B. die monatlich erscheinende Troppauer Heimat-Chronik oder den Jägerndorfer Heimatbrief (beide ab 1949).
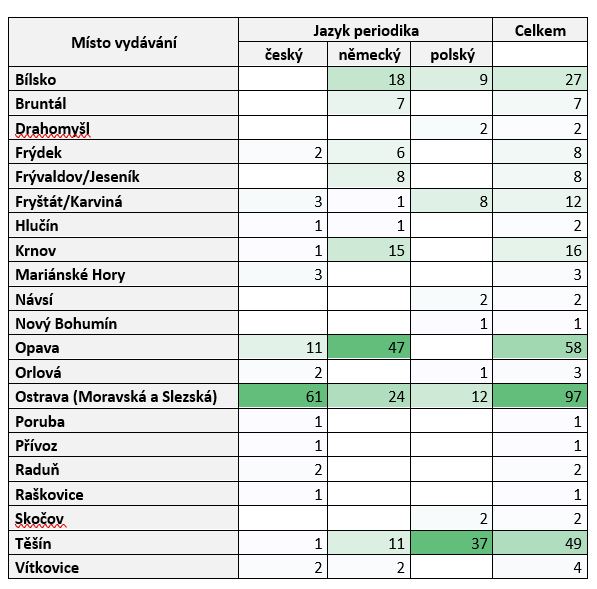
5.12 Tschechische Emanzipation
Ein tschechisches Kind in einer tschechischen Schule! Diese Worte klingen für uns heute selbstverständlich, aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren sie eine zentrale Forderung der tschechischen Nationalaktivisten, die in der multiethnischen Region Tschechisch-Schlesien tätig waren.
Die Idee der nationalen Souveränität wurde in Schlesien zur Zeit des Völkerfrühlings von Vertretern der deutschen, tschechischen und polnischen Intelligenz angenommen. Der politische Kampf tschechischer und polnischer Aktivisten für die sprachliche Gleichberechtigung und das Recht der Minderheiten auf Bildung in ihrer Muttersprache kann als direktes Echo der Ideale des revolutionären Gärens von 1848/1849 angesehen werden. Im Vergleich zur polnischen Emanzipation in der Region erreichte die tschechische in den Revolutionsjahren 1848 und 1849 nicht eine solche Intensität; sie wurde durch den in Opava tätigen Rechtsanwalt und Journalisten Jan Kozánek vertreten. Die einsetzende politische Reaktion versetzte den Bemühungen um die sprachliche Gleichstellung im Land einen Schlag, nämlich das Dekret Nr. 13470 vom 3. November 1851. Deutsch wurde zur offiziellen Sprache der Staatsverwaltung und der Justiz; Tschechisch und Polnisch verloren ihren Status als Provinzsprachen im Herzogtum Ober- und Niederschlesien. In der multiethnischen Gesellschaft öffnete sich langsam die Büchse der Pandora der ethnischen Gegensätze: Der Schlüssel dazu wurde die Sprache, sowohl in ihrer schriftlichen als auch in ihrer umgangssprachlichen Form.
Die tschechischen Nationalaktivisten sahen in der verordneten sprachlichen Ungleichheit einen Widerspruch zu den Idealen der entstehenden modernen Zivilgesellschaft. In den 1860er Jahren mobilisierten sie ihre Kräfte und beriefen (Antonín Gruda, Kazimír Tomášek und Professor Antonín Vašek) am 12. September 1869 eine Manifestkundgebung in Ostrá hůrka bei Chabičov ein, auf der die Säulen des tschechischen politischen Programms im Land vorgestellt wurden: Erziehung der Kinder und Jugendlichen in ihrer Muttersprache, Herausgabe der tschechischen Presse, Einrichtung von Bibliotheken, Unterstützung der Vereinstätigkeit, Gründung von Wirtschaftseinheiten und Geldinstituten. Die verabschiedete Resolution war das Ergebnis der langjährigen Arbeit der tschechischen Abgeordneten in der Landesversammlung, JUDr. František Stratil, Věnceslav Hrubý und Petr Foltys.
Die Karte zeigt wichtige Meilensteine bei der Umsetzung der tschechischen Emanzipationsbestrebungen in Tschechisch-Schlesien. Die Einrichtung von Gymnasien mit Tschechisch als Unterrichtssprache, die die zukünftige tschechische Intelligenz auf das Universitätsstudium vorbereiten sollten, wurde zur Priorität. Das Ministerium für Kultus und Unterricht erhörte die Bitten der tschechischen Aktivisten und erteilte ihnen 1883 die Erlaubnis, in Opava Die Verstaatlichung des Gymnasiums im Jahr 1897 war ein symbolischer Sieg auf dem Gebiet der tschechischen Volksbildung, ebenso wie die Gründung des Realgymnasiums in Orlová (1894). Die Gymnasien und das Lehrerinstitut im polnischen Ostrava basierten auf dem Netz der tschechischen Gemeindeschulen auf dem Land, die nur dank des unbeugsamen Einsatzes der Schulvereine und nationalbewusster Einzelpersonen existierten, die bei ihrer Entstehung dabei waren und sie auf verschiedene Weise unterstützten, sei es durch politisches Lobbying an höchsten Stellen, durch finanzielle Zuwendungen oder sogar durch den Verkauf von Grundstücken an einen tschechischen Schulverein, wie in Frýdek im Jahr 1900.
Die emanzipatorischen Bestrebungen der nationalen Aktivisten wären nicht erfolgreich gewesen, wenn es ihnen nicht gelungen wäre, durch die tschechische periodische Presse, die Nachrichten und Kommentare nicht nur in einer Sprache, sondern auch in einem Stil enthielt, der für den Leser in einer ländlichen Hütte oder einer Arbeiterkolonie verständlich war, die breitestmöglichen Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die literarische Bildung und die Kenntnis der tschechischen Sprache wurden durch volkstümliche Kalender mit verschiedenen Lektionen und Ratschlägen, Freizeitlektüre und Freizeitaktivitäten wie Kreuzworträtsel im Volk verbreitet. Die Abhaltung von Gottesdiensten in tschechischer Sprache und die Möglichkeit des Singens von tschechischen Gesängen sollte nicht vernachlässigt werden.
Eine wichtige Rolle im Emanzipationsprozess spielten die Vereine, nicht nur die sogenannten Wehrvereine und Wirtschaftsvereine, also die Flaggschiffe der nationalen Aktivisten, sondern auch die Leseklubs, Gesangsvereine, Amateurtheater und die Sokol-Vereine, die in den Dörfern zu Beginn des 20. Jahrhundert gegründet wurden. Mehr als eine Demonstration im Land wurde von Verbänden gesponsert und von deren Mitgliedern organisiert. Wichtige Orte dieser Versammlungen wurden zu Gedenkorten und an ihnen wurden Denkmäler errichtet, die bis heute an die tschechischen Emanzipationsbemühungen erinnern.

Als ein wesentliches Ergebnis der tschechischen Emanzipationsbestrebungen betrachten wir das Dekret des Schlesischen Landtages vom 7. Januar 1908, durch das Tschechisch und Polnisch als gemeinsame Landessprachen anerkannt wurden. Die tschechische Sprache wurde erst nach der Ausrufung der Tschechoslowakischen Republik sprachlich gleichgestellt. Diese Zeit kann als der Höhepunkt der tschechischen Emanzipationsbestrebungen in der Region angesehen werden.
5.13 Polnische Emanzipation
Von großer Bedeutung für die polnische Emanzipation waren die polnischsprachigen Zeitungen, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu erscheinen begannen - Tygodnik Cieszyński und Gwiazdka Cieszyńska, später gefolgt von dem evangelischen Przyjaciel ludu und am Ende des 19. Jahrhunderts Głos Ludu Śląskiego. Etwa zur gleichen Zeit wurden Gymnasien mit Polnisch als Unterrichtssprache in Těšín und dann in Orlová gegründet. Zur Stärkung des polnischen Nationalgefühls entstand auch eine große Anzahl von Vereinen.
„Aber wir wissen, dass wir Schlesier ein Teil der polnischen Nation sind...“
I
n den Jahren 1848-1918 war der östliche Teil Österreichisch-Schlesiens ein multiethnisches Gebiet, in dem tschechische, deutsche, polnische und jüdische Volksgruppen nach den heutigen Nationalitätenkriterien lebten. Zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert betrachteten sich normale Menschen im Allgemeinen als Schlesier (Ślązacy/Schlesier) Titelseite der ersten Ausgabe des Tygodnik Cieszyński, 6. Mai 1848, egal ob sie Tschechisch, Deutsch, Polnisch oder regionale Dialekte sprachen. Die Ideen des nationalen Bewusstseins wurden unter ihnen vor allem von Vertretern der Intelligenz, durch die Presse, nationale Schulen und Vereinsaktivitäten gesät.
Těšín (Cieszyn/Teschen) hat sich zu einem regionalen Zentrum des polnischen Journalismus entwickelt. Die erste Ausgabe von Tygodnik Cieszyński: Pismo poświęcone dla ludu wiejskiego, tygodnik społ.-oświat. wurde am 6. Mai 1848 veröffentlicht. Im Frühjahr 1851 wurde sie durch die Gwiazdka Cieszyńska ersetzt, die jahrzehntelang die Rolle eines Schlüsselmediums für die Verbreitung der Ideen der polnischen Emanzipationsbewegung in der Region spielte. Als ein ebenso wichtiges Zentrum der polnischen Publizistik betrachten wir Návsí, wo der evangelische Pfarrer Franciszek Michejda wirkte: Pismo evangelickie (1885) stärkte die ethnische Zugehörigkeit der polnischsprachigen Protestanten zur polnischen Volksgemeinschaft. Die Verbundenheit der polnischsprachigen Schlesier mit der polnischen Nation wurde auch durch Głos Ludu Śląskiego (1897) gestärkt, eine Zeitung, die in Fryštát von dem polnischen Aktivisten Franciszek Friedel herausgegeben wurde. Die polnischen Zeitschriften hatten es jedoch schwer, sich in der statutarischen Stadt Bílsko zu etablieren. Selbst die Równość, das politische Organ der polnischen Sozialdemokraten, erschien hier Ende des 19. Jahrhunderts nur kurz, obwohl sie 1899 3.000 Abonnenten hatte.
Die langjährigen Bestrebungen polnischer Aktivisten, Gymnasien mit Polnisch als Unterrichtssprache einzurichten, wurden Ende des 19. Jahrhunderts erfüllt, zuerst in Těšín und dann in Orlová. Die Eröffnung eines Lehrinstituts in Těšín mit Polnisch als Unterrichtssprache, das künftige Lehrer der städtischen Schulen auf den Beruf vorbereitete, stellte einen weiteren Erfolg der Emanzipationsbewegung dar, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert bereits eine solide Basis in den Vereinen hatte, auf deren Schultern oft die Finanzierung des nationalen Bildungswesens ruhte.
Der Herbst 1918 war in der Region turbulent, und die Vorstellungen der nationalen Aktivisten der verschiedenen Volksgemeinschaften über die zukünftige staatsrechtliche Struktur unterschieden sich radikal voneinander. Die sich mit der polnischen Nation identifizierende Bevölkerung demonstrierte in Orlová, Těšín und Bohumín für den Anschluss des Gebietes an Polen. Es wurden Ideen über die Grenzen des neuen polnischen Staates verkündet, die entweder durch den Fluss Olše oder durch den Fluss Ostravice gebildet wurden.
(Głos Ludu Śląskiego: polskie pismo ludowe)
Těšín (Cieszyn/Teschen) hat sich zu einem regionalen Zentrum des polnischen Journalismus entwickelt. Die erste Ausgabe von Tygodnik Cieszyński: Pismo poświęcone dla ludu wiejskiego, tygodnik społ.-oświat. wurde am 6. Mai 1848 veröffentlicht. Im Frühjahr 1851 wurde sie durch die Gwiazdka Cieszyńska ersetzt, die jahrzehntelang die Rolle eines Schlüsselmediums für die Verbreitung der Ideen der polnischen Emanzipationsbewegung in der Region spielte. Als ein ebenso wichtiges Zentrum der polnischen Publizistik betrachten wir Návsí, wo der evangelische Pfarrer Franciszek Michejda wirkte: Pismo evangelickie (1885) stärkte die ethnische Zugehörigkeit der polnischsprachigen Protestanten zur polnischen Volksgemeinschaft. Die Verbundenheit der polnischsprachigen Schlesier mit der polnischen Nation wurde auch durch Głos Ludu Śląskiego (1897) gestärkt, eine Zeitung, die in Fryštát von dem polnischen Aktivisten Franciszek Friedel herausgegeben wurde. Die polnischen Zeitschriften hatten es jedoch schwer, sich in der statutarischen Stadt Bílsko zu etablieren. Selbst die Równość, das politische Organ der polnischen Sozialdemokraten, erschien hier Ende des 19. Jahrhunderts nur kurz, obwohl sie 1899 3.000 Abonnenten hatte.
Die langjährigen Bestrebungen polnischer Aktivisten, Gymnasien mit Polnisch als Unterrichtssprache einzurichten, wurden Ende des 19. Jahrhunderts erfüllt, zuerst in Těšín und dann in Orlová. Die Eröffnung eines Lehrinstituts in Těšín mit Polnisch als Unterrichtssprache, das künftige Lehrer der städtischen Schulen auf den Beruf vorbereitete, stellte einen weiteren Erfolg der Emanzipationsbewegung dar, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert bereits eine solide Basis in den Vereinen hatte, auf deren Schultern oft die Finanzierung des nationalen Bildungswesens ruhte.
Der Herbst 1918 war in der Region turbulent, und die Vorstellungen der nationalen Aktivisten der verschiedenen Volksgemeinschaften über die zukünftige staatsrechtliche Struktur unterschieden sich radikal voneinander. Die sich mit der polnischen Nation identifizierende Bevölkerung demonstrierte in Orlová, Těšín und Bohumín für den Anschluss des Gebietes an Polen. Es wurden Ideen über die Grenzen des neuen polnischen Staates verkündet, die entweder durch den Fluss Olše oder durch den Fluss Ostravice gebildet wurden.
5.14 Schlosskultur
Trotz der mehr als ein halbes Jahrhundert andauernden Verwüstung gibt es in Tschechisch-Schlesien immer noch eine große Anzahl von Schlossbauten. Nur wenige von ihnen können als wirklich repräsentativ bezeichnet werden - meist handelt es sich um landhausähnliche Solitärbauten, die sowohl Wohnzwecken als auch der Verwaltung des Gutes dienten. Der überwiegend ländliche Charakter ergibt sich aus der Provinzialität der historischen Sozialstruktur, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts durch einen hohen Anteil kleinerer oder mittlerer Anwesen und nur durch wenige große Gutskomplexe geprägt war.
In der zweiten Hälfte des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde eine Reihe von schlesischen Schlössern im Barockstil gebaut oder umgebaut und sie behielten diese Form in vielen folgenden Jahrhunderten bei (Bílovec, Hošťálkovy, Linhartovy, Melč, Ropice, Velké Heraltice). Die Schlösser in Kravaře und Linhartovy sowie die heute nicht mehr existierenden Schlösser in Hrabyně und Odry sind Beispiele für die Rezeption der hochbarocken Architektur des Wiener Hofkreises. Dies war für viele Adelssiedlungen in Böhmen und Mähren, aber nicht in Schlesien typisch. Bedeutende spätbarocke Rekonstruktionen entstanden im schlesischen Rudoltice, Bruntál und Velké Hoštice.
Die Renaissance- und Barockschichten wurden erst im Klassizismus und Empire, bzw. Biedermeier bedeutend überlagert oder ergänzt, denen die historisierenden Stile des 19. Jahrhunderts folgten (Hošťálkovy, Kyjovice, Melč, Oldřišov, Orlová, Ropice, eine Reihe kleinerer Bauten im Grenzgebiet Javorník-Vidnava-Zlaté Hory). Außergewöhnliche, aber sehr wertvolle Adaptionen im Geiste des höfischen palladianischen Neoklassizismus (manchmal ungenau als "Schlesisches Empire" bezeichnet) zeigen die Residenzen in Hnojník, Konská oder Chotěbuz. Sicherlich aufgrund der Kapitalschwäche der meisten lokalen Adligen wurden neue Residenzen ab der Mitte des 18. Jahrhunderts nur noch selten gebaut. Zu den spätbarocken und klassizistischen Dörfern gehörten Dubová, Hlavnice, Neplachovice, Orlová, Prostřední Bludovice, Prstná, Studénka (neues Schloss), Šilheřovice oder Štemplovec.
Das Erscheinungsbild von Schlossbauten im 18. und 19. Jahrhundert wurde grundlegend von der Wohnstrategie ihrer Besitzer beeinflusst. Die Habsburger von Těšín, die Liechtensteiner von Opava-Krnov und die Familie Wilczek, als Inhaber der größten Landgüter, besuchten ihre Güter nur selten und ihre Hauptburgsitze (Frýdek, Krnov, Opava, Klimkovice, Poruba) dienten den Bedürfnissen der Verwaltung großer Güter oder des Industriegeschäfts, gelegentlichen Saisonaufenthalten oder Ausflügen in die Natur. Das repräsentative Schloss in Šilheřovice wurde auch von den Wiener Bankiers Rothschild nur saisonal genutzt. Die Familie Larisch-Mönnich hingegen brach trotz ihrer Tätigkeit bei Hofe nie ihre Verbindung zur Region Těšín ab. Ihr ursprünglicher Wohnsitz war das Schloss in Karviná, das Ende des 18. Jahrhunderts durch das Schloss in Fryštát ersetzt wurde; beide Schlösser wurden im klassischen Stil umgebaut. Die unverwechselbare Rekonstruktion von Fryštát demonstriert den einzigartigen Kontakt mit dem höfischen künstlerischen Umfeld. Die schlesische Schlossarchitektur wurde auch durch die Familie Lichnov aus Voštice wesentlich bereichert, die vom Ende des 18. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts in Hradec nad Moravicí in mehrere Umbauten des Schlosses und seiner Wirtschaftseinrichtungen investierte, ähnlich wie rückten die Blüchers aus Wahlstatt nach Radun vor. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Razumovsky-Residenzen in Dolní Životice und Melč modernisiert. Das vernachlässigte Schloss in Bruntál wurde von deutschen Rittern im spätbarocken Stil umgebaut, und die Renaissance-Burg/Schloss wurde schließlich von Jánský Vrch in eine komfortablere Residenz umgewandelt, die für einige Zeit die ständige Residenz der Bischöfe von Wrocław war. In den Metropolen der historischen schlesischen Fürstentümer baute der Adel seine Stadtpaläste nur selten, und wenn, dann bevorzugte er klassizistische Häuser (bis Mitte des 19. Jahrhundert waren freie, herrschaftliche Häuser) oder die Anmietung von Wohnungen in Stadthäusern. Echte Stadtpaläste entstanden auf dem Gebiet des heutigen Tschechisch-Schlesiens nur in Opava (die Paläste Blücher und Sobek unter einer Reihe von Herrenhäusern an der heutigen Masaryk-Allee, der Vorstadt-Ausstellungspalast Razumovsky Ende des 19. Jahrhunderts) und in Bohumín (die Gusnars von Komor, die klassizistische Rekonstruktion der Gräfin Rudnicka).

Nach der Gründung der Tschechoslowakei konfiszierte der Staat die habsburgischen Besitzungen in Těšín. Die anschließende Bodenreform verkleinerte die Ländereien, ließ aber die Schlösser mit ihren Wirtschaftsgebäuden und Parkanlagen in den Händen der Besitzer. Der schicksalhafte Wendepunkt kam mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Viele Besitzer verließen ihre Ländereien noch vor der Ankunft der Roten Armee und gingen ins Exil. Einige der Gebäude wurden beim Durchzug der Front durch Osoblažsko und bei der Operation Ostrava-Opava schwer in Mitleidenschaft gezogen; die stark beschädigten Dobroslavice, Hrabyně, Třebovice wurden anschließend niedergerissen. Viele Schlösser wurden unmittelbar nach der Befreiung geplündert, viele Besitzer wurden aufgrund ihrer deutschen Staatsangehörigkeit nach Deutschland vertrieben. Die staatliche Enteignung großer Ländereien vollendete den Niedergang des privaten Schlossbesitzes. Die enteigneten Schlösser wurden von land-, forst- und industriewirtschaftlichen Betrieben und vereinigten Agrargenossenschaften genutzt oder dienten als staatliche Sozial- und Bildungseinrichtungen. Die Gebäude wurden in unsensibler Weise neuen Zwecken angepasst, litten unter mangelnder Pflege und verfielen, einige stürtzten ein oder wurden absichtlich abgerissen, wie das ausgebrannte Barockjuwel in Odry. Große Verluste gab es in der Region Těšín, wo die Ausstellungsgebäude in Karviná, Orlová, Ráj und Solka verschwanden, ebenso wie eine Reihe von kleinen Burggebäuden. Neben den Schlossgebäuden wurden auch die angrenzenden Parkanlagen stark beschädigt oder sogar zerstört. Nur einige rekonstruierte repräsentative Gebäude (Bruntál, Hradec nad Moravicí, Jánský Vrch, Raduň), die mit eigenem oder herbeigebrachtem Mobiliar ausgestattet waren, wurden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Paradoxerweise war die Zeit der Restitution nach 1989 für viele andere Schlösser fatal (Kunčice in Ostrava), viele von ihnen setzten ihren Verfall fort und verfallen noch immer (Deštné), nur einige wenige wurden dank des Interesses von Gemeinden und privaten Subjekten gerettet und wiederbelebt (Rychvald, Ropice, Štáblovice) oder sogar für die Öffentlichkeit geöffnet (Fryštát, Hošťálkovy, Neplachovice, Slezské Rudoltice).
5.15 Spuren des Adels in der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
Dank der Aktivitäten ihrer Besitzer wurden die Adelssitze zu wichtigen lokalen Zentren des kulturellen und intellektuellen Lebens, sowie zum administrativen und wirtschaftlichen Zentrum des Patrimoniums. Die Besitzer von Schlossgebäuden behielten auch nach dem Ende des ständischen Sozialsystems Mitte des 19. Jahrhunderts einen Großteil ihres Einflusses auf kulturelle, geistliche, schulische und andere Einrichtungen. Die enge Verbundenheit des Adels mit seiner unmittelbaren Umgebung spiegelt sich noch heute in einer Reihe von erhaltenen Denkmälern wider, die oft die heraldische Symbolik ihrer Stifter und Förderer tragen.
Ab dem 17. Jahrhundert wurde der angrenzende Park mit kleinen architektonischen Objekten (Springbrunnen, Orangerien, Lauben) und solitärem Skulpturenschmuck Teil des Schlossbesitzes. Kravaře, Melč und Slezské Rudoltice sind Beispiele für barocke Parkanlagen. Ab der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts haben viele Parks einen naturlandschaftlichen Charakter im englischen Stil erhalten (Hradec n. M., Karviná-Fryštát, Šilheřovice).
In unmittelbarer Nähe der Burgsiedlungen entstanden wirtschaftliche Einrichtungen mit Getreidespeichern, Scheunen, Brauereien, Gärten und Obstgärten, Stallungen, Schafställen und kleineren Gewerbebauten. Der Adel errichtete auch solitäre Gutshöfe mit angrenzenden Siedlungen (der Musterhof der Rothschilds an der Stelle des ursprünglichen Schafstalls in Paseke, Gut Šilheřovice). Im Zuge der Etablierung großer Grundherrschaften verloren viele Burgen ihre ursprüngliche Wohnfunktion und dienten den Bedürfnissen der Guts- oder Herrschaftsverwaltung. Das Desinteresse der Besitzer an diesen Bauten hätte fatale Folgen haben können: So wurde die baufällige Burg Larisch-Mönnich in Šenov 1927 abgetragen, und das untergegangene Schloss der Grafen Wilczek im schlesischen Ostrava wurde zur gleichen Zeit durch Bergbaueinflüsse zur Ruine.
Die Pferdezucht stand im Zusammenhang mit der aristokratischen Wirtschaft und der Präsentation des Lebensstils. Die einzigartige Kombination beider Aspekte stellt das sog. Rote Schloss in Hradec nad Moravicí dar, das von den Lichnovskis in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Schlossbauernhof einschließlich Stallungen erbaut wurde. Die bis heute existierenden Ortsnamen sind ein Hinweis auf das großbürgerliche Gewerbe: Neue Höfe und Siedlungen wurden nach dem Vor- oder Nachnamen des Gründers benannt; der bekannte Kurort Karlova Studánka trägt deshalb seit 1803 zu Ehren des Erzherzogs Karl Ludvík, Großmeister des Deutschen Ritterordens und Besitzer der Herrschaft Bruntál seinen Namen; der Name des Erzherzogs spiegelt sich auch im Namen des nahegelegenen Ludvík wider.
Oft bot der umfangreiche Waldbesitz die Möglichkeit, den Reichtum und den sozialen Status der adligen Besitzer zu repräsentieren. Die Gebäude der Forstverwaltungen und die Jagdhütten der einzelnen Gebirgszüge wurden im "alpinen" Stil gebaut, später wurden sie im Geiste der Moderne gestaltet
Architektur der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts (besonders die Lichnowsky). Um die Erbauer zu präsentieren, wurden die Fassaden oder Giebel dieser Gebäude mit Familienwappen verziert. Bei großen Gütern kann die Forstwirtschaft mit der Jagdleidenschaft der Besitzer verbunden gewesen sein. Ein großes Wildgehege, das sich ursprünglich auf der Burg in Hradec nad Moravicí befand, wurde zur Grundlage des hiesigen englischen Schlossparks. Zum Schlosskomplex der Rothschilds in Šilheřovice gehört bis heute das sogenannte Jagdschloss mit Zwingern für Jagdhunde. Die Rothschilds gründeten auch eine Fasanerie, die zusammen mit dem Hainhaus das ursprüngliche Zentrum der Forstverwaltung (Annas Hof) ersetzte.
Die Familienheraldik fandbei der Ausschmückung der Exterieure und Interieure der Patronatskirchen breite Anwendung , deren Bau ganz oder teilweise von den Gutsbesitzern finanziert wurde (Taaffe in Dolní Lutyně, die Pražmas von Bílkov in Frýdek, die Familie Razum in Dolní Životice). Die Wappen der Stifter tragen viele Solitärstatuen von Heiligen und göttlichen Märtyrern. Sie waren auch Teil der Torfassaden ehemaliger Bauern- und Industriegebäude (Familie Wilczek - Heřmanice, Hrušov, Svinov oder Klimkovice; Familie Rothschild - Grube Anselm, Petřkovice, Familie Habsburg - Sedliště). Die aus ihnen herausgezogenen Wappenfiguren oder Embleme unterstrichen die Autorität der Grenzsteine, wie z.B. der Grenzstein auf dem Gipfel des Praděd, wo sich die Grenzen der schlesischen Güter Frývaldov (heute Jeseník) der Bischöfe von Wrocław und Bruntál des Deutschen Ritterordens mit der mährischen Domäne der Grafen von Žerotín Vízmberk (heute Loučná nad Desnou) trafen.

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden Adelige meist in Familiengräbern in den Krypten von Patronatskirchen und Kapellen beigesetzt. Die Begräbnisstätten ihrer Überreste wurden durch steinerne Grabsteine oder Epitaphe gekennzeichnet, die mit figuralem oder heraldischem Schmuck oder einer Kombination aus beiden Elementen versehen waren. Umfassende Sätze von Grabsteinen sind z. B. in Klimkovice (Familie Bzenc aus Markvartovice und Verwandte) oder in Šenov (die Skrbenskis aus Hříště) zu sehen. Der heutige Standort vieler dieser Denkmäler ist sekundär, sie wurden im 19. und 20. Jahrhundert umgesiedelt. Nur selten wurden separate Familienmausoleen errichtet, wie z.B. die Wilczek-Grabkapelle an der Pfarrkirche in Klimkovice. Die josephinischen Reformen setzten den Bestattungen innerhalb von Kirchengebäuden ein Ende und der Adel begann, neue Begräbnisnekropolen in Form von separaten Gräbern (die Bellegards in Velké Heraltice, die Larisch-Mönnichs in Fryštát) oder bezahlten Ehrenplätzen an Kirchen- oder Friedhofsmauern (die Familie Razum in Radkov) zu errichten. Diese letzten Ruhestätten wurden meist mit Inschriften- und Wappengrabmalen oder einfachen Grabsteinen versehen. Einzigartige Grabbauten sind das neugotische Grabmal der Lichnowsky von Woschitz aus den Jahren 1902-1903 im (damals preußisch-schlesischen) Chuchelné; das Larisch-Mönnich-Grabmal in Form eines antiken Tempels im Schlosspark in Solka (heute Karviná-Doly, 1916-1920, Architekt Leopold Bauer), das 1986 wegen Unterspülung abgerissen wurde. Einige Angehörige des traditionellen und neuen Adels, die in der Armee, der Staatsverwaltung oder der Stadtverwaltung tätig waren, wurden auf den städtischen Friedhöfen in Opava oder Těšín beigesetzt.
5.16 Streit um Těšín 1918-1920
Die Region Těšín war wegen seiner Schwerindustrie und seiner Lage an der Eisenbahnlinie, die die böhmischen Länder mit der Slowakei verband ein strategisch wichtiges Gebiet. Bald nach dem Ersten Weltkrieg wurde dieses ethnisch gemischte Gebiet zum Gegenstand eines Streites zwischen der Tschechoslowakei und Polen, der die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern für lange Zeit beeinträchtigte.
Die Situation in der Region Těšín war seit den Ereignissen im Februar 1919 eskaliert. Bewaffnete Zwischenfälle an der Demarkationslinie häuften sich und Ende August brach ein Generalstreik in den Minen aus. Ein ernsthaftes Problem stellte die neutrale Zone dar, wo das Fehlen von Sicherheitsdiensten zu einem Anstieg der Kriminalität und der Verbreitung von Pocken führte.
Zum Ende des Sommers und Beginn des Herbstes 1919 wurde die Idee geboren, das Problem durch eine Volksabstimmung zu lösen. Im September wurde eine internationale Volksabstimmungskommission, mit einer tschechoslowakischen (in Moravská Ostrava) und einer polnischen (in Těšín) Volksabstimmungskommission gebildet. Andere plebiszitäre Gremien arbeiteten auf der Ebene der Bezirke und die Gemeinden. Am 2. Februar 1920 übernahm die Internationale Plebiszitkommission die Regierung von Schlesien.
Daraufhin beschloss er, dass die am 3. Februar 1919 festgelegte Linie als Verwaltungsgrenze beibehalten und die neutrale Zone abgeschafft werden sollte. Aus dem polnischen Bezirk wurde eine östliche Präfektur und aus dem tschechischen Bezirk eine westliche Präfektur gebildet. Ihre höchsten Verwaltungsbeamten waren direkt der Internationalen Kommission unterstellt. Außerdem wurde das Gebiet des ehemaligen Gouvernements Karviná, das die interuniversitäre Plebiszitkommission selbst verwalten wollte, durch die neu gegründete Vereinbarungsverwaltungskommission von der westlichen Präfektur getrennt. Auf Anordnung der Internationalen Plebiszitkommission wurden die Truppen der beiden rivalisierenden Parteien über die Grenzen von Teschen hinaus abgezogen und durch französische und italienische Truppen ersetzt. Die Soldaten des Abkommens waren zusammen mit der Gendarmerie, die direkt der internationalen Kommission unterstellt war, für Ruhe und Ordnung in dem umstrittenen Gebiet verantwortlich.
Zur Zeit der Plebiszitvorbereitung unterstützten die deutsche und jüdische Bevölkerung sowie die Anhänger der autonomen "Schlonzac"-Bewegung überwiegend die tschechoslowakische Partei. Im deutschen Umfeld gab es auch Überlegungen zur Errichtung einer internationalen Verwaltung über Těšín.

Allerdings zogen sich die Diskussionen über das Datum und die Form der Volksabstimmung hin. Hauptstreitpunkt war die tschechoslowakische Forderung, dass nur Personen abstimmen sollten, die vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges in der Region ansässig waren oder das Heimatrecht besaßen, wodurch die Kriegsflüchtlinge aus Galizien, die sich in Těšín niedergelassen hatten, von der Volksabstimmung ausgeschlossen wurden. Beide Parteien versuchten, durch Propaganda, Versprechen von verschiedenen Vorteilen und anderen Mitteln so viele Wähler wie möglich zu gewinnen. Die langwierigen Vorbereitungen führten jedoch zu einem Anstieg von Opfern und Gewalt auf beiden Seiten. Neben häufigen Zusammenstößen zwischen tschechischen und polnischen Einwohnern bei verschiedenen Versammlungen und Demonstrationen wurden Bürger mit tschechischer oder polnischer Staatsangehörigkeit aus ihren Wohnungen und von ihren Arbeitsplätzen vertrieben. Außerdem fanden Attentate auf Amtsträger beider Seiten statt. Auch Gendarmeriepatrouillen und -stationen wurden häufig angegriffen, besonders im Frühjahr 1920. In Doubrava am 26. Mai und in Šumbark am 1. Juli 1920 gab es bei den oben erwähnten Angriffen Tote.
Das Schicksal von Těšín wurde schließlich durch die Botschafterkonferenz in Spa und das anschließende Pariser Protokoll vom 28. Juli 1920 unter dem Einfluss der eskalierenden Spannungen entschieden. Die Tschechoslowakei erhielt 56 % des umstrittenen Gebietes, einschließlich des größten Teiles des Kohlereviers und der Bahnlinie Košice-Bohumín. Die neue Grenze folgte im Wesentlichen dem Verlauf des Flusses Olše, obwohl sie an einigen Stellen mehr nach Osten verschoben wurde. Konkret erhielt die tschechoslowakische Seite die andkreise Frýdek, Bohumín, Slezská Ostrava und größere Teile der Landkreise Fryštát, Těšín und Jablunkov. Die Abgrenzung der Grenzen dauerte bis Mitte der 1920er Jahre.
5.17 Region Hlučín in der Zwischenkriegszeit
Die Region Hlučín (Hultschiner Ländchen) ist ein kleines Gebiet von 317 km2, das zwischen Opava und Ostrava liegt. Bis 1920 gehörte es als südlicher Teil des Kreises Ratibor zu Preußisch-Schlesien. Während der 180 Jahre, in denen es ein Teil Preußens war, bildete die Bevölkerung von Hlučín eine pro-preußische (pro-deutsche) Mentalität und einen starken Hohenzollern-Patriotismus aus, obwohl mehr als vier Fünftel von ihnen eine tschechische (mährische) Muttersprache hatten. Auf der Pariser Friedenskonferenz bat die Tschechoslowakei um das Gebiet von Ratibořsko, einschließlich der Kohlengruben und Salinen in Rybnik.
In einem Memorandum, das für die Friedenskonferenz verfasst wurde, erklärte die Tschechoslowakische Republik, dass sie dieses Gebiet vor allem aus wirtschaftlichen, aber auch aus historischen und ethnischen Gründen verlangte. Die Tschechoslowakei erhielt jedoch nur den südlichen Teil von Ratibořsko (seitdem Hlučínsko genannt), ein wirtschaftlich rückständiges Agrargebiet (mit Ausnahme von zwei Kohlegruben in Petřkovice und einer flachsverarbeitenden Fabrik in Chuchelné) mit einem großen Überschuss an Arbeitskräften, die aufgrund der Modernisierung der Landwirtschaft seit Mitte des 19. Jahrhunderts Arbeit suchen mussten. Im 20. Jahrhundert mussten die Bauern anderswo arbeiten, vor allem im deutschen Teil des schlesischen Industriegebiets und in anderen Teilen Deutschlands, hauptsächlich als Bergleute, Maurer, Hausierer und Landarbeiter. Einige Dörfer nördlich der neuen Staatsgrenze, in denen überwiegend Tschechisch (oder mährischer Dialekt) gesprochen wurde, blieben in Deutschland.
Nach dem Versailler Vertrag konnte die Bevölkerung von Hlučín für Deutschland optieren: die Optionsfrist wurde auf zwei Jahre ab Inkrafttreten des Vertrages (10. Januar 1920) festgelegt und eine zwölfmonatige Frist zur Räumung begann ab dem Datum der Optionserklärung. Viereinhalbtausend Menschen verließen die Region Hlučín. Ein erheblicher Teil der Optanten zog nur wenige Kilometer entfernt, nämlich in das damalige deutsche Nord-Ratiboř-Gebiet. Wenn die umgesiedelten Menschen im oberschlesischen Industriegebiet Arbeit fanden, während die Einwohner von Hlučín mit einem großen Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten konfrontiert waren, der sich während der Wirtschaftskrise vervielfacht hatte, der sich während der Wirtschaftskrise vervielfacht hatte, müssen sich nicht wenige die gleiche Frage gestellt haben: Warum wollte uns die Republik uns, wenn sie keine Arbeit für uns hat?
Die Bevölkerung der Region Hlučín, auch wenn sie objektive Anzeichen tschechischer Ethnizität zeigte und den tschechischen Dialekt sprach, betrachtete sich nicht als Tschechen und mochte sie nicht. Die religiöse Frage (starke Religiosität in der Region Hlučín) und die wirtschaftliche und sprachliche Frage waren die Hauptkonfliktfelder, die miteinander verknüpft waren. Obwohl die Tschechoslowakei es nicht gerne sah, dass Hluciner in Deutschland arbeiteten, da sie mit einer antitschechischen Ideologie indoktriniert wurden, konnte sie ihnen zu Hause nicht genügend Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, selbst in Zeiten des Aufschwungs (geschweige denn während der Weltwirtschaftskrise). Aus wirtschaftlichen Gründen und wohl auch aus einem gewissen Trotz heraus war eine bedeutende Anzahl von Einwohnern von Hlučín daran interessiert, dass ihre Kinder deutsche Schulen besuchen. Die Republik schaffte jedoch das deutsche Kommunalschulwesen in der Region Hlučín (mit Ausnahme der überwiegend deutschen Gemeinden Sudice und Třebomi) ab, indem sie die national gültigen gesetzlichen Regelungen in der Region Hlučín "vorübergehend" aufhob. Als die Proteste der Bevölkerung nicht halfen, wurde in einigen Gemeinden mit Hilfe der deutschen Unabhängigkeitsbewegung und finanzieller Unterstützung aus Deutschland der sogenannte Privatunterricht eingeführt, d.h. einige Kinder besuchten keine öffentlichen Schulen. Auf das Verbot des Hausunterrichts im Jahr 1936 reagierten die tätigen deutschen Organisationen in der Region Hlučín mit der Einführung von Nachhilfeunterricht in deutscher Sprache nach den Schulstunden.

Die Volkszählungen von 1921 und 1930 zeigten ein deutliches Überwiegen der tschechischen (mährischen) Nationalität in der Region Hlučín, aber es ist anzumerken, dass die Staatsmacht, die daran interessiert war, die "angemessensten" Zahlen zu erreichen, um den tschechischen Charakter des Territoriums gegenüber Ausländern zu beweisen (d.h. die Legitimität des Anspruches auf Hlučín), keine freie Registrierung auf der Grundlage des Willens der gezählten Person zuließ. Tausende von Menschen ließen ihre eingetragene Staatsangehörigkeit amtlich korrigieren, auch ohne die Zustimmung des Aufgezählten, der zwar Widerspruch einlegen konnte, dessen Widerspruch aber keine aufschiebende Wirkung hatte. In Bobrovniki z.B. gaben bei der Volkszählung 1921 nur 165 der 552 Einwohner ihre mährische Nationalität an, und erst aufgrund eines Korrekturverfahrens lautete das offizielle Ergebnis 502 Bürger tschechoslowakischer Nationalität (91,6%) und 46 Bürger deutscher Nationalität. In Dolní Benešov wurde der Anteil der deutschen Nationalität ebenfalls von 79 % auf 12 % reduziert. Es ist daher nicht verwunderlich, dass nach den offiziellen Volkszählungsergebnissen, die im statistischen Handbuch 1924 veröffentlicht wurden, nur 7.707 (16,3%) tschechoslowakische Bürger mit deutscher Staatsangehörigkeit registriert waren. Dies stand in krassem Gegensatz zu den Ergebnissen, die die deutschen Parteien bei den Kommunal-, Provinzial- und Parlamentswahlen erzielten - bei den Parlamentswahlen 1925 z. B. gewannen die deutschen Christlichsozialen im Bezirk Hlučín 51,7 % der Stimmen und die deutschen Parteien 61,9 %.
5.18 Tschechisch-Schlesien (1938-1939)
Im Laufe des Jahres 1938 eskalierten die Spannungen in den Grenzgebieten der Tschechoslowakei zu Deutschland und Polen. Der sogenannte Ostrauer Vorfall vom 7. September, bei dem Franz May, ein Mitglied der Sudetendeutschen Partei, bei der polizeilichen Niederschlagung einer Demonstration verletzt wurde, trug zur Eskalation der Situation auf nationaler Ebene bei. Der Ausbruch des Henlein-Aufstandes am 12. September 1938 kam es zu bewaffneten Zusammenstößen auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien, die in Liptan und Vidnava zu den tragischsten Ereignissen führten.
Im Herbst 1938 begann sich unter den tschechischen Exilanten aus Těšín der sogenannte schlesische Widerstand zu formieren. Es waren mehrere ungleiche Gruppen, die gegen die polnische Verwaltung in Těšín kämpften. Nach der Besetzung Böhmens und Mährens schlossen sich einige dieser illegalen Gruppen dem Kampf gegen die Nazis an, vor allem durch die Überstellung von Soldaten an die entstehende Fremdarmee in Polen und andere Flüchtlinge.
Sowohl in der deutschen als auch in der polnischen Besatzungszeit wurde die große Mehrheit der tschechischen Parteien, Vereine und Schulen bald aufgelöst. Auch Denkmäler und Gedenkstätten wurden entfernt oder zerstört, z. B. das Denkmal für die Gefallenen von Těšín in Orlová oder das Denkmal für den Widerstand des schlesischen Volkes in Ostrá hůrka in Opava. Aus pragmatischen Gründen musste die deutsche Besatzungsverwaltung jedoch gewisse Zugeständnisse an die tschechische Minderheit machen, die im sogenannten Regierungsbezirk Troppau fast 170.000 Menschen zählte. Deshalb durften in den Schulen schließlich tschechische Klassenräume eingerichtet werden, aber tschechische Schulbücher durften nicht verwendet werden. Am 4. Dezember 1938 fanden in den besetzten Grenzgebieten Nachwahlen zum Reichstag statt, bei denen nur für oder gegen den Einheitskandidaten der NSDAP gestimmt werden konnte. Vom Widerstand der tschechischen Bevölkerung in der Region Opava zeugt die Tatsache, dass von den 27.000 Stimmen gegen diesen Kandidaten in der gesamten Grenzregion entfielen mehr als 21.000 davon Region.
Eine besondere Situation ergab sich in der Region Hlučín, die nach München als Teil des sogenannten Altreiches direkt an das Dritte Reich angegliedert wurde. Während die Tschechen aus dem Regierungsbezirk Opava in der Praxis nicht als vollwertige deutsche Staatsbürger angesehen wurden, waren die Männer aus Hlučín wehrpflichtig.
Viele Einwohner der Regionen Opava und Hlučín pendelten zur Arbeit in den industriellen Ballungsraum Ostrava. Diese Fahrten ermöglichten sowohl den Schmuggel von Waren als auch die Organisation von Widerständen. Im November 1938 bildete sich in Hlavnice in der Region Opava eine Untergrundgruppe, die Obrana Slezska (Verteidigung Schlesiens), die mit den Militär- und Polizeistrukturen im mährischen Ostrava verbunden war.
Mitte März 1939 besetzten die Nazis den Rest von Böhmen und Mähren. Die deutsche Armee marschierte am Abend des 14. März in Ostrava ein, bevor Präsident Emil Hácha unter Druck aus Berlin seine Zustimmung zur Besetzung gab. Der Grund für die überstürzte Besetzung der Region war die Befürchtung der deutschen Generäle, dass Polen die angespannte Situation nach der Erklärung der slowakischen Unabhängigkeit ausnutzen und die Industrieregion besetzen könnte. Der überstürzte Vormarsch der deutschen Truppen führte zu einem Zusammenstoß mit den Soldaten des Infanterieregiments Nr. 8 "Schlesier" in der Czajanka-Kaserne in Místek.
Nach der Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren wurde Ostrava zu einem Zentrum für den Transfer von Menschen in den ausländischen Widerstand in Polen, aber auch zum Schauplatz des deutschen Geheimdienstkrieges gegen Polen. Ein Rationierungssystem wurde eingeführt und die Verstaatlichung wichtiger Industrieunternehmen begann.
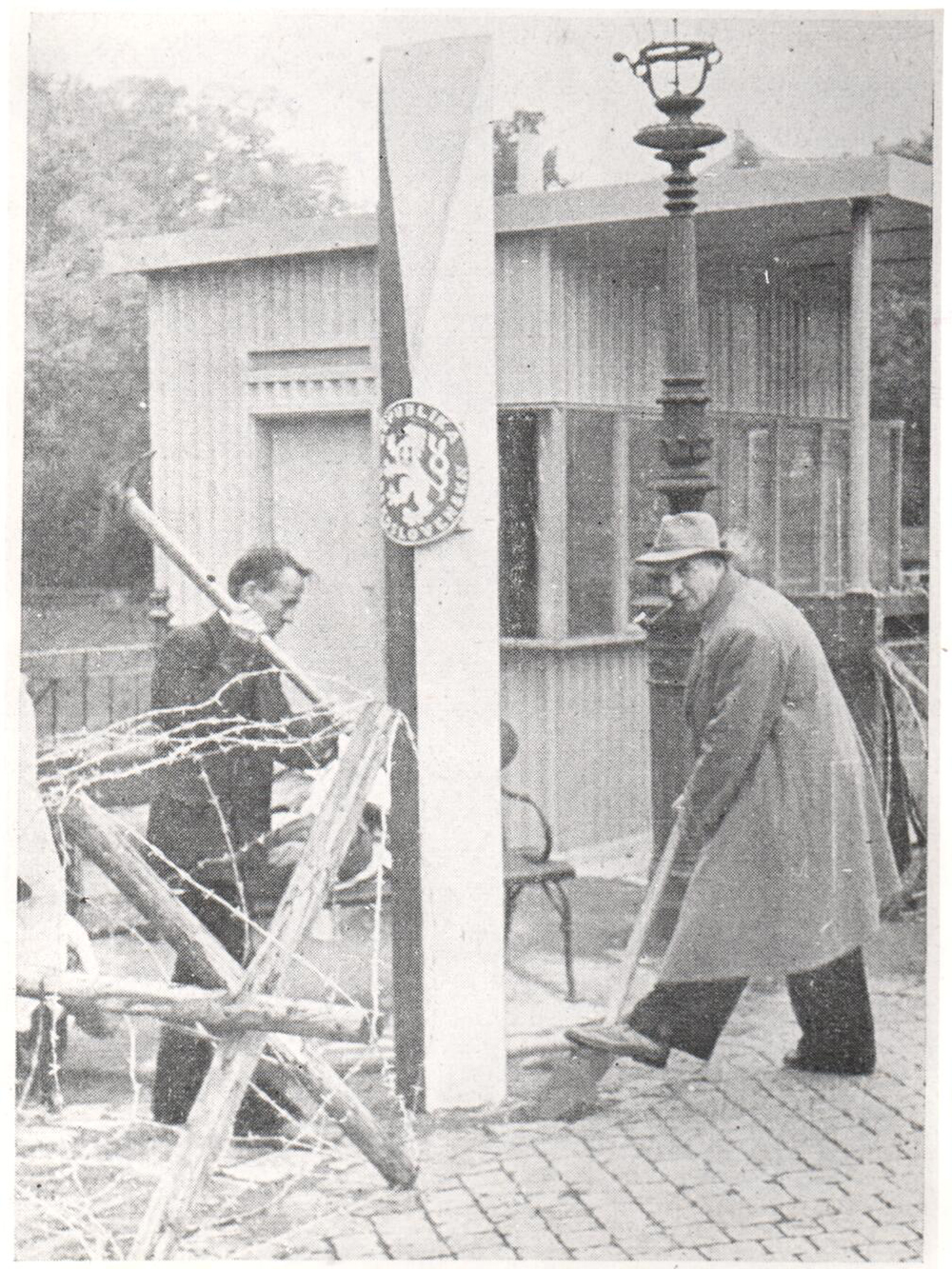
Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in der Region wurde durch den sogenannten Jablunkov-Zwischenfall am 26. August 1939 eingeläutet. An diesem Tag sollte der deutsche Angriff auf Polen beginnen, den Hitler in letzter Minute auf den 1. September verschob. Ein deutsches Ablenkungsmanöver, das die Nachricht von der Verschiebung nicht rechtzeitig erhielt, brach jedoch vom slowakischen Gebiet aus auf, um die Eisenbahntunnel bei Jablunkov zu besetzen. Deutschland musste sich für den Vorfall entschuldigen. Bereits am 1. September begann jedoch die eigentliche Invasion von Tešín, das die deutsche Armee schnell besetzte. In einigen Dörfern hießen die tschechischen Einwohner die deutschen Soldaten willkommen, weil sie glaubten, dass nach der Abschaffung der polnischen Verwaltung die tschechischen Schulen und Vereine wiederhergestellt werden würden. Stattdessen wurde das Gebiet jedoch in die Reichsprovinz Oberschlesien eingegliedert, wo sowohl die tschechische als auch die polnische Bevölkerung einem starken Germanisierungsdruck ausgesetzt war. In der ersten Phase der Verhaftungen der polnischen Intelligenz im Herbst 1939 wurden die Häftlinge im Lager in Skrochovice in der Region Opava konzentriert, das von Heinrich Jöckel, dem späteren Leiter des Gefängnisses in der Kleinen Festung in Theresienstadt, geleitet wurde.
Insgesamt war bis Ende 1939 das gesamte Gebiet von Schlesien und Ostrava in die Strukturen der NS-Besatzungsverwaltung eingegliedert, wenn auch mit deutlich unterschiedlichen Verhältnissen in den Gebieten des Protektorats, des Sudetenlandes und Oberschlesiens.
5.19 Ostrava-Opava Operation
Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren die tschechischen Länder eines der letzten Gebiete, die noch unter deutscher Besatzung standen. Gleichzeitig hatte sich in diesem Gebiet eine beachtliche Streitmacht von etwa 750.000 Soldaten und SS-Formationen angesammelt. Im März 1945 rückte die Rote Armee aus drei Richtungen in die böhmischen Länder vor - aus dem Südosten aus dem Gebiet der heutigen tschechisch-slowakisch-österreichischen Grenze, aus dem Osten durch die Slowakei und aus dem Nordosten durch Schlesien. Hier operierten Einheiten der 1. Gardearmee (unter dem Kommando von Andrei Grechko) und der 38. Armee (Kyril Moskalenko) 4. ukrainische Front (Iwan Petrow) und 60. Armee (Pawel Kurotschkin) 1. Ukrainische Front (Iwan Konew). Die Sowjets planten einen Durchbruch der 1. Gardearmee und der 38. Armee nach Nordmähren, wo sich diese Einheiten mit den aus Brünn vorrückenden Einheiten vereinigen sollten.
Im Laufe des 15.-18.April rückte die Armee in das relativ offene Gelände von Hlučín vor, wo es zu schweren Panzer- und Artilleriegefechten kam. In der Umgebung von Bolatice und Kravař kam es zu heftigen Zusammenstößen. Einen wichtigen Sieg errang die Rote Armee in der Nacht zum 18. April, als es ihr gelang, den Fluss Opava bei Štítina zu überqueren.
In den folgenden Tagen rückte Kurotschkin- 60. Armee auf beiden Seiten des Flusses bis zur stark befestigten Stadt Opava vor. Besonders die Einheiten der 1. Skijäger-Division (Gustav Hundt) auf den Hügeln um Oldřišov und Pusté Jakartice leisteten harten Widerstand. Erst in den Morgenstunden des 22. April drangen die Sowjets in Opava ein und drängten die Deutschen westwärts in Richtung Slavkov und Stěbořice. Währenddessen fuhr die 38. Armee weiter nach Ostrava. Nachdem sie am 18. April die Verteidigungslinie am Fluss Opava durchbrochen hatten, konnten die Deutschen auf der Hochebene um Hrabyně und Velká Polom sowie auf der Linie der tschechoslowakischen Vorkriegs-Grenzbefestigungen weiter Fuß fassen.
Die Kämpfe um Hrabyně dauerten über eine Woche, die Deutschen räumten das Dorf am 27. April. Am 26. April nahm die tschechoslowakische Panzerbrigade, unterstützt von sowjetischer Infanterie, Velka Polom ein und rückte weiter in Richtung Klimkovice vor. Ende April setzte sich auch der westliche Flügel von Grečkov- Armee in Bewegung und rückte über Hlučín bis zum Oderufer bei Petřkovice vor. Am 29. April hatten Moskalenkos Truppen auch die Oder erreicht. Im Einsatzgebiet der 1. Gardearmee leistete auch die 1. tschechoslowakische gemischte Fliegerstaffel in der UdSSR Luftunterstützung.

In der Nacht zum 30. April überquerten die ersten Truppen der 38. Armee in Zábřeh die Oder, begleitet von tschechoslowakischen Panzern. Nachdem sie die Linie an der Oder durchbrochen hatten, stießen Moskalenkov- Truppen in Ostrava auf wenig Widerstand. Der größte Teil des Feindes zog sich wegen der drohenden Einkesselung in Richtung Frýdek zurück. So wurde im Laufe des 30. April Ostrava befreit. Auch lokale Aufständische beteiligten sich an den Kämpfen und konnten die Eisenbahnbrücke bei Karolina vor der Zerstörung retten. Der Widerstandskämpfer Miloš Sýkora soll die Zerstörung der Brücke über den Fluss Ostravice verhindert haben, die heute seinen Namen trägt.
Nachdem die deutschen Truppen aus Ostrava verdrängt worden waren, gingen die Kämpfe in drei Richtungen weiter. In den ersten Maitagen drang die Armee von Grečkov in Těšín und Frýdek ein. Kurotschkin mit der 60. Armee liquidierte die Nester des deutschen Widerstands westlich von Opava. Moskalenko rückte nach Nordmähren vor. Schwere Kämpfe fanden in Frýdek und um Fulnek statt, das schwer beschädigt wurde.
Die Operation Ostrava-Opava endete am 5. Mai 1945, als die Sowjets vor Krnov, Moravský Beroun, Nový Jičín und Frenštát standen. Auf sowjetischer Seite waren etwa eine Viertelmillion Männer und Frauen an den Kämpfen beteiligt, auf deutscher Seite etwa 155.000 Soldaten. Die Verluste der 4. Ukrainischen Front betrugen über 23.000 Tote; die deutschen Verluste werden auf etwa 70.000 geschätzt.
5.20 Underground in Tschechisch-Schlesien 1970-1989
Es waren junge Leute, die nach kulturellen und sozialen Aktivitäten außerhalb der offiziellen Institutionen des spätsozialistischen Systems suchten. Sogar in Tschechisch-Schlesien, das damals zum nordmährischen Gebiet gehörte, bildeten sich Gruppen oder ganze Netzwerke von langhaarigen Anhängern, Ideen der 1960er Jahre, die von den einfachen Bürgern oft verachtet wurden. Neben dem Abhängen in populären Kneipen gingen aus dem Milieu zum Beispiel viele Musikgruppen (die meist irgendeine Art von Rockmusik spielten), nonkonformistische Künstler oder Herausgeber von Samizdat-Presse hervor. Obwohl sie zunächst nur nach Platten von fremden Vorbildern, unverkäuflicher Literatur oder einfach nur nach Gleichgesinnten suchten, fanden viele (vor allem in den 1980er Jahren) aus der Underground-Gemeinde nach zunehmendem Druck der staatlichen Behörden den Weg direkt in die Strukturen der politischen Opposition.
Das Gebiet der heutigen nordmährischen Region stand sicherlich nicht am Anfang des musikalischen Untergrunds, der vor allem um prominente Persönlichkeiten in Prag und Nordböhmen entstand. Jiří Fiedor, eine der führenden Figuren des Undergrounds in der Region, erinnert sich, dass in Nordmähren die Teilnehmer von Beat-Festivals und Konzerten schon Ende der 1960er Jahre lange Haare trugen (eines der Kennzeichen der Gemeinschaft). In den 1970er Jahren begannen lange Haare langsam wieder in der Region aufzutauchen und Kneipen, in denen sich solche Gruppen trafen, begannen sich zu profilieren. Hinzuzufügen ist, dass sich die Akteure nicht als Underground bezeichneten, sondern z.B. als "Langhaarige". Kneipen waren früher wichtige Informationsknotenpunkte, über die wichtige Nachrichten verbreitet wurden und wo sich Gruppen mit ähnlichen Interessen zusammenschlossen.
Jiří Fiedor kommentierte: "Diese Kneipen waren wichtig! Für diese Menschen waren sie so etwas wie Asylantenheime. Meistens wussten diese Leute in diesen Kneipen, dass sie sich treffen würden. Viele Leute wohnten nicht an ihren Adressen (...) die Leute lebten in verschiedenen Gruppen, es gab keine Mobiltelefone, oft gab es keine Festnetzanschlüsse. (...) Wenn ich jemanden treffen wollte, wusste ich, dass ich in die Kneipe gehen musste, und ich ihn dort treffen würde."
In der Konzeption von Jiří Fiedor gibt es eine offenere Definition des Untergrunds. Seiner Meinung nach konnte man immer einen Weg in eine Gemeinschaft finden, die Leute waren sich keines politischen Subtextes bewusst, es war eher intuitiv - sie mochten lange Haare, bestimmte Musik, also schlossen sie sich ganz natürlich einer Gruppe von Menschen mit ähnlichen Interessen an. Aus der Region kann man nicht umhin, zum Beispiel den Künstler Ladislav Borkovsky, "Dasa" Vokata (ein in Karviná geborener Underground-Singer-Songwriter) mit dem "Vagabunden" und Gitarristen Zdeněk Vokata "London" oder Vladimír Ptaszek zu nennen.
Überregionale Bedeutung erlangte der lokale Underground vor allem in den 1980er Jahren, als sich in Havířov eine ausgeprägte, vor allem vom Punk inspirierte Musikszene entwickelte. Die wichtigsten Festivals in Tschechisch-Schlesien waren die im Dorf Třanovice. Das von Jiří Fiedor, Radek Kiss und anderen Havířov-"Verrückten" organisierte Festival fand auf dem Familienbauernhof, später in den Räumlichkeiten der Gemeinde statt, und die auftretenden Gäste kamen aus dem ganzen Land. Darüber hinaus gab es verschiedene Veranstaltungen, auf dem Land oder auf privatem Grund, oft verbunden mit Musik und einer Kunstausstellung. Wichtig waren die Verbindungen nach Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Mittelmähren und Brünn.
Jiří Fiedor erinnert sich: "Zu Beginn der 1980er Jahre betrachteten [die Sicherheitskräfte] die Langhaarigen nicht als eine Art politische Opposition, sie hielten uns nur für eine Art Freaks, die einfach nur tranken, lange Haare trugen, richtig, aber in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre (...) hatte es damit zu tun, dass es immer mehr Petitionen gab, die die Leute unterschrieben. Also haben sie [die Sicherheitskräfte] ihre Position neu bewertet und angefangen, diese Leute aus dem Untergrund als politische Opposition zu betrachten."

Der wohl wichtigste Beitrag zum Funktionieren von Underground Gemeinschaften und ähnlichen Gemeinschaften ist das Netzwerk der mittlerweile oft legendären Restaurants und Kneipen. Wenn wir die prominenten Etablissements auf der mährischen Seite der Region außer Acht lassen, wie z. B. das Spolek in Ostrava, das Slunko in Nový Jičín oder das Ponorka in Olomouc, bleibt eine unvollständige Liste von Kneipen übrig, in denen sich neben dem Bierkonsum die sogenannte zweite Kultur bildete. In Schlesien war die Untergrundbewegung auch in der Region Opava präsent, abgesehen von dem prominentesten Havířov und seiner Umgebung; andere Gebiete waren nicht so prominent, aber es gab auch in entlegeneren Städten renommierte Kneipen.
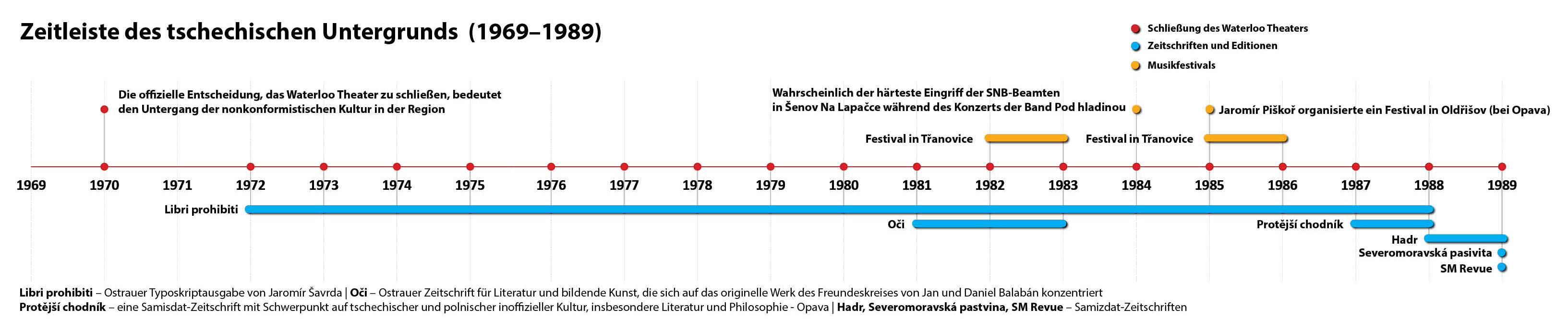
6. WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
INHALT DES KAPITELS
6.1 Straßennetz von Österreichisch-Schlesien 1742-1918
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (OU)
6.2 Straßennetz von Tschechisch-Schlesien 1918-1945
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (OU)
6.3 Straßennetz von Tschechisch-Schlesien 1945-2020
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (OU)
6.4 Eisenbahnnetz von Tschechisch-Schlesien 1847-1918
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (OU)
6.5 Eisenbahnnetz von Tschechisch-Schlesien 1918-1945 inkl. öffentlicher StadtverkehrD
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (OU)
6.6 Eisenbahnnetz von Tschechisch-Schlesien inkl. ÖFFENTLICHER VERKEHR 1945-2020
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (OU)
6.7 Landwirtschaft - natürliche Bedingungen für die Landwirtschaft
Ing. Igor Kyselka, CSc. (ACC), Mgr. Marta Šopáková (SZM)
6.8 Landwirtschaft in den Jahren 1848-1945
Ing. Igor Kyselka, CSc. (ACC), Mgr. Marta Šopáková (SZM)
6.9 Landwirtschaft 1948-1989
Ing. Igor Kyselka, CSc. (ACC), Mgr. Marta Šopáková (SZM)
6.10 Landwirtschaft 1990-2020
Ing. Igor Kyselka, CSc. (ACC), Mgr. Marta Šopáková (SZM)
6.11 Voraussetzungen für die Entwicklung der Industrie bis 1848
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (OU)
6.12 Industrielle Entwicklung zwischen 1848 und 1945
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (OU)
6.13 Industrielle Entwicklung nach 1945
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (OU)
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (OU)
6.2 Straßennetz von Tschechisch-Schlesien 1918-1945
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (OU)
6.3 Straßennetz von Tschechisch-Schlesien 1945-2020
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (OU)
6.4 Eisenbahnnetz von Tschechisch-Schlesien 1847-1918
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (OU)
6.5 Eisenbahnnetz von Tschechisch-Schlesien 1918-1945 inkl. öffentlicher StadtverkehrD
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (OU)
6.6 Eisenbahnnetz von Tschechisch-Schlesien inkl. ÖFFENTLICHER VERKEHR 1945-2020
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (OU)
6.7 Landwirtschaft - natürliche Bedingungen für die Landwirtschaft
Ing. Igor Kyselka, CSc. (ACC), Mgr. Marta Šopáková (SZM)
6.8 Landwirtschaft in den Jahren 1848-1945
Ing. Igor Kyselka, CSc. (ACC), Mgr. Marta Šopáková (SZM)
6.9 Landwirtschaft 1948-1989
Ing. Igor Kyselka, CSc. (ACC), Mgr. Marta Šopáková (SZM)
6.10 Landwirtschaft 1990-2020
Ing. Igor Kyselka, CSc. (ACC), Mgr. Marta Šopáková (SZM)
6.11 Voraussetzungen für die Entwicklung der Industrie bis 1848
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (OU)
6.12 Industrielle Entwicklung zwischen 1848 und 1945
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (OU)
6.13 Industrielle Entwicklung nach 1945
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (OU)
6.1 Straßennetz von Österreichisch-Schlesien 1742-1918
Das Straßennetz ist ein wesentliches Element der vorindustriellen Verkehrsform. Mit der Entwicklung der Eisenbahnen nimmt ihre Bedeutung vorübergehend ab. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf lokalen und regionalen Straßen, und das Netz der kommunalen Straßen wird verbessert. Mit dem Aufkommen des Individualverkehrs und der Motorisierung rückt das Straßennetz wieder in den Vordergrund.
Der Bau von Straßen musste nicht nur vom Staat, sondern auch von den Ländern, durch private Mautgebühren oder Einnahmen aus verschiedenen Landeszuschlägen und dem Reisefonds, durch Maut- und Brückenzollgelder finanziert werden. Für den Bau wurden Leibeigene eingesetzt, die sogenannten Straßenroboter. Die Leibeigenen waren auch verpflichtet, die Straße in einer bestimmten Entfernung in einem befahrbaren Zustand zu halten, und ein System der so genannten provinziellen, später freiwilligen Konkurrenz war üblich.
Eine wesentliche Änderung in der Form des Straßennetzes in den böhmischen Ländern wurde im Jahr 1781 durch das Dekret von Josef
II. Das Schlüsselbauwerk für Tschechisch-Schlesien war die sogenannte Galizische-Straße von Olmütz nach Bílsko über Lipník, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek und Těšín sowie die Straße von Frýdek nach Jablunkov. Die bisher bevorzugte Straße Schlesien-Galizien ist damit ins Abseits geraten. Während der Regierungszeit von Josef II. wurden die Straßenbefugnisse kurzzeitig auch auf die kaiserliche Armee übertragen. In Tschechisch-Schlesien betraf dies die gesamte schlesisch-galizische Straße von Opava nach Těšín und die schlesische Verbindungsstraße von Slezská Harta nach Opava. Die weitere Entwicklung zeigte, dass dieser Schritt nicht sehr zweckmäßig war, und die Straßen wurden wieder der staatlichen Verwaltung übergeben.
Der nächste Bauboom kam nach den Napoleonischen Kriegen. Es galt ein System des so genannten freiwilligen Wettbewerbs, bei dem die maximalen finanziellen und sonstigen Lasten des Straßenbaus auf denjenigen übertragen wurden, der davon profitieren konnte. Auch private Unternehmer waren zunehmend am Bau beteiligt. Schließlich wurden ab 1812 alle staatlichen, landesweiten und kommunalen Aufträge durch ein System öffentlicher Ausschreibungen durchgeführt, das als "Bieterverfahren" bezeichnet wurde, bei dem der Auftragnehmer auf der Grundlage des höchsten Rabatts auf die Vorkosten ausgewählt wurde, mit dem Ziel, den Preis so weit wie möglich zu senken. Ein ähnliches System gab es ab 1820 für die Instandhaltung der Straßen.
Die nächste Etappe der Realisierung von Staatsstraßen in Tschechisch-Schlesien wurde in den 1820er Jahren durch den Bau der Krnov-Straße von Opava über Krnov und die Stadt Albrechtice nach Prudnik eingeleitet, gefolgt im Jahr 1839 von der sog. Šumperk-Straße, die Schlesien mit Böhmen über Opava, Bruntál, Šumperk und Štíty verbindet. Seit den 1840er Jahren verband die Straße Lomnicka allmählich Horní Loděnice über Bruntál mit dem Gebirge Zlaté Hory und der preußischen Grenze. In den 1830er und 1840er Jahren wurde die Region Opava auch durch ein relativ dichtes Netz von Kreisstraßen erschlossen. Ab den 1840er Jahren, im Zusammenhang mit dem Bau von Eisenbahnen, hörte die staatliche Beteiligung am Bau des Straßennetzes auf, mit Ausnahme der staatlichen Beteiligung auf dem Gebiet der verkehrstechnisch isolierten Region Jesenicko. In den Jahren 1875-1880 sorgte der Staat für den Bau einer 43 km langen kaiserlichen (Haupt-)Straße von Zlaté Hory (Zuckmantl) nach Červenohorské sedlo. Der zweite große Schritt war die Übernahme der Kreisstraße von Frývaldov (heute Jeseník) über Žulová nach Javorník durch den Staat im Jahr 1893, gefolgt von der sog. Vidly-Straße, die Vidly mit Domášov und Vrbno pod Pradědem verbindet, im Jahr 1904 und der Straße Krnov - Leskovec nad Moravicí im Jahr 1918.
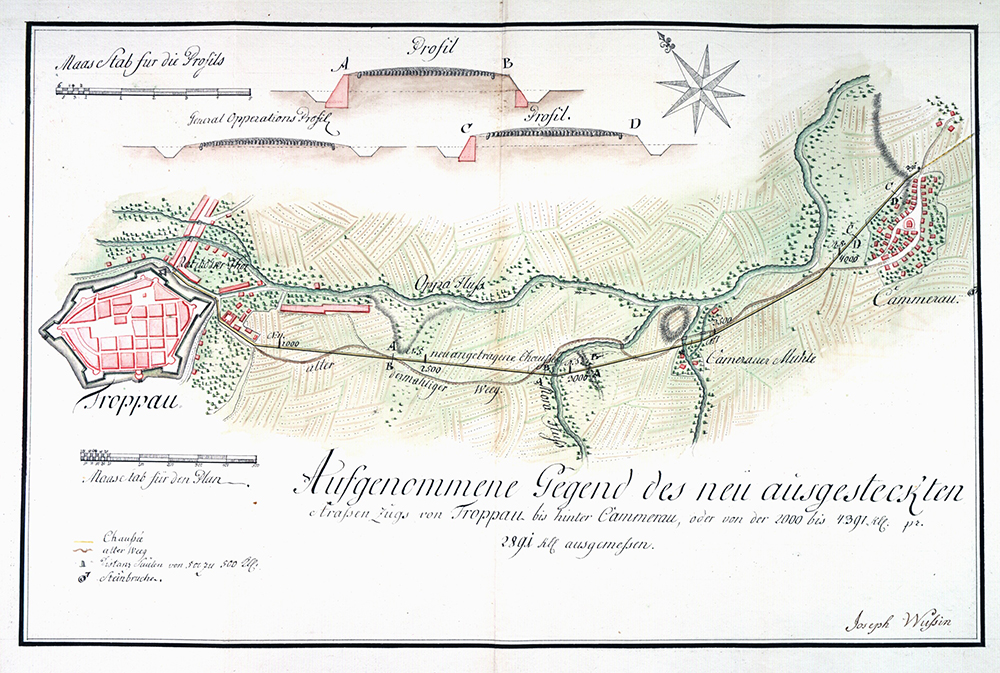
Die meisten Straßen waren noch Kreisstraßen. Sie wurden von den Bezirksstraßenausschüssen verwaltet und die Mittel für ihren Unterhalt wurden durch den so genannten Straßenwettbewerb aufgebracht, d.h. durch einen Steuerzuschlag, der auf der Grundlage eines Gesetzes aus dem Jahr 1849 unterschiedslos auf alle Einwohner der jeweiligen Gemeinde fiel. Erst in den 1880er Jahren verbesserte sich die Situation und seit den 1890er Jahren wurde das Kreisstraßennetz stetig ausgebaut. Die besten politischen Bezirke waren Frýdek, Těšín und Krnov, die schlechtesten politischen Bezirke waren Bruntál, Bílsko und Bílovec.
Auch die Anzahl der Gemeindestraßen mit schlechter Qualität ging im Berichtszeitraum zurück. Gab es 1881 noch 2 209 km Straßen in Schlesien, waren es 1910 nur noch 1 929 km. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Schlesien insgesamt 4 050 km Straßen, davon waren 457 km Staatsstraßen, 1 659 km Kreisstraßen und 1 934 km Gemeindestraßen.
Der Bau des Straßennetzes war auch eng mit dem Einsatz neuer Technologien, wie z.B. dem Walzen der Fahrbahn verbunden. Dadurch wurde sie fester, es wurde weniger Staub entwickelt und sie war nicht so rutschig. Dies erhöhte den Komfort und die Qualität des Reisens und entwickelte die Motorisierung. Im Jahr 1910 waren in Tschechisch-Schlesien 62 Autos und 225 Motorräder zugelassen, und es gab bereits die ersten Buslinien, die von der staatlichen Verwaltung mit finanziellen Zuschüssen der Gemeinden und Länder betrieben wurden. Im Jahr 1914 gab es in Tschechisch-Schlesien neben den 36 Postlinien auch 9 Buslinien, die einen schnellen und massenhaften Personentransport ermöglichten. Eine bedeutende Rolle bei der wachsenden Mobilität der Bevölkerung spielten auch die Ausflugsverbindungen in die Region Altvatergebirge, die eng mit dem Aufschwung des Tourismus verbunden waren.
6.2 Straßennetz von Tschechisch-Schlesien 1918-1945
Die Zwischenkriegsjahre waren eine Zeit vieler administrativer Veränderungen, die auch das Straßennetz von Tschechisch-Schlesien betrafen. Während sich der Staat vor allem um die Staatsstraßen kümmerte, darunter viele Fernstraßen, wurden die Kreisstraßen von der Kreisverwaltung betreut. Mit der fortschreitenden Motorisierung wurde vor allem der Sanierung und Instandhaltung sowie der Modernisierung der Straßen mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Die Zerstörung von Brücken, Straßen und Fahrzeugen war eine Folge des Krieges. Die Jahre 1918-1938 waren auch eine Entwicklungszeit für den Auto- und Busverkehr, der bis in die 30er Jahre des 20. Auch die Wirtschaftskrise der 1930er Jahre und der Zweite Weltkrieg hatten einen erheblichen Einfluss auf den Betrieb.
Die Zwischenkriegszeit war eine Zeit, in der sich die Aufmerksamkeit des Staates und der Bezirke eher auf den Wiederaufbau, die Sanierung und die Modernisierung bestehender Straßen als auf den Bau neuer Straßen richtete. Finanziell sollten diese Maßnahmen durch den neu eingerichteten Straßenfonds gedeckt werden. Seit den späten 1920er Jahren haben sich moderne Methoden der Straßenoberflächenbehandlung immer mehr durchgesetzt. Während 1926 in der Region Gesenke noch gewalzte Beläge vorherrschten, wurde in den übrigen Teilen Schlesiens bereits in Teer- oder Asphaltpflaster investiert und sogenannte Mittel- oder Schwerpflaster gebaut. Stark überlastete Gebiete, vor allem in der Nähe von Städten, begannen von der Pflasterung zu profitieren. Die Bergbau- und Hüttengesellschaft experimentierte ab 1933 sogar mit sogenannten Eisenstraßen, die sie z. B. in Třinec, Moravská Ostrava und auf der Staatsstraße Frýdek - Český Těšín anlegte. Trotz aller Bemühungen schritt die Modernisierung jedoch nur langsam und mühsam voran und dauerte unverhältnismäßig lange. Im Bezirk Český Těšín zum Beispiel betrug die Länge der Bezirksstraßen im Jahr 1928 66,2 km; bis 1936 kamen nur weniger als 7,5 km neue Straßen hinzu. Die Wartung wurde jedoch fast ausschließlich durch Walzen durchgeführt. Die Modernisierung des Straßennetzes wurde auch durch die große Wirtschaftskrise der 1930er Jahre negativ beeinflusst, die viele Arbeiten stoppte oder aufgrund der schlechten finanziellen Lage auf unbestimmte Zeit verschob.
Die fortschreitende Motorisierung wirkte sich zunehmend auf das Eisenbahnnetz aus. Anfangs wurde der Autoverkehr als Ergänzung zu ihm gesehen, doch allmählich wurde er zu seinem Konkurrenten, vor allem auf kurzen und mittleren Strecken. Zum Beispiel wurden die Busverbindungen zwischen Opava und Klimkovice, Dolní Lipová und Vrbno pod Pradědem und Zlaté Hory, von Šumperk nach Bruntál usw. hinzugefügt. Aus diesem Grund wurde der Auto- und Busverkehr zum Gegenstand eines harten Wettbewerbs zwischen privaten Unternehmern, der staatlichen Tschechoslowakischen Post, die 1927 zum Beispiel die Verbindungen zwischen Hlučín, Ostrava und Frýdek-Místek oder zwischen Opava und Bruntál, Frývaldov (heute Jeseník) und Červená Voda betrieb, und den staatlichen Tschechoslowakischen Eisenbahnen.
Diese Situation dauerte bis zum Jahr 1933, als die Tschechoslowakischen Eisenbahnen der alleinige Betreiber der staatlichen Buslinien wurden. Ihre Position wurde weiter gestärkt. Das Straßenverkehrsgesetz von 1935 über die Benutzung von Kraftfahrzeugen räumte den Eisenbahnbehörden weitreichende Befugnisse über den Auto- und Busverkehr ein, um die Staatsbahn vor Konkurrenz zu schützen.
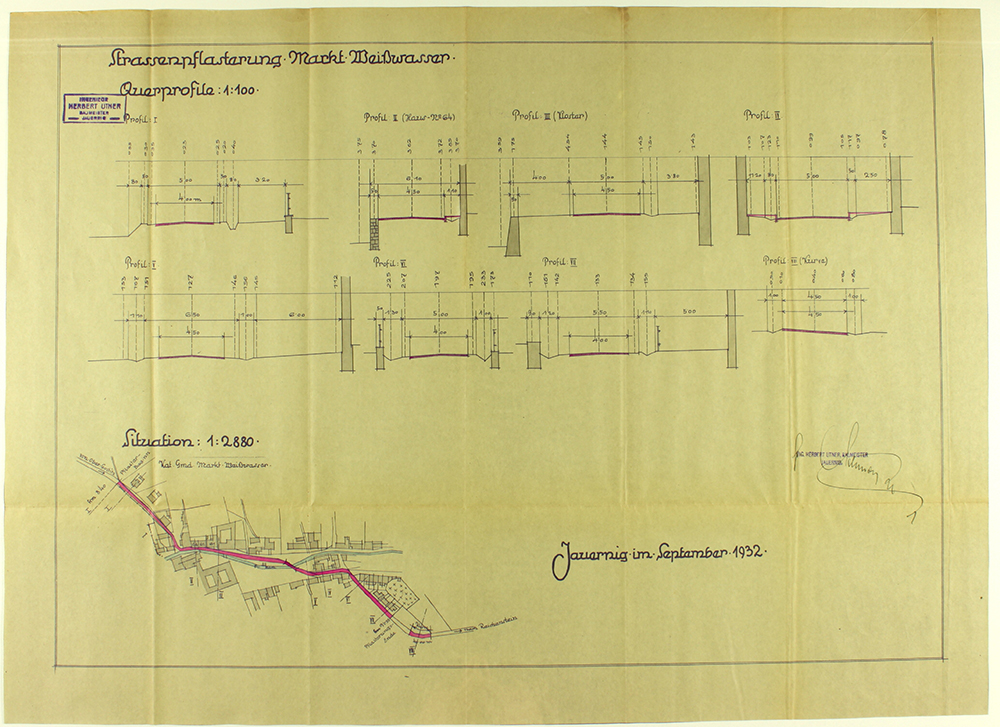
Neben den Ministerien beantragten auch die Gemeinden Genehmigungen für den Auto- oder Bustransport. So wurde z. B. im Jahr 1931 aufgrund der negativen Stellungnahme des Stadtrates von Moravská Ostrava und der Mährischen Lokalbahngesellschaft die Konzession für den Busverkehr von Píště über Dolní Benešov und Hlučín nach Moravská Ostrava nicht erteilt, da die geforderte Strecke bereits durch den staatlichen Busverkehr abgedeckt war. Das gleiche Schicksal ereilte die geplante Privatbahn von Třebom über Bolatice, Benešov, Hlučín und Ludgeřovice nach Moravská Ostrava. Koblov und Hrušov waren auch nicht mit dem Bus verbunden. Das Gesetz von 1932, das eine 30-prozentige Steuer auf Fahrpreise für Linien über die Gemeindegrenzen hinaus einführte, spielte bei der Ausschaltung der Wettbewerber eine große Rolle.
Die Zeit des Zweiten Weltkrieges bedeutete eine tiefgreifende Stagnation des privaten und staatlichen Auto- und Busverkehrs. Die polnische bzw. deutsche Besetzung Schlesiens führte zum Zerfall des integrierten Verkehrsnetzes und dessen Ausrichtung außerhalb des Protektoratsgebiets. Transporte bedurfte der Zustimmung des Oberlandrates, der Betrieb unterstand der Reichspost oder den Reichsbahnen. Auf dem besetzten Gebiet wurde in Šumperk ein Kraftenbetriebswerk errichtet. Bis 1944 unterstand es der Hauptverwaltung in Wrocław, ab 1944 der Hauptverwaltung in Opole. Šumperk und Jeseník wurden zu den Ausgangspunkten der schlesischen Transportlinien. Während des Krieges wurde der Verkehr jedoch stark eingeschränkt, bestehende Buslinien wurden gekürzt oder nach und nach eingestellt, Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Treibstoff, Ersatzteile und menschliche Arbeitskraft wurden immer knapper. Viele Unternehmer waren gezwungen, ihre Betriebe zu schließen. Kriegseinsätze und vorrückende Fronten zerstörten viele Straßen und Wege, Brücken wurden absichtlich zerstört und der verbliebene Fuhrpark wurde für den Kriegseinsatz requiriert.
6.3 Straßennetz von Tschechisch-Schlesien 1945-2020
Der Ausbau des Straßennetzes in Tschechisch-Schlesien ab den 1960er Jahren konzentrierte sich vor allem auf die Region Ostrava. Es entstand eine Reihe von Gebäuden, die einen Stadtring bildeten und Straßen, die die Stadt mit dem Umland verbanden. Die Idee des so genannten Schlesischen Kreuzes, dessen Ziel es ist, eine hochwertige Verkehrsverbindung zwischen der Region nach innen und außen zu schaffen, brachte eine große Veränderung im Straßennetz mit sich. Das Bauprogramm umfasste z. B. die Fertigstellung der D1, Rudná, den Bau der Umgehungsstraßen von Opava, Krnov und Frýdek-Místek sowie die Modernisierung der Straße D48 in Richtung Český Těšín. Die Modernisierung des Verkehrsnetzes spiegelt sich in einem integrierten Verkehrssystem wider, das Stadt-, Vorort- und Fernverkehr miteinander verbindet.
Im Zusammenhang mit der Nachkriegsbetonung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus und der Schwerindustrie entwickelte sich die Region Ostrava-Karviná dynamisch, was den Transport einer großen Anzahl von Arbeitskräften nicht nur aus den Regionen Opava und Hlučín, sondern auch aus der Slowakei erforderte. Aufgrund des Mangels an Fahrzeugen wurden die Staatsbuslinien oft von Unternehmen in Eigenregie betrieben. So transportierte die Firma OKD mit eigenen Fahrzeugen Arbeiter aus Petřkovice, der Rettungswagen der Grube Trojice beförderte Mitarbeiter auf der Strecke Slezská Ostrava - Domaslavice, und Privatpersonen betrieben den Transport auf der Strecke nach Dolní Bludovice und Horní Datyně.
Die Situation änderte sich nach 1948 bzw. 1949, als das Staatsunternehmen Tschechoslowakischer Automobiltransport (ČSAD, o. J.) gegründet wurde, das den bis dahin von der ČSD betriebenen Bus- und Autoverkehr, die bis 1948 von privaten Verkehrsunternehmen betriebenen Verkehrslinien und einen Teil der bis dahin von den Städtischen Verkehrsbetrieben Ostrava betriebenen Vorort- und Überlandlinien übernahm. Die ČSAD erlangte im staatlichen Automobiltransport die gleiche exklusive Stellung, die die ČSD im Eisenbahntransport hatte. Die ČSAD betrieb dann den Auto- und Busverkehr auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien, unter anderem übernahm sie schrittweise den Transport für die stillgelegten Schmalspurbahnen. Bis 1989 wurde eine Reihe von organisatorischen Änderungen vorgenommen, um flexibler auf die ständig steigenden Transportanforderungen reagieren zu können. Der Wendepunkt kam in den 1960er Jahren, als die Entwicklung des Busverkehrs einem einheitlichen landkreisweiten Konzept untergeordnet wurde. Das Ergebnis war z.B. die Übertragung des Busverkehrs in Ostrava und Umgebung auf die Ostrauer Verkehrsgesellschaft. In den 1970er Jahren begann der öffentliche Verkehr sowohl durch die Ausweitung des individuellen Autoverkehrs als auch durch die Ölkrisen, die den Kraftstoff verteuerten, eingeschränkt zu werden. 1979 gab es eine Überprüfung der allgemeinen Verkehrsfrequenz, eine Reduzierung der nicht genutzten Linien und eine Änderung der Fahrpläne, die danach regelmäßig wiederholt wurde. Durch die Privatisierung des Staatsunternehmens ČSAD im Jahr 1992 entstand eine Reihe von privaten Verkehrsbetrieben, die bis heute den Verkehr in der Region sicherstellen (z.B. 3ČSAD, der das Gebiet von Havířov, Karviná, Frýdek-Místek bedient, ČSAD BUS Ostrava, Arriva, usw.) und die Teil des integrierten Verkehrssystems von Ostrava (IDOS) sind. Der Verkehr in Ostrava wird in den angrenzenden Gemeinden durch Busse und Oberleitungsbusse von den Verkehrsbetrieben Dopravní podnik města Ostravy, a. s. sichergestellt.

Die Entwicklung des individuellen Autoverkehrs erforderte ein hochwertiges Straßennetz. Auf der Grundlage eines Regierungsbeschlusses über die Notwendigkeit, die Voraussetzungen für die weitere Verkehrsentwicklung zu schaffen, wurde der so genannte Ostrava Transport Master Plan erstellt, der die Situation in der Stadt umfassend erfasste. Es wurde auch die Grundlage für den Aufbau eines neuen Kommunikationssystems gelegt. In den Jahren 1973 und 1984 wurde es durch andere Bereiche weiterentwickelt. Die Anbindung an das äußere Straßennetz sollte durch die Autobahn D47 erfolgen, die seit den 1960er Jahren als Teil der Autobahn Wien - Bratislava - Brno - Ostrava - Warschau geplant war. Teil des allgemeinen Plans waren die sog. A-Klasse-Straßen, die Verbindungen innerhalb der Agglomeration (Rudná, Bohumínská, Orlovská, Frýdecká, Místecká) herstellten und auch einen Stadtring bildeten (Rudná, Plzeňská, Mariánskohorská, Bohumínská, Frýdecká). Der Bau des Verkehrssystems begann 1966 mit der sog. verlängerten Rudná, der bis 1990 weitere Bauarbeiten folgten (Místecká, Fryštátská, usw.). Es wurden auch Umfahrungen, Rekonstruktionen und Durchfahrten anderer schlesischer Städte (Bruntál, Krnov, Opava, Šumperk, Horní Benešov, Frýdek-Místek) in Betracht gezogen oder vorbereitet. Das Jahr 1989 war ein Wendepunkt und die 1990er Jahre waren geprägt von Änderungen der bestehenden Baupläne.
Das grundlegende Dokument der Entwicklung des Straßennetzes der Mährisch-Schlesischen Region für das 21. Jahrhundert war das Konzept der Entwicklung der Straßeninfrastruktur, das das Hauptverkehrsnetz der Region zur Sicherstellung seiner Qualitätsverbindungen innerhalb und außerhalb der Region definierte (2002-2003) und dessen Bewertung und Genehmigung im Jahr 2008. Die Idee des sogenannten Schlesischen Kreuzes war geboren. Der östliche Zweig umfasst das Gebiet von Ostrava, Český Těšín und Žilina (verbindet die Agglomerationen Katowice, Ostrava, Žilina), der westliche Zweig umfasst das Gebiet von Ostrava, Opava, Krnov und Opole (verbindet die Grenzregionen von Opava, Krnov und Opole). In Nord-Süd-Richtung ist die Hauptverbindung durch die Autobahn D47/D1 nach Bohumín mit Anschluss an die polnische Autobahn gegeben (2012). Derzeit wird die E462 bzw. D48 mit der Umfahrung von Frýdek-Místek, dem Anschluss der Straße I/11 an die Autobahn D48 bei Třanovice modernisiert. Die Umfahrung von Velká Polomi und Hrabyně, einschließlich des Abschnitts der verlängerten Rudná, wurde in Betrieb genommen. Die Nordumfahrung von Opava wird vorbereitet, die Nordwestumfahrung von Krnov und Verlegungen ausgewählter Straßen werden umgesetzt. Auch Eisenbahnkorridore sind Teil des Konzeptes, darunter der Bau einer Eisenbahn zum Flughafen in Mošnov.
6.4 Eisenbahnnetz von Tschechisch-Schlesien 1847-1918
Das Schienennetz ist für die Transformation der Wirtschaft ein entscheidendes Element. Es schafft Nachfrage nach Energieressourcen, Rohstoffen, Innovationen und ungelernten sowie qualifizierten Arbeitskräften. Es bringt neue Voraussetzungen für die Lokalisierung der Industrie, mobilisiert das Unternehmertum und verändert das tägliche Leben der Bevölkerung. Seine Entwicklung ist eng mit dem Wachstum des städtischen Verkehrs verbunden. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden Straßenbahnen entwickelt, die das Rückgrat der späteren städtischen Verkehrssysteme bildeten.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schuf "Ferdinandka" die Rückgratverbindung des Zentrums der Monarchie mit Mähren, österreichische und preußische Teile Schlesiens und Galiziens. Die Košice-Bohumín-Eisenbahn (ab 1866) war vor allem auf die Verbindung des Bezirks Ostrava-Karviná und des Eisenwerks Trinec mit den Erzgruben in Oberungarn ausgerichtet und stellte bis in die Zwischenkriegszeit die einzige bedeutende Eisenbahnverbindung mit den östlichen Teilen der Monarchie bzw. der Tschechoslowakischen Republik dar.
Wichtig für die allgemeine Entwicklung Österreichisch-Schlesiens waren auch die Abzweigungen der Kaiser Ferdinand Nordbahn nach Opava (1855) und Bílsko (1855), und die Bahnhöfe Hrušov und Bohumín spielten ab den 1850er Jahren als Großhandelswarenlager eine wirtschaftlich unersetzliche Rolle. Die "Ferdinand Bahn" beteiligte sich am Bau und Betrieb einer Reihe weiterer Eisenbahnen auf dem Gebiet Österreichisch-Schlesiens, von Industrieeisenbahnen, einschließlich einer Bergbaubahn im Bezirk Ostrava-Karviná. Im Jahr 1906 wurde sie verstaatlicht und der Betrieb mit Ausnahme der Bergbaubahn von den k.k. Staatsbahnen übernommen.
Seit 1871 diente die Eisenbahn Ostrava-Frýdlant der Verbindung der Industriebetriebe des Bezirkes Ostrava-Karviná mit den Eisenhütten und anderen Betrieben in der Region Frýdek (z.B. Lískovec, Baška) und der Region Frýdlant (z.B. Frýdlant nad Ostravicí). Ab 1911 war sie der Ausgangspunkt der Verbindung zwischen Ostrava und Těšín (über Kunčice, heute Ostrava-Kunčice). In den 1860er und 1870er Jahren wurde die bis dahin verkehrstechnisch isolierte Region Jeseník allmählich angeschlossen. Die Mährisch-Schlesische Zentralbahn sorgte für eine mehrfache Anbindung an das preußische Eisenbahnnetz. Ab 1872 verlief die Strecke von Olomouc nach Krnov, Jindřichov in Schlesien mit einer Abzweigung ins preußische Głuchołazy und Opava und wurde nach und nach durch eine Reihe von lokalen Nebenbahnen ergänzt.
Nach dem Zusammenbruch der Wiener Börse im Jahr 1873 entwickelte sich in den 1880er und 1890er Jahren der Bau von Lokalbahnen. So entstand ein Schienennetz, das, mit kleinen Modifikationen, bis heute erhalten geblieben ist. Es wurde z.B. die Kaiser-Ferdinand-Nordbahn gebaut (Frýdek - Bílsko; Studénka - Bílovec, 1890; Studénka nad Odrou - Budišov nad Budišovkou, 1892 oder Opava - Horní Benešov, 1898). Von besonderer Bedeutung für die Region Ostrava-Karviná war die Verbindung von Karviná nach Petrovice u Karviné (1898). In den 1880er Jahren trugen die Österreichische Lokalbahngesellschaft (Strecke Hanušovice - Głuchołazy) und ab den 1890er Jahren die Österreichischen Staatsbahnen (z.B. Opava - preußische Grenze in Richtung Ratiboř über Chuchelná und durch Kravaře nach Hlučín, Vidnavy, Zlatohorsko, Javornicko) zur Erschließung der Regionen Gesenke und Javornicko bei.
Andere Unternehmer waren zum Beispiel das Erzbistum Olmütz (Frýdlant nad Ostravicí - Bílá, 1908) oder die Familie Gutmann (Studénka - Štramberk, 1881). Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Bau von Eisenbahnen durch Privatpersonen ermöglicht. Sie wurden von Gemeinden, lokalen Unternehmern oder einzelnen Länder oder dem Staat errichtet. Es entstand eine Reihe von kurzen Lokalbahnen, die meist durch wirtschaftlich unattraktive Umgebungen führten (Schmalspurbahn von Třemešná nach Osoblaha, 1898, oder die Lokalbahn Svinov - Klimkovice, 1911).
Der Eisenbahnverkehr im Bezirk Ostrava-Karviná entwickelte sich auf eine spezifische, aber für Kohlegebiete charakteristische Weise. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts prallten im Hinterland der Agglomerationen Ostrava und Karviná die Anschlussgleise der Bergbaubahn und der entwickelte vorstädtische Personenverkehr aufeinander. Letztere wurde von der Schlesischen Landesbahn betrieben, die ab 1910 Ostrava mit Karviná über Lutyně und Orlova und das polnische Ostrava mit Michálkovice verband, sowie von der Lokalbahn Moravská Ostrava - Karviná, die ab 1909 Ostrava mit Karviná über Petřvald verband.

Im mährischen Keil - in der Region Ostrava - entwickelt die Brünner Lokalbahngesellschaft seit 1984 das städtische Verkehrsgeschäft; ihre Linien boten den Bewohnern der Agglomeration Ostrava im Jahr 1907 eine hochwertige Verbindung mit den Bahnhöfen Přívoz und Svinov.
In traditionellen Provinz- oder Verwaltungssiedlungen (z. B. Opava oder Těšín) oder in wirtschaftlichen Zentren (z. B. Bílsko oder Bohumín) wurden kurze elektrifizierte Strecken, oft von geringer Spurweite, gebaut, die sogenannten Straßenbahnen. Ihr Hauptzweck war die Verbindung des Stadtzentrums mit dem Bahnhof und anderen wichtigen städtischen Gebäuden und Gebieten (Kasernen, Krankenhäuser, Theater, Parks, usw.). Die Stadtverwaltung war stark involviert, oft in Zusammenarbeit mit den Gartenbaubetrieben. Der Betrieb der Eisenbahnen wurde von einer Aktiengesellschaft übernommen, an der die Städte Anteile hielten. Der Bau und Betrieb der Bahnen wurde aber nicht nur wirtschaftlich betrachtet. Sie wurden als öffentliche Dienstleistung wahrgenommen, als Mittel des allgemeinen Gemeinwohls und als Beweis dafür, dass sich die Stadt modernisierte und keine Angst vor neuen - modernen - technischen und sozialen Herausforderungen hatte. Sie dienten nicht nur dem Personentransport, sondern konnten auch Pakete, Post und im Kriegsfall auch Verwundete transportieren. Die Entwicklung in der Region Těšín stand in scharfem Kontrast zur Entwicklung im Westen von Schlesien, wo nur Opava einen städtischen Eisenbahnverkehr vorweisen konnte.
6.5 Eisenbahnnetz von Tschechisch-Schlesien 1918-1945 inkl. öffentlicher StadtverkehrD
In der Zwischenkriegszeit wurde das Eisenbahnnetz stabilisiert, seine Verwaltung reorganisiert und das Staatsunternehmen Tschechoslowakische Eisenbahnen gegründet. Die Situation der annektierten Region Hlučín musste neu geklärt werden. Die Verstaatlichung der bisher privaten Eisenbahnen wurde fortgesetzt. Die Bahnen haben jedoch im Laufe der 1920er und besonders der 1930er Jahre durch den heranwachsenden Automobilverkehr eine starke Konkurrenz erhalten. Auch das Eisenbahngeschäft wurde durch die Weltwirtschaftskrise und die Kriegsereignisse in Mitleidenschaft gezogen.
Der Streit um Těšín hat die Verkehrssituation sehr stark beeinflusst. Die Republik Polen beanspruchte die einzige und strategische Verbindung zwischen den böhmischen Ländern und der Slowakei - die Bahnstrecke Košice-Bohumín. Durch die Entscheidung der Alliierten Kommission im Jahr 1920 blieb die Bahn auf dem Gebiet der Tschechoslowakei. Bereits 1919 wurde für sie ein Sonderkommissar ernannt und alle ihre Linien wurden der Direktion der Staatseisenbahnen unterstellt. Im Jahr 1921 wurde die Bahn von den Tschechoslowakischen Eisenbahnen übernommen, der schlesische Teil unterstand der Direktion der Staatseisenbahnen in Olmütz, der slowakische Teil der Direktion in Košice. Der Staat war ab 1925 Aktionär der Gesellschaft, aber die Verstaatlichung fand nicht statt, die Bahn blieb ein privates Unternehmen. Die Situation änderte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Jahr 1940 unterzeichneten die beteiligten Staaten (Deutsches Reich, Slowakei, Ungarn) ein Abkommen über die Liquidation des Unternehmens. Die Rechte und Pflichten wurden zwischen den drei Staaten in der Reihenfolge der Länge der Linie aufgeteilt. Auch in der Slowakei wurde die Liquidation der Gesellschaft angeordnet, der Sitz wurde nach Bratislava verlegt und die slowakische Sektion wurde durch das Gesetz Nr. 52 aus dem Jahr 1943 verstaatlicht. Die endgültige Verstaatlichung der Bahn erfolgte jedoch erst 1948.
Der Streit um Těšín und die Teilung von Těšín in einen tschechischen und einen polnischen Teil wurde der Těšíner Straßenbahn zum Verhängnis, sie stellte den Betrieb ein und verschwand 1921 völlig.
Ein ebenso heikles Thema war die Annexion der Region Hlučín, die nicht mit Schlesien, sondern mit Preußen verbunden war. Das tschechoslowakische Verkehrsnetz wurde so um den preußischen Teil der Strecke von Opava bis Ratiboř (der Abschnitt von der ehemaligen Grenze bis Kravaře, Chuchelné, Hlučín) erweitert. Der Abschnitt Hlučín - Petřkovice–Chałupki wurde jedoch 1925 nur im Teil von Hlučín - Petřkovice fertiggestellt. Der Abschnitt nach Chałupki wurde nicht realisiert, die bereits gebauten Teile wurden abgerissen. Anstelle der Eisenbahn wurde die Verbindung zwischen Petřkovice und Ostrava bis in die 1950er Jahre durch Busse, Autos oder individuelle Verkehrsmittel sichergestellt. Die sogenannte Petřkovice-Brücke wurde zu einem strategischen Bauwerk, das die Region Hlučín mit Ostrava verbindet.
Die 1920er Jahre markierten die Konsolidierung des tschechoslowakischen Eisenbahnnetzes. Auf der Grundlage eines Gesetzes von 1925 verstaatlichte der Staat in mehreren Wellen alle Sekundäreisenbahnen auf dem Gebiet der Republik.
Auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien blieben nur die Bahn Košice-Bohumín, die Bergwerksbahn, die Bahn Moravská Ostrava - Karviná und die Bahn Studénka - Štramberk in Privatbesitz. Die Rationalisierung des Verkehrs auf den Staatslinien schritt voran, auf den viel befahrenen Fernstrecken wurde der Bau eines zweiten Gleises, die Elektrifizierung und Motorisierung in Angriff genommen. Im Jahr 1929 verkehrte zum Beispiel in Gesenke ein motorbetriebenes Fahrzeug auf der Strecke von Olmütz über Šternberk, Šumperk, Hanušovice nach Mikulovice und später auch nach Krnov und Zuckmantel.

In den Jahren 1923-1927 fand auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien der Bau der Strecke von Svinov nach Kyjovice-Budišovice statt. Es handelte sich um den Bau einer Provinzbahn, die vom schlesischen Staat finanziert wurde, der sie anschließend den Schlesischen Landesbahnen zum Betrieb überließ. Die geplante Verlängerung über Hradec nach Opava wurde nicht realisiert.
Nach München im Jahr 1938 wurden Opava, Hlučín und Jesenica dem Deutschen Reich angegliedert und die Strecken wurden in die Reichsbahn mit Deutsch als Amtssprache eingegliedert. Von Oktober 1938 bis September 1939 war Těšín von Polen besetzt. Polnisch wurde zur Amtssprache und die Linien wurden von der Regionaldirektion beaufsichtigt. Es entstanden neue Grenzübergänge - Bogumin, Szumbark und Dobrá. Am 1. September 1939 Polen vom Deutschen Reich besetzt.
Die Rekonstruktion der Kriegsereignisse und deren Auswirkung auf den Betrieb der Eisenbahn ist vor allem wegen des Mangels an Quellen schwer nachzuvollziehen. Das Gebiet unterstand der Reichsdirektion in Opole, deren Archiv bei Kriegsende abgebrannt ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Krieg zu einer tiefgreifenden Stagnation der Industrie und zur Zerstörung von beweglichem und unbeweglichem Eigentum, einschließlich des Verlustes von Menschenleben, führte. Zudem wurden am Ende des Krieges viele Bahngebäude durch die vorrückende Front stark beschädigt oder gesprengt.
Die Trends des Eisenbahnbetriebes der Zwischenkriegszeit wurden auch vom städtischen Schienenverkehr kopiert. Die Stadtverwaltungen stiegen in das Geschäft ein, und die 1920er Jahre markierten vor allem die Modernisierung des Betriebs und die ersten Versuche, Vorort- und Überlandbuslinien einzuführen. Die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren führte zu Stagnation und Kürzungen. Durch die Abtretung Schlesiens an Polen und die anschließende Beschlagnahme durch das Deutsche Reich wurde der Verkehr auf den Strecken im schlesischen Teil der Region Ostrava-Karviná unterbrochen. Die neuen Strecken kreuzten das Territorium zweier Staaten, was sich auf ihren Betrieb auswirkte, z.B. im Fall der Schlesischen Landesbahn wurde der Betrieb nach der Beschlagnahme zunächst der Śląskie kolejki krajowe, dann der Teschener Kreisbahn anvertraut.
6.6 Eisenbahnnetz von Tschechisch-Schlesien inkl. ÖFFENTLICHER VERKEHR 1945-2020
Die Form des Eisenbahnnetzes in Tschechisch-Schlesien wurde durch die Nachkriegsreorganisation Europas beeinflusst, die zur Streichung von grenzüberschreitenden Streckenabschnitten führte. Nach 1948 konzentrierte sich der Staat vor allem auf die Modernisierung der verkehrsreichsten Fernverkehrsstrecken mit strategischem Charakter. Die Investitionsmaßnahmen wurden auf die Eisenbahnstrecken der Region Ostrava-Karviná auf Kosten der schlesischen Regionalbahnen gerichtet. Mit der fortschreitenden Liberalisierung des Marktes nach 2000 wurde der Verkehr auf vielen Nahverkehrsbahnen reduziert, eingestellt oder nur teilweise wiederhergestellt. Die Eisenbahn und der städtische Verkehr wurden Teil eines integrierten Verkehrssystems und des sogenannten Schlesischen Kreuzes.
Die Expansion der Schwerindustrie bei gleichzeitiger Unterminierung in den 50er und vor allem in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts erforderte die Verlegung von Strecken im Bezirk Ostrava-Karviná. Auf der ehemaligen Košice-Bohumín-Bahn im Abschnitt Dětmarovice - Louky nad Olší musste eine neue Strecke gebaut und in Betrieb genommen werden. Auch die Verbindung zwischen Ostrava, Havířov und Český Těšín erfuhr wesentliche Änderungen. Die ursprüngliche Strecke wurde im Abschnitt Havířov - Albrechtice bei Český Těšín (1962) verlegt, und im Zusammenhang mit dem Bau der sog. Polanecká Verbindung zwischen Svinov und Kunčice (1964) wurde die Strecke zweigleisig und elektrifiziert. Die oben erwähnten ursprünglichen Streckenabschnitte zusammen mit dem Abschnitt Doubrava - Orlová – Bohumín wurden in den 1960er bis 1980er Jahren von OKR - Transport übernommen und dienten weiterhin ausschließlich dem Güterverkehr.
Mit dem Rückgang der Bergbauaktivitäten im Bezirk ging auch der Betrieb dieser Strecken zurück, und der Abschnitt Rychvald - Bohumín wurde 2019 eingestellt. Gegenwärtig sind die Strecken nur in Ausnahmefällen bei Veranstaltungen des Schlesischen Eisenbahnvereins in Zusammenarbeit mit dem Güterverkehrsunternehmen AWT zugänglich. Die Bahnstrecke der ehemaligen Košice-Bohumín-Eisenbahn ist jetzt im Fahrplan mit der Nummer 320 gekennzeichnet, der Abschnitt von Bohumín nach Dětmarovice mit der Nummer
326. Die Strecke von Bohumín nach Petrovice ist Teil des zweiten Eisenbahnkorridors, der Teil von Bohumín bis zur slowakischen Grenze ist Teil des dritten Eisenbahnkorridors. Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts wurde die Strecke einer umfangreichen Modernisierung unterzogen, die die Modernisierung des Signalsystems, den Bau eines zweiten Gleises im Jablunkov-Tunnel, die Rekonstruktion von Brücken und anderen Streckenkonstruktionen, einschließlich der Bahnhofsgebäude, usw. umfasst. Die Modernisierung der Korridore ist Teil des regionalen Verkehrskonzepts, des sogenannten Schlesischen Kreuzes.
Die Nachkriegsordnung Europas und der Eiserne Vorhang führten zur Streichung der grenzüberschreitenden Abschnitte der schlesischen Strecken (Bernartice u Javorníku - Otmuchów, Vidnava - Nysa, Krnov - Głubczyce, Opava - Pilszcz). Nur der Abschnitt über Głuchołazy blieb im Passagierbetrieb, allerdings ohne Ein- und Ausstiegsmöglichkeit für tschechische Fahrgäste. Änderungen in der Form des lokalen Eisenbahnnetzes waren bis 1989 minimal. Lediglich der Teil der Strecke von Svobodné Heřmanice nach Horní Benešov wurde wegen der Absenkung des Untergrundes eingestellt (1981), die Strecke Ostravice - Bílá wegen des Baus des Wasser- kraftwerkes Šance (1965) und des Baus einer Straßenbahnverbindung zwischen Hlučín und Ostrava über die sogenannte Friedenslinie (1951-1982).

Wesentlich bedeutendere Eingriffe in das Schienennetz sind seit den 1990er Jahren zu beobachten. Die Auflösung der Tschechoslowakei führte zur Reorganisation des Staatsunternehmens Tschechoslowakische Staatseisenbahnen in Tschechische Eisenbahnen. Ein Regierungsbeschluss von 1995 trennte alle regionalen Bahnen von den nationalen Bahnen. Die Liberalisierung und Optimierung des Regional- und Stadtverkehrs, die Schaffung von integrierten Verkehrssystemen usw. betrafen die Regionalstrecken Javorník und Jeseník. Die Hauptstrecken zwischen Olomouc, Šumperk, Krnov, Opava und Ostrava einer schrittweisen und umfassenden Modernisierung des Gleisober- und -unterbaus, der Signaltechnik und der Stationseinrichtungen unterzogen, wobei die Verbindungen auf den nicht genutzten und unrentablen nicht elektrifizierten Strecken reduziert werden. Zum Beispiel ist ein saisonaler Personen-/Touristenverkehr in Betrieb (Třemešná in Schlesien - Osoblaha, Mikulovice - Zlaté Hory, Kravaře in Schlesien - Chuchelná). Der private Güterverkehr ist oft die einzige Möglichkeit, regionale Strecken (Opava-Ost - Svobodné Heřmanice, in Verhandlung Velká Kraš - Vidnava) oder zumindest einen Teil davon (Bruntál - Světlá Hora) zu erhalten.
Für den städtischen Verkehr war die Gründung der städtischen Betriebe im Jahr 1949 entscheidend. Im Jahr 1953 entstand durch die Zusammenlegung einzelner Verkehrsbetriebe der Verkehrsbetrieb Ostrava, der die Verbindung mit Hlučín einleitete und in den 1970er Jahren wurden die Schmalspurstrecken im schlesischen Teil des Bezirkes Ostrava-Karviná wegen Unterspülung stillgelegt und durch den Bus- und Obusverkehr ersetzt. Diese Art von Transport wurde in Opava jedoch bereits 1945 von der örtlichen Transportgesellschaft betrieben. Die Veränderungen nach 1989 betrafen auch die Verkehrsbetriebe, die sich in Aktiengesellschaften umwandelten und in enger Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden Stadt- und Vorortlinien betreiben und Teil eines integrierten Verkehrssystems wurden. Das Projekt des Vororteverkehrs in Form einer Zug-Straßenbahn, die Ostrava mit Orlová, Opava und Havířov verbindet und auch die ursprünglichen Strecken der Košice-Bohumín-Eisenbahn (Heřmanice - Rychvald - Bohumín - Orlová - Ostrava) nutzt, befindet sich noch im Stadium der Überlegungen.
6.7 Landwirtschaft - natürliche Bedingungen für die Landwirtschaft
"Sie haben mir den Garten genommen und den Zaun gelassen". Der denkwürdige Ausspruch von Kaiser Josef II., der einige Jahre nach dem letzten verlorenen Krieg mit Preußen am nördlichsten Punkt Österreichisch-Schlesiens gemacht wurde, charakterisiert gut das Gelände Schlesiens und damit die geomorphologischen Bedingungen für die Landwirtschaft. Der größte Teil des sogenannten preußischen (heute polnischen) Schlesiens besteht aus Ebenen oder nur leicht gewellten Hügeln, die auch die heutige tschechisch-polnische Staatsgrenze vom Weißen Wasser (mit Ausnahme eines kurzen Abschnittes des Zuckmanteler Bergland) bis Český Těšín bilden. Auf der österreichischen (jetzt tschechischen) Seite steigt das Gelände bald steil an und besonders im westlichen Teil Schlesiens (Javornicko, Jesenicko, Krnovsko) geht die fruchtbare Braunerde buchstäblich innerhalb weniger Meter in Bergackerland über.
Hinsichtlich der aktuellen Struktur des Bodenfonds haben die Verwaltungsbezirke der Gemeinden mit erweiterter Zuständigkeit Kravaře, Bílovec und Český Těšín den höchsten Anteil an landwirtschaftlichen Flächen (über 50 %), während Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov und Karviná den niedrigsten haben. Während in Frýdlant und Jablunkov der größte Teil der Fläche Wald ist, gibt es im SO ORP Karviná einen hohen Anteil an bebauten und urbanisierten Flächen. In absoluten Werten ist die größte Menge der ZPF in SO ORP Opava (36,2 Tausend ha) in Krnov und Bruntál.
Der höchste Anteil des Pflügens ist in den SO ORP Kravaře (88,7%), Opava und Hlučín. In der absoluten Fläche von SO Opava (30,5 Tausend ha). Dauergrünland überwiegt innerhalb des ZPF in SO Jablunkov (65,8 %), Frýdlant nad Ostravicí und Bruntál. Eine Seltenheit ist, dass er im SO Bohumín 11 % der Wasserfläche ausmacht, was eindeutig der höchste Wert in der Tschechischen Republik ist.
Die Landwirtschaft war in Schlesien nie so wichtig wie in Böhmen und Mähren. Wesentlichere Veränderungen in der Struktur der Felder, Wälder, Wiesen und Siedlungen im westlichen - Sudetenland, d.h. dem größten Teil Schlesiens - traten in den zwei Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf. Nach der Vertreibung der Deutschen konnten vor allem die höher gelegenen und abgelegenen Gebiete nicht wieder besiedelt werden und wurden daher teils absichtlich, teils spontan aufgeforstet. Anders verhält es sich jedoch in der Umgebung von Ostrava in den Regionen Karviná und Bohumín, wo es infolge der umfangreichen und grundlegenden Beeinträchtigung des Gebietes durch den Kohleabbau, die Entwicklung der Schwerindustrie und die damit verbundene massive Industrie- und Wohnbebauung praktisch bis zum heutigen Tag zu einer erheblichen dauerhaften Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Flächen kam und kommt.
Natürliche Bedingungen und Fruchtbarkeit des Gebietes. Die allgemeinen natürlichen Bedingungen für die Landwirtschaft werden stark von den Nordwinden beeinflusst, denen die meisten der fruchtbaren Ebenen ausgesetzt sind. Die Gebirgszüge im Süden und Südwesten halten die Regenfälle zurück und verursachen hohe Niederschläge, wodurch die landwirtschaftliche Saison verkürzt wird. Zu den fruchtbarsten Gebieten Schlesiens gehören die nicht sehr ausgedehnte Weidenaues Tiefland (sog. Schlesische Haná oder Schlesische Ponisie) (ca. 250-350 m ü. M.), das Opava-Hügelland (ca. 240-350 m ü. M.), das den Osten des Osoblaha-Gebietes, die Opava-Aue zwischen Krnov und Opava und die weitere Umgebung der Stadt Opava sowie die Reste der unbebauten Flächen im Ostrauer Becken sowie die Mährische Pforte umfasst, mit Ausnahme der schmalsten, mit Auenwäldern und Wiesen bewachsenen Oderaue. Insgesamt haben die niedrigeren Höhenlagen in West- und Mittelschlesien günstigere Bedingungen für die Landwirtschaft. Die Ebenen, Überschwemmungsgebiete und Hochebenen Ostschlesiens sind aufgrund höherer Niederschläge und schwererer, weniger durchlässiger Böden ebenfalls weniger fruchtbar. In den Beskiden ist die Viehzucht der Berghirten noch einigermaßen erhalten, und typische karpatische Streuhöfe finden sich ebenfalls in der Umgebung.
In den Sudeten finden sich noch Reste der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, die sich jedoch tendenziell zurückentwickelt.
Während im flachen Teil Schlesiens die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge 550 mm beträgt, sind es in den Bergen über 1000 mm (Lysá hora als regenreichster Ort in Tschechien hat 1790 mm). Nutzpflanzen wie Weizen, Gerste und Zuckerrüben konnten praktisch nur in diesen fruchtbarsten Gebieten angebaut werden. Da Berg- und Vorgebirgslandschaften vorherrschen, wird Schlesien eher mit der Weidehaltung von Rindern und Schafen in Verbindung gebracht.

Bezogen auf die Produktionsgebiete entfällt etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche in Schlesien auf das Kartoffelanbaugebiet, ein Viertel auf das Rübenanbaugebiet und ein Viertel auf das Berggebiet.
Die Bedingungen für die Landwirtschaft können auch im Einklang mit der Regierungsverordnung Nr. 241/2004 Slg. betrachtet werden, nach der die benachteiligten Gebiete in Höhen über 600 m über dem Meeresspiegel oder mit starker Neigung in Höhen von 500-599 m über dem Meeresspiegel als benachteiligte Gebiete (LFA) eingestuft werden, in denen die Landwirte Ausgleichsbeiträge aus EU-Mitteln entsprechend der Fläche des Dauergrünlands erhalten. Das benachteiligte Gebiet umfasst die gesamte Fläche des Landes in den Regionen Bruntál, Frýdlant n. O., Jablunkov a Vítkov.
6.8 Landwirtschaft in den Jahren 1848-1945
Nach der Niederlage im Ersten Preußisch-Österreichischen Krieg 1740-1742 verlor Österreich sieben Achtel des schlesischen Gebietes. Die österreichischen Herrscher förderten die wirtschaftliche Entwicklung Österreichisch-Schlesiens. Im Jahr 1890 arbeiteten noch 41% der Gesamtbevölkerung Schlesiens in der Landwirtschaft. Durch die rasante Entwicklung von Bergbau und Industrie und die damit verbundene Abwanderung in die Städte sank dieser Anteil von 35,1 % (1900), auf 29,2 % (1910) auf 21,9 % (1921) – der niedrigste aller tschechoslowakischen Länder. Auch der Anteil der landwirtschaftlichen Fläche pro Kopf (0,36 ha) war die niedrigste in der Tschechoslowakei.
Was die Viehzucht betrifft, kann man die Pferdezucht als wichtig ansehen, vor allem im staatlichen Gestüt in Opava und in einigen privaten, z.B. in Jarkovice und Vlastkovice. Dank des Schlesischen Landespferdezuchtverbandes entstand an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die Kaltblutrasse Schlesischer Noriker, die auch heute noch vor allem für die Waldarbeit eingesetzt wird. Die Schafzucht ist im 19. Jahrhundert stark zurückgegangen und wird hauptsächlich nur noch in den Beskiden betrieben. Sie wurde nach und nach durch die Rinderzucht ersetzt. Trotz der allgemeinen Beliebtheit von Schweinefleisch ist die Anzahl der gehaltenen Schweine im Berichtszeitraum ist langsam rückläufig. Weitaus stärker, mit der Zunahme der Industriearbeit und dem Mangel in der Kriegszeit, hat die Zahl der Ziegen zugenommen, vor allem in ärmeren Haushalten, auch am Rande der Städte. Die Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, ihre Bewirtschaftung und die Ausbildung der Landwirte wurde maßgeblich durch den in drei Landessektionen gegliederten Schlesischen Landwirtschaftsrat beeinflusst, der neben zahlreichen anderen Sonder-, Genossenschafts- und Verbandsorganisationen für die Entwicklung und Innovation in der Landwirtschaft zuständig war. Diese stellten unter anderem Kredite für Landwirte, den Kauf von Saatgut, Düngemitteln und Maschinen sowie die Vermarktung von Produkten zur Verfügung. Im Jahr 1924 waren in Schlesien insgesamt 296 Mühlen registriert. Zum Vergleich: In Mähren gab es zu dieser Zeit 1658 Mühlen und in Böhmen 5148 Mühlen. Insgesamt 243 Mühlen waren mit der Landwirtschaft verbunden, 25 mit Sägewerken, 21 mit Bäckereien, 13 mit Kleinwasserkraftwerken und 11 mit anderen Unternehmensarten. Unter
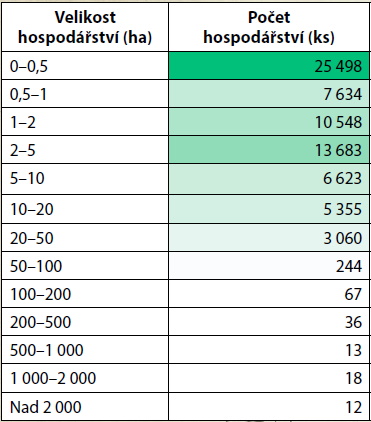

Was die Viehzucht betrifft, kann man die Pferdezucht als wichtig ansehen, vor allem im staatlichen Gestüt in Opava und in einigen privaten, z.B. in Jarkovice und Vlastkovice. Dank des Schlesischen Landespferdezuchtverbandes entstand an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die Kaltblutrasse Schlesischer Noriker, die auch heute noch vor allem für die Waldarbeit eingesetzt wird. Die Schafzucht ist im 19. Jahrhundert stark zurückgegangen und wird hauptsächlich nur noch in den Beskiden betrieben. Sie wurde nach und nach durch die Rinderzucht ersetzt. Trotz der allgemeinen Beliebtheit von Schweinefleisch ist die Anzahl der gehaltenen Schweine im Berichtszeitraum
In Schlesien gab es in den 1860er Jahren noch über 80 Brauereien, die größte davon war die von Larisch in Karviná, aber 1923 gab es nur noch 15 Brauereien. Sie produzierten 180.321 hl Bier, davon 120.703 hl Schankbier, 47.846 hl Lagerbier und 11.729 hl Spezialbier. Das sind zwar nur 3,1 % des Volumens der Bierproduktion in Böhmen im selben Jahr, aber 9,5 mal mehr als in den russischen Vorkarpaten, wo eine einzige Brauerei für das ganze weniger bevölkerungsreiche, aber weitläufige Land ausreichte. Im Jahr 1900 gab es in Schlesien 91 Schnapsbrennereien, im Jahr 1923 waren es 68. Größere und modernere Schnapsbrennereien gab es nur in Opava und Třanovy. Im Jahr 1900 gab es in Schlesien 10 Zuckerfabriken, 1923 waren es nur noch fünf, die wichtigsten davon in Opava, Háj ve Slezsku, Skrochovice, Kateřinky und Vávrovice. Von den Molkereien waren die wichtigsten die zentralen Molkereien in Opava und Moravská Ostrava, die ihre Produkte hauptsächlich nach Schlesien lieferten. Im Jahr 1923 gab es in Schlesien drei Stärkefabriken, die hauptsächlich Kartoffeln in Opava verarbeiteten. Wichtige Verarbeitungsbetriebe waren auch eine Mälzerei in Český Těšín und eine Mosterei in Třebovice, die in den 1920er Jahren zu den modernsten in der Tschechoslowakei gehörte. Während der Umsetzung des ersten Bodenreformprogramms in den Jahren 1921-1922 hatte Schlesien die höchste relative Flächennutzung in der Tschechischen Republik - 30,1 % der Landfläche. Die Beschlagnahmung von großen Ländereien wurde behandelt. Die größten Besitzer von Grundstücken, die der Bodenreform unterlagen, waren Bedřich von Habsburg (Fürstentum Těšín und Frýdek) 64 332 ha, Larisch-Mönnich (Fryštát und Umgebung, Horní Těrlicko, Raduň, Studénka und umliegende Dörfer) 11 684 ha, Liechtenstein (Güter in Krnov und Opava) 9 648 ha, Wilczek (Dobroslavice und andere Güter in der Umgebung von Ostrava), Lichnowsky (Hradec n. Moravicí usw.). Die Reform zielte unter anderem auf die Stärkung des böhmischen Elements in den deutschen Gebieten ab und stieß daher in Schlesien auf Ablehnung. Obwohl die schlesische Landwirtschaft von der Wirtschaftskrise, dem Zweiten Weltkrieg und vor allem von der Nachkriegsvertreibung von drei Viertel der ursprünglichen, d.h. deutschen Einwohner betroffen war, hat sie in fast hundert Jahren einen weiten Weg von kleinen Bergfeldern zu einer leistungsfähigen modernen Landwirtschaft zurückgelegt.
6.9 Landwirtschaft 1948-1989
Ganz Schlesien, mit Ausnahme von Frýdek, ist bekannt für seine mehrheitlich nicht-tschechische Besiedlung wurde nach dem Münchner Abkommen im Oktober 1938 Teil des Großdeutschen Reiches. (Těšín bis Anfang September 1939 Teil von Polen). In den Jahren 1945-1947 erfolgte die Zwangsumsiedlung des überwiegenden Teiles der deutschen Bevölkerung. Ihr Eigentum wurde beschlagnahmt und dem Staat überlassen oder neuen Siedlern zugeteilt. Trotz des politischen Verständnisses des Umzuges bedeutete dieser den Verlust der Kontinuität in der Gemeindeentwicklung und der kulturellen Landschaft und den Verlust von spezifischem Wissen für die Landwirtschaft unter überwiegend rauen Bedingungen des Berglandes. Das Interesse der Siedler an Schlesien war gar nicht, oder nur im geringen Maß vorhanden. Viele Siedlungen, besonders im Gebirge sind verschwunden und zugewachsen oder wurden absichtlich in Wälder umgewandelt. Mit der Zeit wurden sie unbewohnbar, und nach Fotos und Kritik in der westlichen Presse ("sie vertrieben uns und jetzt verfällt alles") wurde angeordnet, dass die unbenutzten Gebäude von der Armee dem Erdboden gleichgemacht und durch meist monokulturelle Fichtenwälder ersetzt werden sollen.
Aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte und der großen Streuung der landwirtschaftlichen Flächen wurden im westlichen Teil Schlesiens auf großen Flächen Staatsbetriebe gegründet. Die größte Fläche von ihnen war die Staatsfarm Bruntál (74 586 ha), die aber in 15 Fabriken aufgeteilt war. Außerhalb davon befanden sich die größten StS Vítkov (12 328 ha), StS Karviná (9 344 ha) und andere. Der Prozess der Sozialisierung der Landwirtschaft wurde offiziell im Jahr 1960 abgeschlossen, als der sozialistische Sektor 92 % der landwirtschaftlichen Flächen in der Tschechoslowakei kontrollierte. Von den Genossenschaften waren die größten das JZD Litultovice (6 657 ha), das JZD Odry (4 629 ha). Im Vergleich zu 1948, als fast ein Drittel der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in der Landwirtschaft beschäftigt war, waren es 30 Jahre später nur noch 11 %. Private Bauernhöfe und typische Metallbetriebe sind jedoch fast vollständig verschwunden. Die am längsten funktionierenden Höfe waren die in den Beskiden.
Weitere wichtige landwirtschaftliche Betriebe außerhalb der Genossenschaften und StS waren die Staatliche Fischerei OZ Ostrava, die OSEVA, der Saatgutbetrieb Javorník, der Staatliche Zuchtbetrieb, das Gestüt Bolatice, die Schulbauernhöfe an der SZTŠ Český Těšín, SZEŠ Opava, SZTŠ Ostrava/Nová Ves usw.
Die Schaffung möglichst großer Bodeneinheiten vor allem in den Mittelgebirgs- und Bergregionen, verbunden mit der Ausdehnung von Ackerflächen auf Kosten von Grünland und Weiden, steht in direktem Zusammenhang mit der Zerstörung von verstreutem Feldgrün (Wiesen, kleine Feuchtgebiete) und damit einer leichteren Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen sowie massiver Wasser- und Winderosion, die nicht nur die LF, sondern auch angrenzende Flächen schädigt. Die starke Chemisierung hat Rückstände von giftigen Substanzen in den Nahrungsketten hinterlassen. Von 1937 bis 1989 stieg der Verbrauch von Industriedüngern um das Zwanzigfache und von Stickstoffdüngern um das Dreißigfache, mit negativen Auswirkungen auf die Wasser- und Bodenverhältnisse, die Kleinbodenfauna und die gemeine Feld- und Waldtierwelt.
Eingriffe in den Wasserhaushalt der Landschaft (Ausbaggern, Aufstauen von Bächen, meliorative Entwässerung) haben zu beschleunigtem Wasserabfluss, Austrocknung des Bodens und damit wiederum zu einer sich schneller ausbreitenden Hochwasserwelle geführt. Die Anbaumischung enthielt einen hohen Anteil an Mais, der eine starke Pestizidunterstützung benötigt, und umgekehrt einen geringen Anteil an Kleeuntersaaten und verbessernden Leguminosen, die mit Gülle gedüngt wurden.
Die noch immer nicht erreichte Selbstversorgung mit Grundnahrungsmitteln innerhalb des Ostblocks veranlasste die Umsetzung von Plänen, die zu einer Intensivierung der Landwirtschaft führen sollten, allerdings mit Nebenwirkungen. Das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung legte fest, welche Feldfrüchte in welchen Bezirken angebaut werden sollten, da sich die Mechanisierung und die Verarbeitungsanlagen auf wenige Gebiete konzentrierten. Dies führte zu multikatastrophalen Landwirtschaftsgenossenschaften mit einer normalen Entfernung von über 20 km zwischen den beiden Extrempunkten und Betrieben mit mindestens 500 Rindern, 5 000 Mastschweinen oder 120 000 Masthähnchen. Dies stellte hohe Anforderungen an leistungsfähige Ställe, Gruben und Strecken für die Verladung von Futter. Es muss jedoch zugegeben werden, dass die tschechoslowakische Landwirtschaft durch die Bereitstellung von Maschinen, die Züchtung resistenter Sorten und andere geeignete Maßnahmen in den 80er Jahren schließlich eine praktisch vollständige Selbstversorgung mit Grunderzeugnissen erreichte.
Landwirtschaftliche Tätigkeit, Úvalno, 1950. SOkA Bruntál

Klicken Sie auf das Bild um die Galerie zu öffnen..
Eine der unglücklichsten Auswirkungen der sozialistischen Landwirtschaft auf die Landschaft war die Verdrängung von Rekultivierung seit Anfang der 1980er Jahre. Die Bedingung war, dass für jeden Hektar Land, der dauerhaft entzogen wurde, 1-5 ha (je nach Eignung) vorübergehend unfruchtbares oder anderes Land wieder der Landwirtschaft zugeführt werden sollte. So wurde im Gesenke, in den Beskiden und ihren Ausläufern jahrelang nach unkultiviertem Land gesucht, das abschüssig, steinig, wassergesättigt und für die Landwirtschaft meist völlig ungeeignet war. Ihre Ausbeutung war sehr verschwenderisch und störte zudem meist die wertvolle natürliche Umgebung.
Nach etwas futuristischen Visionen sollte der Stadtteil Karviná sein Gesicht völlig verändern. Neben der Stadt Karviná selbst sollte bis 2030 auf dem verminten und völlig zugewachsenen Gelände eine neue Landschaft mit landwirtschaftlichen Flächen, die ohne schwere Maschinen bewirtschaftet werden, Waldparks und Wasserflächen entstehen.
Die sozialistische Landwirtschaft gewährleistete die Ernährungssicherheit für Schlesien, aber nicht die Lebensmittelsicherheit. Es kann konstatiert werden, dass sie ihre Ziele erreicht hat, aber auch, dass der Trend nicht fortgesetzt werden kann.

Eine der unglücklichsten Auswirkungen der sozialistischen Landwirtschaft auf die Landschaft war die Verdrängung von Rekultivierung seit Anfang der 1980er Jahre. Die Bedingung war, dass für jeden Hektar Land, der dauerhaft entzogen wurde, 1-5 ha (je nach Eignung) vorübergehend unfruchtbares oder anderes Land wieder der Landwirtschaft zugeführt werden sollte. So wurde im Gesenke, in den Beskiden und ihren Ausläufern jahrelang nach unkultiviertem Land gesucht, das abschüssig, steinig, wassergesättigt und für die Landwirtschaft meist völlig ungeeignet war. Ihre Ausbeutung war sehr verschwenderisch und störte zudem meist die wertvolle natürliche Umgebung.
Nach etwas futuristischen Visionen sollte der Stadtteil Karviná sein Gesicht völlig verändern. Neben der Stadt Karviná selbst sollte bis 2030 auf dem verminten und völlig zugewachsenen Gelände eine neue Landschaft mit landwirtschaftlichen Flächen, die ohne schwere Maschinen bewirtschaftet werden, Waldparks und Wasserflächen entstehen.
Die sozialistische Landwirtschaft gewährleistete die Ernährungssicherheit für Schlesien, aber nicht die Lebensmittelsicherheit. Es kann konstatiert werden, dass sie ihre Ziele erreicht hat, aber auch, dass der Trend nicht fortgesetzt werden kann.
6.10 Landwirtschaft 1990-2020
Die Rückkehr zur Marktwirtschaft bedeutete erhebliche Veränderungen in der landwirtschaftlichen Produktion. Die Exporte in die meisten ehemals sozialistischen Länder fielen relativ schnell wegen Zahlungsunfähigkeit aus, während die westeuropäischen Länder mit Überschüssen zu kämpfen hatten.
Die Größenstruktur der Unternehmen ist innerhalb der Region sehr unterschiedlich. Während im Bezirk Frýdek-Místek (wo es fast keine deutsche Auswanderung gab) eine beträchtliche Anzahl kleinerer Landwirte bis zu 10 ha und im Bereich von 10 bis 50 ha zu finden ist und die durchschnittliche Betriebsgröße 54 ha beträgt, überwiegen im Bezirk Bruntál Großbetriebe mit einer durchschnittlichen Fläche von 274 ha. Im Bezirk Bruntál gibt es nur 111 Landwirte unter 50 ha, während es im Bezirk Frýdek-Místek 548 Landwirte gibt. Die Größenstruktur der landwirtschaftlichen Betriebe in den Bezirken Jeseník, Opava und Nový Jičín liegt zwischen diesen Werten.
Änderungen in der landwirtschaftlichen Beschäftigung. Einige Merkmale des tschechischen Agrarsektors liegen nahe am EU-Durchschnitt, wie z. B. der Anteil der Beschäftigten im primären Sektor der Wirtschaft. In den 90er Jahren ging der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten deutlich zurück und lag lange Zeit bei etwa 3 %. Auch der Anteil der Landwirtschaft an der Bruttowertschöpfung der Region fiel in diesem Zeitraum von 2,7 % auf 2,1 %.
Der Niedergang der Berglandwirtschaft. Infolge des Drucks auf die Rentabilität der Landwirtschaft ging in der ersten Hälfte der 90er Jahre die Bewirtschaftung in landwirtschaftlich weniger geeigneten Gebieten deutlich zurück, was auch für mehr als die Hälfte Schlesiens gilt (siehe LFA-Karte). Im Vorgebirge, in Hanglagen und vor allem in größeren Entfernungen zu Verwaltungszentren und damit Erwerbsquellen wurde Ackerland in Dauergrünland umgewandelt, u.a. zum Schutz vor Erosion. Aus den gleichen Gründen, aber auch aus Gründen der geringen Effizienz, werden auch in diesen Gebieten Flächen von LF in Waldflächen umgewandelt.
Suburbanisierung und andere Beeinträchtigungen rund um größere Städte. Seit Mitte der 1990er Jahre wurden in erheblichem Umfang, aber im Grunde während des gesamten Betrachtungszeitraumes, landwirtschaftliche Flächen für den Bau von Wohn- und Gewerbebetrieben sowie für Verkehrs- und technische Infrastruktur in Anspruch genommen. Die Lockerung der (wie oben beschrieben) sehr strengen Gesetzgebung zum Schutz des Bodenfonds bis Ende der 1980er Jahre ermöglichte einen starken Druck zur Bebauung im unbebauten Gebiet der Gemeinde. Dies gilt vor allem für den weiteren Bereich der gesamten Agglomeration Ostrava, sowie für alle größeren schlesischen Städte. Die Mährisch-Schlesische Region hat nach Prag den zweithöchsten Anteil an bebauter Fläche mit 2,2 % der Gesamtfläche.
Änderung der Struktur von Pflanzen und Viehbestand. Auch die Struktur der Anbauflächen hat sich verändert und basiert nicht mehr auf einem Plan zur Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln, sondern primär auf der Nachfrage des Marktes. Die Produktion von Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben ist zurückgegangen. Auf der anderen Seite ist die Produktion von Ölsaaten (hauptsächlich Raps) aufgrund der wachsenden Präferenz für Biokraftstoffe und Mais als Grundstoff für Biogasanlagen, als wichtigste Quelle für erneuerbare Energie in der Tschechischen Republik, gestiegen. In der Region Opava, der Anbau von Heilkräutern, insbesondere Kamille und Mutterkorn, hat seit einiger Zeit einen höheren Anteil am Anbau. In der Viehwirtschaft ist der Viehbestand (Rinder) deutlich gesunken, aber die Produktivität ist deutlich gestiegen. Die Fleisch- und Milchproduktion ist jedoch insgesamt zurückgegangen. Ein ähnlicher Rückgang ist auch bei der Aufzucht von Wasservögeln und Fischen auf Teichen zu verzeichnen.
Preise für Ackerland. Der niedrigste Durchschnittspreis in Schlesien ist im Katastergebiet von Ludvíkov pod Pradědem (Dorf Ludvíkov, Bezirk Bruntál) - 0,72 CZK /m2 . Jarkovice (Gemeinde Opava, Bezirk Opava). Der durchschnittliche Preis für landwirtschaftliche Flächen in der Mährisch-Schlesischen Region gemäß der Verordnung Nr. 287/2007 Slg. beträgt 4,04 CZK/m2, Umweltaspekte in der Landwirtschaft. Seit Beginn der 90er Jahre haben die Bemühungen, immer umweltfreundlicher zu werden, zu einem Rückgang des Einsatzes von Düngemitteln und Pestiziden sowie zu neuen Formen der Landwirtschaft geführt - der ökologischen Landwirtschaft und dem Agrotourismus, die hier dank der Hochgebirgsnatur Schlesiens gute Voraussetzungen haben.
Auch das System der Agrarsubventionen hat sich verändert. Bevorzugt werden nicht-produktive und ökologische Funktionen der Landwirtschaft, wie z.B. Begrünung, biotechnische Erosionsschutz- und Selbstkorrekturmaßnahmen, Erhöhung der ökologischen Stabilität, Ökosystemleistungen usw.
Bodenverwaltung und andere Einflüsse der Landwirtschaft auf die Landschaft. Ein bedeutendes, meist sichtbares Phänomen der neuen Landschaftspflege ist derzeit die Bodenverbesserung, die einer der Schlüsselfaktoren der zeitgenössischen ländlichen Entwicklung ist. Heute geht es bei weitem nicht mehr nur um die Klärung von Landbesitzverhältnissen, sondern vor allem um das Straßennetz, Revitalisierung, Erosions- und Überschwemmungsschutz, Ökologisierung und ästhetische Maßnahmen in der Landschaft.
Umgekehrt wurde in den 1990er Jahren aus Gründen der Aufrechterhaltung eines optimalen Wasserhaushaltes in der Landschaft und zunehmender Trockenheit so gut wie keine Entwässerung durchgeführt, was seit den 1970er und 1980er Jahren allmählich nachgeholt wird. Trotzdem wurden im Jahr 2000 83 378,84 ha entwässerte Flächen registriert, was 29,18 % der Fläche der LF der Region ausmachte, 4 % mehr als im ganzen Land. Auf der anderen Seite wurden zum gleichen Zeitpunkt nur 684,66 ha Bewässerungsfläche registriert, d.h. 0,24% der LF der Region, was deutlich unter dem nationalen Durchschnitt von 3,63% liegt. Der größte Anteil an entwässerten Flächen (38 %) befindet sich in der Region Novojičínsko, während der größte Anteil an bewässerten Flächen in der Region Opava liegt.
Fazit. In letzter Zeit wurden die Bodenbewirtschaftungspraktiken verbessert, um Erosion und den Verlust der Artenvielfalt zu verhindern und die Wasserrückhaltung in der Landschaft zu verbessern. Trockenheit und Wetterschwankungen werden auch in Schlesien zu einem großen Problem. Die Unterstützung der EU für die Kreislaufwirtschaft und Umweltmaßnahmen sind in dieser Hinsicht positiv.was den 9. höchsten Wert unter den Regionen der Tschechischen Republik darstellt.
Auch das System der Agrarsubventionen hat sich verändert. Bevorzugt werden nicht-produktive und ökologische Funktionen der Landwirtschaft, wie z.B. Begrünung, biotechnische Erosionsschutz- und Selbstkorrekturmaßnahmen, Erhöhung der ökologischen Stabilität, Ökosystemleistungen usw.
Bodenverwaltung und andere Einflüsse der Landwirtschaft auf die Landschaft. Ein bedeutendes, meist sichtbares Phänomen der neuen Landschaftspflege ist derzeit die Bodenverbesserung, die einer der Schlüsselfaktoren der zeitgenössischen ländlichen Entwicklung ist. Heute geht es bei weitem nicht mehr nur um die Klärung von Landbesitzverhältnissen, sondern vor allem um das Straßennetz, Revitalisierung, Erosions- und Überschwemmungsschutz, Ökologisierung und ästhetische Maßnahmen in der Landschaft.
Umgekehrt wurde in den 1990er Jahren aus Gründen der Aufrechterhaltung eines optimalen Wasserhaushaltes in der Landschaft und zunehmender Trockenheit so gut wie keine Entwässerung durchgeführt, was seit den 1970er und 1980er Jahren allmählich nachgeholt wird. Trotzdem wurden im Jahr 2000 83 378,84 ha entwässerte Flächen registriert, was 29,18 % der Fläche der LF der Region ausmachte, 4 % mehr als im ganzen Land. Auf der anderen Seite wurden zum gleichen Zeitpunkt nur 684,66 ha Bewässerungsfläche registriert, d.h. 0,24% der LF der Region, was deutlich unter dem nationalen Durchschnitt von 3,63% liegt. Der größte Anteil an entwässerten Flächen (38 %) befindet sich in der Region Novojičínsko, während der größte Anteil an bewässerten Flächen in der Region Opava liegt.
Fazit. In letzter Zeit wurden die Bodenbewirtschaftungspraktiken verbessert, um Erosion und den Verlust der Artenvielfalt zu verhindern und die Wasserrückhaltung in der Landschaft zu verbessern. Trockenheit und Wetterschwankungen werden auch in Schlesien zu einem großen Problem. Die Unterstützung der EU für die Kreislaufwirtschaft und Umweltmaßnahmen sind in dieser Hinsicht positiv.was den 9. höchsten Wert unter den Regionen der Tschechischen Republik darstellt.
6.11 Voraussetzungen für die Entwicklung der Industrie bis 1848
Sowohl beim westlichen als auch beim östlichen Teil von Österreichisch-Schlesien haben wir es mit einer stark gebirgigen und bis heute stark bewaldeten Region zu tun, aus deren gebirgigem Charakter nur das gebirgige bzw. sanft gewellte Ostrauer Becken, das die beiden Teile trennt, herausragt. Es waren die natürlichen Gegebenheiten, die die wirtschaftliche Entwicklung der Region weitgehend bestimmten, die zudem, ob als Teil von "Groß"-Schlesien oder nach 1742 als neu geschaffenes Kronland, an der Peripherie der wirtschaftlichen Strukturen des Habsburger Reiches lag.
Das bis dahin vorherrschende System des Einkaufes, das aus einem "privilegierten", d.h. von der Obrigkeit vertraglich eingeräumten Recht der Kaufleute bestand, Garn und Tuch von den Untertanen zu kaufen, nahm allmählich eine anspruchsvollere Form der Ladung an, bei der der Kaufmann nicht nur die fertige Ware kaufte, sondern auch den Hersteller mit Rohmaterial "belud" und dann die fertige Ware zu vorher festgelegten Bedingungen abnahm. Echte" Leinenmanufakturen sind in Österreichisch-Schlesien jedoch nur sporadisch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein zu finden. Textilunternehmer wie auch Primärproduzenten bevorzugten weiterhin das wirtschaftlichere Frachtsystem und errichteten nur bei technologisch anspruchsvolleren Produktionsschritten wie Veredelung, Bleichen oder Färben Manufakturen, vor allem zentralisierte. Infolge der neuen Rohstoffbasis und der Konzentration der Veredelungsarbeiten entstanden jedoch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts Zentren der Leinenindustrie wie Andělská Hora, Bruntál, Frývaldov, Vrbno pod Pradědem, Zlaté Hory und Frýdek, von denen einige in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu modernen Zentren der Leinen- und im Fall von Frýdek auch der Baumwollindustrie wurden. Bei den Wollstoffen hingegen, die im Gegensatz zum Leinen hauptsächlich in den Städten produziert wurden, gewannen die zentralisierten Manufakturen schon früher an Bedeutung und begannen gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Produkte der Zunftmeister zu verdrängen. Im Zusammenhang mit diesem Prozess entstanden Industriezentren wie Těšín, Opava, Bílovec, Odry und Horní Benešov. Im Laufe des 19. Jahrhunderts begannen die Städte an Bedeutung zu gewinnen. Krnov und vor allem Bílsko zusammen mit der benachbarten galizischen Region Bělá nach Brünn und Liberec an dritter Stelle in Bezug auf Umfang und Wert der Wollstoffproduktion in der Habsburgermonarchie stand.
Die traditionelle Erzverarbeitung in Österreichisch-Schlesien kann man neben Textilindustrie einordnen. Als sich der erneute Abbau von Edelmetallen, insbesondere von Gold, Mitte des 18. Jahrhunderts in den meisten Fällen als unrentabel erwies, richteten staatliche und private Prospektoren ihre Aufmerksamkeit auf neue Eisenerzvorkommen. Obwohl die Qualität der Hämatite in Jeseniky und den Beskiden nicht hoch war, wurden in der zweiten Hälfte des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts sowohl im westlichen als auch im östlichen Teil des Landes eine Reihe von Eisenerzgruben und Waldeisenhütten eröffnet. Das Hauptzentrum der Eisenmetallurgie im Jeseníker Eisenhüttengebiet war Bruntál, wo das Bistum Wrocław (Železná in Vrbno pod Pradědem), der Deutsche Ritterorden (Malá Morávka, Ludvíkov, Karlova Studánka) und einige andere Unternehmer ihre Eisenhütten betrieben. Im Eisenhüttengebiet, das sich in den Ausläufern der mährisch-schlesischen Beskiden erstreckte, etablierte sich im schlesischen Teil die Fürstliche Kammer von Teschen (Ustroň, Baška, Lískovec, Třinec), im mährischen Teil das Erzbistum Olmütz (Frýdlant nad Ostravicí, Čeladná). Wie die vorstehende Aufzählung zeigt, konzentrierte sich die gesamte metallurgische Produktion in der Nähe von Erzlagerstätten in den dicht bewaldeten Berg- und Vorgebirgsregionen des Landes, die, wie die Hüttenexperten der damaligen Zeit glaubten, unerschöpfliche Brennstoffvorräte boten.
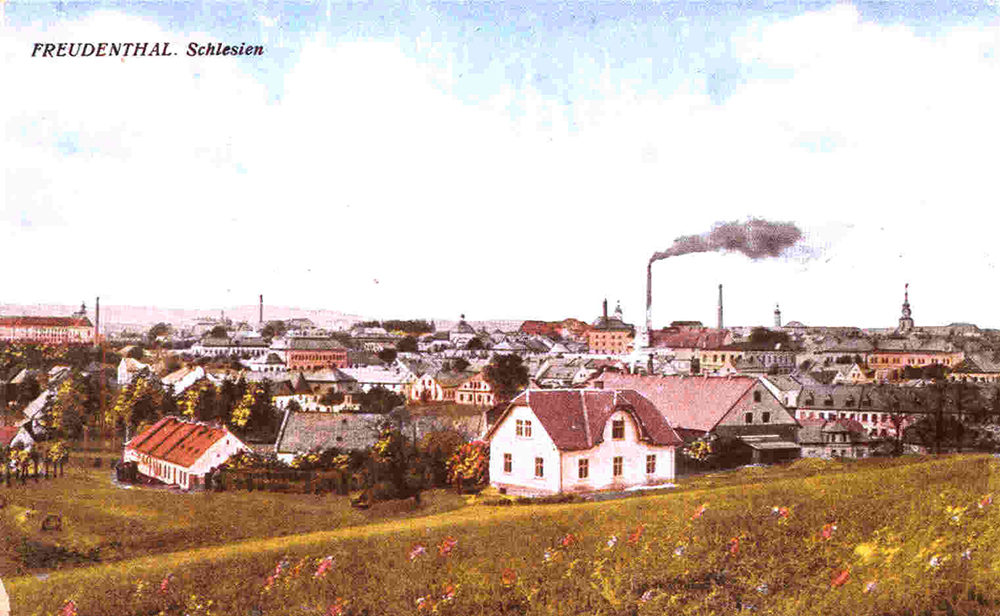
Technologische Revolution der Eisenindustrie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Von der Revolution der Eisenindustrie in Westeuropa, einschließlich des preußischen Teils Schlesiens, die vor allem durch den Übergang zur Verhüttung von Kohle mit Koks gekennzeichnet war, blieb die Eisenindustrie von Österreichisch-Schlesien im Wesentlichen unberührt, abgesehen von dem nicht realisierten Projekt des schottischen Hüttenunternehmers John Baildon, der 1809 den Bau eines Kupfer- und Walzwerks an einem der Flüsse vorschlug, die durch den zukünftigen Bezirk Ostrava-Karviná fließen, musste die Habsburger Monarchie bis 1828 warten, um ihr erstes Eisenwerk auf der Basis von mineralischen Brennstoffen zu errichten, als beschlossen wurde, die sogenannte "Eisenhütte der Tschechischen Republik" zu bauen. Rudolfs Hütte in Vítkovice. Ähnlich gelegen wie die Eisenhütten, d.h. in der Nähe von Bodenschätzen, vor allem Holz, befanden sich die zahlreichen Glashütten und Büttenpapierfabriken.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Österreichisch-Schlesien mehrere proindustrielle Inseln entwickelt haben, die vor allem auf die sich dynamisch entwickelnde Textilindustrie (Bílsko, Krnov, Opava, Bílovec) und die Eisenindustrie (Ustroň, Třinec) oder beides gleichzeitig (Frývald, Bruntál, Frýdek) ausgerichtet waren.
6.12 Industrielle Entwicklung zwischen 1848 und 1945
In Bezug auf die Branchenstruktur und die geografische Lage der Hauptindustrien markierte sie für Österreichisch-Schlesien in der Mitte des 19. Jahrhunderts einen wichtigen Wendepunkt. Der erste moderne Puddelofen in Vítkovice im Jahre 1830 und die darauf folgende massive Expansion der Eisenindustrie in Ostrava können als ein Schlüsselmoment angesehen werden. Ein weiterer bedeutender Impuls für die industrielle Entwicklung der Region, insbesondere jenes Teiles, den wir heute als Kern des Ostrauer Industriegebiets bezeichnen, war zweifellos die Gründung der Aktiengesellschaft der exklusiv privilegierten Kaiser Ferdinand Nordbahn im Jahr 1836. Der Bau der Eisenbahn von Wien nach Galizien erforderte immer mehr Eisenbahnmaterial, was die Entwicklung des Vítkovicer Eisenkomplexes beschleunigte.
Neben den Wiener und Brünner Industriegebieten wurden auch die nach 1848 gegründeten mährischen Zuckerfabriken zu wichtigen Abnehmern der Kohle aus dem Kreis Ostrava-Karviná. entlang der Hauptstrecke der Nordbahn. Nach dem Abklingen der revolutionären Ereignisse in Ungarn wurde 1850 auch die Verbindung nach Pest dauerhaft eröffnet, obwohl die Privatisierung der Staatsbahn Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts und die anschließenden Streitigkeiten über den Bau neuer Verbindungen mit Niederungarn und weiter nach Südosten die Situation für zehn Jahrem erschwerten. In den Jahren 1866-1872 wurde die transversale Košice-Bohumín-Eisenbahn zum Rückgrat der Kaiser Ferdinand Nordbahn, die nicht nur in Österreichisch-Schlesien, sondern auch in Mähren, Niederösterreich und Westgalizien zur Lebensader der Wirtschaft wurde, die Verbindungen mit Oberungarn eröffnete und den Import des dringend benötigten Eisenerzes für die hiesigen Eisenwerke ermöglichte. Das Eisenbahnnetz wurde weiter durch den Bau des Anschlussgleises der Nordbahn, die Tätigkeit neuer Eisenbahnträger, den Bau eines Netzes von Bergbaubahnen in der Region Ostrava-Karviná und die Eröffnung einer Reihe von lokalen und städtischen Verbindungen verdichtet. Dank dieser Schritte entstanden wichtige Eisenbahnknotenpunkte, wie z.B. Svinov, Přívoz, aber vor allem Bohumín, wo die Eisenbahnlinien der wichtigsten Verkehrsträger, d.h. die Kaiser Ferdinand Nordbahn, die Košice-Bohumín-Eisenbahn und durch die Vilém-Bahn die preußische Oberschlesische Eisenbahn, verbunden wurden.
Die moderne Verkehrsinfrastruktur, der Reichtum an Brennstoffen, metallurgischen Halbfabrikaten und anderen Produkten der Bergbau- und Hüttenindustrie zogen weitere Investoren in das Zentrum des Ostrauer Industriegebietes, das begann, einen entscheidenden Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten von Österreichisch-Schlesien und Nordmähren zu konzentrieren. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden entlang der Verkehrsadern und vor allem in der Nähe der pulsierenden Eisenbahnknotenpunkte neue Industriezentren. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden weitere Industriebetriebe und neue Industrien, die direkt mit der dominierenden Bergbau- und Hüttenprimärproduktion zusammenhingen (Mettalindustrie, Maschinenbau, Chemie), gute Transportmöglichkeiten nutzten (Chemie, Papierherstellung), auf den Bedarf der expandierenden Industrieagglomeration reagierten (Baustoffe, Brauerei, Brennerei) oder die oben genannten Trends in geeigneter Weise kombinierten.
Aber es war nicht nur das Zentrum selbst. Für Investoren wurden auch andere Standorte in der Nähe der Eisenbahnlinien interessant, was zur Entstehung kleinerer Industriezentren führte, die die Nähe des Ballungsraumes Ostrava nutzten, aber gleichzeitig von den Vorteilen weiter entfernter Standorte profitierten (billigere Grundstücke und Arbeitskräfte, Absatzmöglichkeiten usw.). In einer solchen spezifischen Lage befand sich z. B. der große industriell-landwirtschaftliche Komplex der Kammer Knížecí těšínská, der an die ältere Tradition der Hütten- und Eisenwerkbetriebe im Vorgebirge der Beskiden anknüpfte. Mit der Änderung der Brennstoffbasis der mitteleuropäischen Eisenindustrie, die sich in der Mitte des Jahrhunderts endgültig vollzog, mussten sie sich jedoch auch erheblich modernisieren und mit der Verwendung von Steinkohle aus den eigenen Gruben im Bezirk Ostrava-Karviná beginnen, was wegen der Entfernung nicht in größerem Umfang möglich gewesen wäre, wenn nicht Anfang der 1870er Jahre die Eisenbahn Košice-Bohumín und die Eisenbahn Ostrava-Frýdlant in Betrieb genommen worden wären. Dank dieser "Verkürzung der Wege" konnten sich metallverarbeitende und maschinenbauliche Betriebe in Branka u Opavy, Frýdlant nad Ostravicí, Kopřivnice oder Studénka entwickeln, während einige Hersteller aus dem weiter entfernten Frývald oder Bruntál gezwungen waren, u.a. in Tschechien zu arbeiten. Aufgrund der hohen Transportkosten musste die Produktion eingestellt, die Produktpalette deutlich modifiziert oder näher an die Bergwerke und Hütten verlagert werden, wie die Errichtung von Drahtwerken in Bohumín oder Zinkblechwalzwerken in Přívoz zeigt.
Es ist nicht so, dass die traditionellen Textilzentren völlig stagnierten; auch sie entwickelten sich allmählich und transformierten ihre Produktion, aber sie konnten mit dem Industriegebiet Ostrava nicht konkurrieren, was den Umfang und den Wert der Produktion betrifft. Während in der ersten Phase der Industrialisierung die Textilindustrie in Österreichisch-Schlesien eine privilegierte Stellung einnahm und Anfang der 1840er Jahre fast 70 % des Bruttowertes der Industrieproduktion des Landes ausmachte, begann dieses Verhältnis ab den 1860er Jahren, wie schon während der gesamten Monarchie, zugunsten der Schwerindustrie zu sinken, bis die Zahlen vor dem Ersten Weltkrieg unter 20 % fielen. Der wichtigste Sektor der Textilindustrie war angesichts der Mechanisierung der Produktion die Wollindustrie, gefolgt von der Leinen- und Baumwollindustrie. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt Bílsko zum wichtigsten Zentrum der Textilindustrie in Österreichisch-Schlesien und gleichzeitig zu einem "eigenständigen" Industriegebiet, das zusammen mit der benachbarten galizischen Stadt Bělá einen industriellen Ballungsraum bildete, der sich auf die Wollproduktion, die Herstellung von Textilmaschinen und -geräten, aber auch z. B. die Papierherstellung spezialisierte. Die Stadt Krnov, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Rolle des Führers der Wollindustrie im westlichen Teil des Landes übernahm, hatte ein ähnliches Profil, aber nicht in demselben Ausmaß. Andererseits wurden die Städte Frývaldov und Bruntál zu den größten Leinenzentren, während sich die Baumwollproduktion vor allem in Frýdek und der benachbarten mährischen Stadt Místek entwickelte.
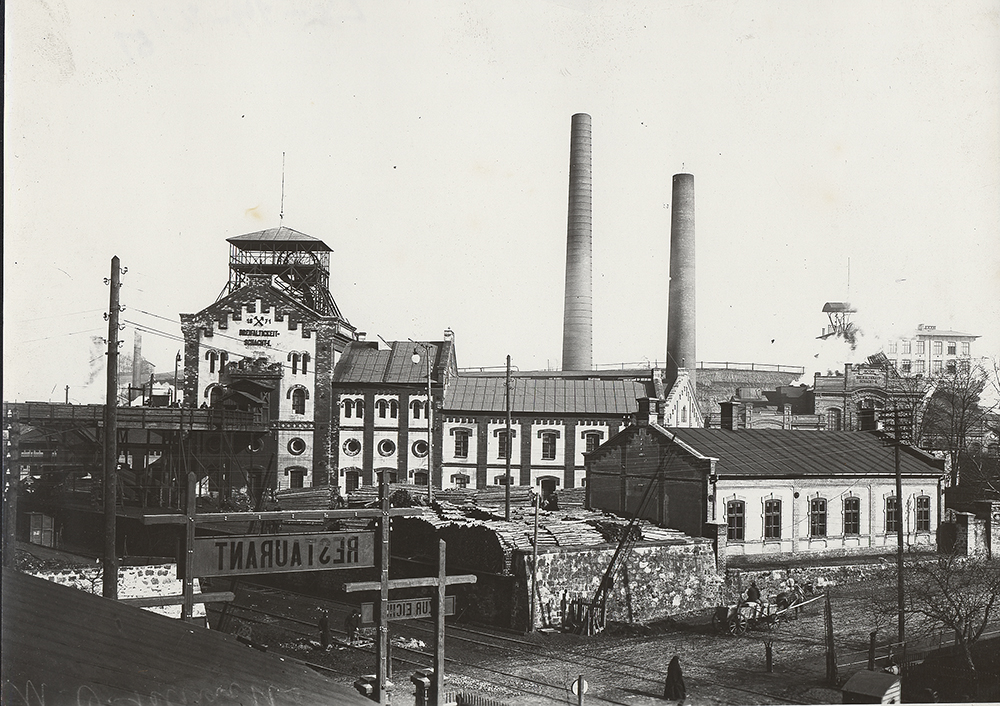
Auch die schlesische Landwirtschaft erlebte einen grundlegenden Wandel, denn sie blieb tief im 19. Jahrhundert stecken. Sie suchte nach einem Weg, mit den geomorphologischen und klimatischen Nachteilen fertig zu werden und das Volumen und den Wert der Produktion zu steigern, während sie mit der fortschreitenden Industrialisierung und dem demographischen Wachstum gezwungen war, ihre Produktionspräferenzen zu ändern und begann, sich fast ausschließlich auf die Belieferung von Industriezentren (Fleisch, Milch, Holz, usw.) oder der Lebensmittelindustrie (Zuckerfabriken, Brennereien, Brauereien, Mühlen) zu konzentrieren. Trotz dieser strukturellen Veränderungen war Österreichisch-Schlesien lange Zeit abhängig von der Einfuhr von Lebensmitteln aus dem preußischen Teil Schlesiens, Mährens, Ungarns und Galiziens, vor allem von Getreide, Kartoffeln und Vieh, was aber vor allem auf die technologischen Möglichkeiten der Konservierung der transportierten Waren zurückzuführen war. Die Transformation des Landes von einem agrarischen in ein agroindustrielles Land führte auch zu einer immer schnelleren Entvölkerung der schlesischen Landschaft, vor allem in den unfruchtbaren Regionen.
Die wirtschaftliche Transformation, die Österreichisch-Schlesien und der sog. Mährische Keil vor allem im Laufe des langen 19. Jahrhunderts durchliefen, hatte natürlich einen bedeutenden Einfluss auf die Transformation der sozioprofessionellen Strukturen, die einer der Schlüsselindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft sind. Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich Österreichisch-Schlesien zu einem der am stärksten industrialisierten Länder der österreichisch-ungarischen Monarchie entwickelt. Nur in Niederösterreich, mit Wien als Zentrum der Monarchie, überstieg der Anteil des sekundären Sektors 1890 den des primären Sektors, während der tertiäre Sektor ebenfalls deutlich höher lag. Nach diesem Indikator folgten zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits die Kleinregion Vorarlberg (40,3%) und Schlesien (38%), gefolgt von Böhmen (36,6%). Und es waren diese drei Länder, die sich schon vor dem Ersten Weltkrieg in die Reihe der Niederösterreicher einreihten, indem sie ihren agrarischen Charakter änderten und industriell-agrarisch wurden, mit einem höheren Anteil des sekundären Sektors als des Primärsektors.
Nach dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie und der Gründung der unabhängigen Tschechoslowakei setzte sich die massive Industrialisierung fort. Zwar änderte sich die Zusammensetzung des investierten Kapitals etwas, indem französische und tschechische Investoren auf Kosten von österreichischem (Wiener) und reichsdeutschem Kapital in industrielle Schlüsselbereiche wie Hüttenwesen, Bergbau, Koksproduktion, Schwermaschinenbau und Schwerchemie eindrangen, aber die Branchenstruktur blieb unverändert, wurde nur weiter ausgebaut und modernisiert.
6.13 Industrielle Entwicklung nach 1945
Nach dem Zweiten Weltkrieg spielten die Schwerindustrie und der Bergbau eine wichtige Rolle in der Wirtschaft von Tschechisch-Schlesien. Der Kohlebergbau und die Produktion von Roheisen, Stahl, schweren Maschinenbauerzeugnissen, Petrochemie usw. konzentrierten sich vor allem im Bezirk Ostrava-Karviná (Ostrava, Karviná, Orlová, Petřvald) und im östlichen Teil des Landes (Třinec, Frýdek-Místek, Bohumín). Im westlichen Teil von Tschechisch-Schlesien dominierte dagegen weiterhin die Textilindustrie (Jeseník, Bruntál, Krnov, Bílovec), obwohl der Abbau von Erzen, Granit, Schiefer und anderen Mineralien, die Maschinenbauproduktion (Opava, Branka u Opavy, Česká Ves, Malá Morávka) usw. ebenfalls stark vertreten waren. Der Umfang dieser Aktivitäten war jedoch viel geringer als im östlichen Teil des Landes. Frýdek-Místek in Schlesien und Mähren war auch ein wichtiges Zentrum der Textilindustrie.
Eines der Großprojekte, mit dessen Umsetzung bereits 1942 begonnen wurde, das aber vor allem in den letzten Kriegsjahren im Zusammenhang mit den alliierten Bombenangriffen auf die westlichen Gebiete des Dritten Reiches eine bedeutende Priorität erhielt, war der Bau des sog. Südwerks in Kunčice, das ursprünglich als Nebenwerk des nahegelegenen Eisenwerks in Mährisch Vítkovice geplant war. Nach Kriegsende wurde es als eigenständiger Komplex mit kompletter Eisenproduktion fertiggestellt, 1952 von der Witkowitzer Eisenwerke getrennt und zu Ehren des damaligen tschechoslowakischen Präsidenten Klement Gottwald Nová hut' genannt.
Schon bald nach Kriegsende war klar, dass die Schwer- und Bergbauindustrie weiterhin eine entscheidende Rolle im Wirtschaftsleben Tschechisch-Schlesiens spielen würde. Vor allem die Bemühungen um den Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Volkswirtschaft mit den sich vertiefenden Spannungen zwischen dem volksdemokratischen "Osten" und dem kapitalistischen "Westen", aber zunehmend auch die wachsende Rüstungsproduktion erforderten eine verstärkte Produktion von Kohle, Roheisen, Stahl, Schwermaschinenbauprodukten, Petrochemie und anderen Industriezweigen, die im östlichen Teil von Tschechisch-Schlesien und Ostrava stark vertreten waren.
Ein bedeutendes Moment, das die Tätigkeit strategischer Sektoren der Volkswirtschaft für vierzig Jahre beeinflusste, war die Verkündung der Verordnung des Präsidenten der Republik über die Verstaatlichung von Bergwerken und einigen Industriebetrieben Ende Oktober 1945, die alle wichtigen Unternehmen und Fabriken auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien betraf. Bereits im Frühjahr 1946 wurde durch einen Erlass des Industrieministers das Staatsunternehmen Ostrava-Karviná Kohlebergwerke Ostrava (ab 1950 Ostrava-Karviná Kohlebergwerke, Staatsbetrieb) gegründet, das Kohlebergwerke, Kokereien, Kraftwerke, Baufirmen, Ländereien und Wälder umfasste, die bis dahin vor allem privaten Bergleuten und Aktiengesellschaften gehörten. Als die alten Kohlereviere allmählich erschöpft waren und der Bergbau immer teurer wurde, wurden neue Aufschlüsse im östlichen, Karviná-Teil des Reviers (ČSM-Grube) und in Richtung Frýdek-Místek (Paskov-Grube) gemacht. In der Hüttenindustrie spielte neben der bereits erwähnten Neuen Hütte von Klement Gottwald und Witkowitzer Eisenwerke der Hochofenkomplex der Hütte Třinec eine wichtige Rolle, und unter den Verarbeitungs- und Maschinenbauunternehmen die Hütte und das Drahtwerk Bohumín, das Blechwalzwerk Frýdek-Místek, Kovona Karviná und eine Reihe weiterer Betriebe. Auch dem Aufbau der chemischen Industrie wurde höchste Priorität eingeräumt. Im Jahr 1958 wurde das Staatsunternehmen Mährische Chemiewerke (MCHZ) gegründet, zu dem das Hauptwerk Dusikárny Ostrava und die Tochterunternehmen Hrušovské chemické závody in Hrušov gehörten, zu denen auch das Werk Petrovice, Ostravit Ostrava, Bohumínské chemické závody, Přerovské chemické závody und Fosfa Poštorná gehörten.

Im westlichen, überwiegend deutsch besiedelten Teil Schlesiens war die Situation noch komplizierter. Nach der Deportation der Deutschen blieben einige Gebiete völlig unbesiedelt und die Umgesiedelten, ob aus dem tschechischen Hinterland oder aus Osteuropa und dem Balkan, konnten das Arbeitskräftepotenzial nicht ersetzen. Besonders schwierig war die Situation in der traditionellen Textilindustrie der Region, die im Gegensatz zum Holzeinschlag oder Erzabbau mehr qualifizierte Arbeitskräfte benötigte. Die Textilfabriken im westlichsten Teil Tschechisch-Schlesiens in den Regionen Bruntál und Gesenke wurden Teil des Staatsbetriebes Moravolen, die Wolltextilfabriken in Krnov wurden im Staatsbetrieb Karnola konzentriert, der bekannte Bílovec-Hersteller von Kleinmetallwaren und Bekleidungszubehör MASSAG wurde in den Staatsbetrieb KOH-I-NOOR eingegliedert, die Odergummifabriken von Schneck & Kohnberger wurde Teil des Staatsbetriebes Optimit und konten so weiter funktionieren. Die Textilfabriken in Frýdek-Místek, dem wichtigsten Zentrum des östlichen Teiles von Tschechisch-Schlesien, wurden bald nach dem Krieg in den Staatsbetrieb der Baumwollmühlen zusammengelegt.
7. IDENTITÄT, ZUFRIEDENHEIT UND ORTE DER ERINNERUNG
INHALT DES KAPITELS
7.1 Historische Entwicklung der schlesischen Identität
Ph.Dr. Oľga Šrajerová, CSc. (SZM)
7.2 Vergleich von Teilbereichen auf Basis soziologischer Forschung
Ph.Dr. Oľga Šrajerová, CSc. (SZM)
7.3 Region Jesenicko
PhDr. Andrea Hrušková (ACC), doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC)
7.4 Region Opava
PhDr. Andrea Hrušková (ACC), doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC)
7.5 Region Hlučín
PhDr. Andrea Hrušková (ACC), doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC)
7.6 Die Region Těšín
PhDr. Andrea Hrušková (ACC), doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC)
7.7 Region Ostrava
PhDr. Andrea Hrušková (ACC), doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC)
7.8 Orte der Erinnerung
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (OU)
7.9 Verschwundene deutsche Erinnerung - Hans Kudlich (*1823 - †1917)
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (OU)
Ph.Dr. Oľga Šrajerová, CSc. (SZM)
7.2 Vergleich von Teilbereichen auf Basis soziologischer Forschung
Ph.Dr. Oľga Šrajerová, CSc. (SZM)
7.3 Region Jesenicko
PhDr. Andrea Hrušková (ACC), doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC)
7.4 Region Opava
PhDr. Andrea Hrušková (ACC), doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC)
7.5 Region Hlučín
PhDr. Andrea Hrušková (ACC), doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC)
7.6 Die Region Těšín
PhDr. Andrea Hrušková (ACC), doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC)
7.7 Region Ostrava
PhDr. Andrea Hrušková (ACC), doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (ACC)
7.8 Orte der Erinnerung
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (OU)
7.9 Verschwundene deutsche Erinnerung - Hans Kudlich (*1823 - †1917)
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (OU)
7.1 Historische Entwicklung der schlesischen Identität
Die schlesische Identität ist an ein bestimmtes Gebiet in der Region Schlesien gebunden, in dem sie tief verwurzelt ist. Sie wurde von den Menschen, die dort seit Jahrhunderten leben, geprägt. Sie wird nicht nur durch die Identifikation der Menschen mit diesem Territorium geprägt, sondern auch durch das gemeinsame kollektive Gedächtnis, die Identifikation mit der Kultur, den Traditionen, den gemeinsamen Werten und den Verhaltensmustern mit der Gesellschaft der dort lebenden Menschen.
Schlesien als spezifisches Gebiet war in der Geschichte ein dynamisches Gebilde bzw. ein Übergangsgebilde, das in der Entwicklung der Geschichte der böhmischen Länder nie zu einem bedeutenderen Thema wurde. Es war vor allem ein Objekt des Interesses für benachbarte und weiter entfernte Staatsgebilde und Vertreter verschiedener ethnischer Gruppen. Es hatte keine einfache und geradlinige historische Entwicklung, mit aufeinanderfolgenden Herrscherfamilien, Kämpfen um dieses strategisch und wirtschaftlich wichtige Gebiet, Veränderungen in der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung und sehr bedeutenden Veränderungen in der wirtschaftlichen Zusammensetzung der Region. Es war eine Region, die durch eine gemeinsame öffentliche Verwaltung, aber vor allem durch das Gefühl der Zugehörigkeit zu dem Gebiet, in dem die Menschen lebten, geeint war.
Der Frieden von Berlin 1742 beendete den Ersten Schlesischen Krieg für die Habsburgermonarchie erfolglos. Das historische Territorium Schlesiens wurde zwischen Österreich und Preußen aufgeteilt, wobei den Habsburgern etwa ein Zehntel des Territoriums verblieb, das sich auf Teilen des historischen Territoriums der Fürstentümer Nisza, Krnov, Opava, Teschen und der Stände von Bílsko befand. Aus diesem Teil Schlesiens entstand die selbständige habsburgische Provinz Österreichisch-Schlesien, mit deren Verwaltung das Königliche Amt in Opava betraut wurde.
Schlesien existierte als Land innerhalb der Habsburger Monarchie bis 1782, als es verwaltungstechnisch mit Mähren zum sogenannten Mährisch-Schlesischen Statthalteramt vereinigt wurde. Im Jahr 1849 wurde Österreichisch-Schlesien den anderen Kronländern gleichgestellt und für seine Verwaltung wurde in Opava ein Gubernium (politische Verwaltung) eingerichtet. Mit dem Fortschreiten des Bach Absolutismus wurde die Statthalterei in Opava abgeschafft und die schlesische Landesregierung in Opava gegründet. Dieser Zustand dauerte bis zum Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahr 1918, als Österreichisch-Schlesien Teil der neu gegründeten Tschechoslowakischen Republik wurde. Schlesien bestand als Verwaltungseinheit und es entwickelten sich Elemente der schlesischen Identität der verschiedenen dort lebenden Nationalitäten. Die schlesische Identität entstand aus dem Lokalpatriotismus mit einer starken historischen und kulturellen Färbung. Es gab eine Reihe von Organisationen und Institutionen, die auf seine Entwicklung abzielten, z.B. die Opava- Matice (1877) in Opava und die Schlesische Matice der Volksbildung (1888), die in der Region Těšín tätig war. Beide Organisationen widmeten sich der Entwicklung von Bildungs-, Kultur-, Erziehungs- und Sozialaktivitäten.
Im Jahr 1928 wurde Schlesien mit Mähren zum Mährisch-Schlesischen Land mit Sitz in Brünn zusammengeschlossen, was das Ende der schlesischen Autonomie bedeutete, denn die frühere Form des Schlesischen Landes wurde nie wiederhergestellt, obwohl das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu dieser Region bei allen in Schlesien lebenden Nationalitäten noch sehr stark war.
Eine neue Situation in Bezug auf die Existenz der schlesischen Identität entstand nach 1945 und besonders nach 1948. Die komplizierten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse in der Grenzregion in der Nachkriegszeit beeinflussten die Identifikation der Bevölkerung mit der Region. Das gesamte Gebiet von Tschechisch-Schlesien wurde durch den Krieg schwer getroffen. Auch die ethnische Situation änderte sich radikal, denn nach der Vertreibung der deutschen Bevölkerung kamen neue Einwohner, die Schlesien besiedelten. Sie kamen zum einen aus dem Zentrum der böhmischen Länder und zum anderen aus der Slowakei. Es gab auch zurückkehrende Auswanderer aus dem Ausland und neue Siedler, die keine feste Bindung an die Region hatten. In den Jahren 1945-1947 entwickelte sich die schlesische Identität der einheimischen Bevölkerung noch recht erfolgreich. In Prag war das Schlesische Kulturinstitut tätig, die Aktivitäten der Matice Opava und der Schlesischen Matice der Volksbildung in der Region Těšín wurden wiederhergestellt und die Schlesische Studienbibliothek in Opava wurde gegründet.
Elemente des Schlesiertums entwickelten sich auch auf dem Gelände des Schlesischen Museums (1814) oder des Schlesischen Nationaltheaters in Opava. Schlesien wurde jedoch als Anachronismus empfunden. Territoriale Verwaltungsänderungen in den Jahren 1949 und 1960 teilten das schlesische Gebiet in Regionen und Bezirke auf und ließen den Begriff "schlesisch" aus dem Namen der Region verschwinden. Die schlesischen Institutionen mit lokalem Charakter wurden ebenfalls abgeschafft. Nach dem Februar 1948 wurde die Schlesische Volksbildung aufgelöst und die Matice Opava wurde mit dem Schlesischen Studieninstitut in Opava zusammengelegt. Das Schlesische Institut in Prag war die längste Zeit bis Anfang der 1950er Jahre aktiv. Bis 1968 gab es nur zwei Überbleibsel der schlesischen Idee - das Schlesische Institut in Opava (seit 1958 Teil der Akademie der Wissenschaften) und das Schlesische Museum ebenfalls in Opava. Schlesien wurde allenfalls im Rahmen der regionalgeschichtlichen Forschung oder im Umfang einer harmlosen Folklore berücksichtigt. Die schlesische Regionalidentität ist jedoch nicht vollständig aus dem Bewusstsein der lokalen Bevölkerung verschwunden. Dies zeigte sich in seinem Wiederaufleben Ende der 1960er Jahre. Allerdings hatte die schlesische Idee zu dieser Zeit noch keine Gestalt angenommen und einen anderen Charakter als die Nachkriegsidee. Es entwickelten sich kulturelle und allgemeinbildende Aktivitäten. Durch den Zusammenschluss der beiden bisherigen Institute entstand die Schlesische Insitution, die begann die Zeitschrift Schlesien: Kultur und Land herauszugeben. Seine Aktivitäten endeten jedoch 1972.
Die Überlegungen über die schlesische Identität wurde nach dem November 1989 im Zusammenhang mit dem Übergang zu einem demokratischen politischen und rechtlichen System, der Schaffung einer Zivilgesellschaft, der Wiederherstellung der Selbstverwaltung und einer grundlegenden Reform der öffentlichen Verwaltung erneuert. Kulturelle und pädagogische Aktivitäten wurden auf regionaler Ebene erneuert. Im Jahr 1990 nahm die Schlesische Institution ihre Tätigkeit wieder auf und im Jahr 1991 wurde die Schlesische Universität in Opava gegründet. Das Adjektiv "schlesisch" kehrte in den Namen einer Reihe von Sozial-, Kultur-, Bildungs-, Sport- und Wirtschaftseinrichtungen (Theater, Banken, Sportvereine, Industriebetriebe) zurück. Die Bewohner der Region durften bei der Volks-, Haus- und Wohnungszählung 1991 ihre Zugehörigkeit zur Region durch die Deklaration der schlesischen Nationalität zeigen. Es entwickelten sich Diskussionen über die neue territoriale und administrative Aufteilung der Tschechischen Republik, und im Jahr 2001 begann das neue regionale System zu funktionieren und Schlesien wurde ein Teil der Mährisch-Schlesischen Region. Nur sein westlichster Teil, Jesenicko, wurde Teil der Region Olmütz.
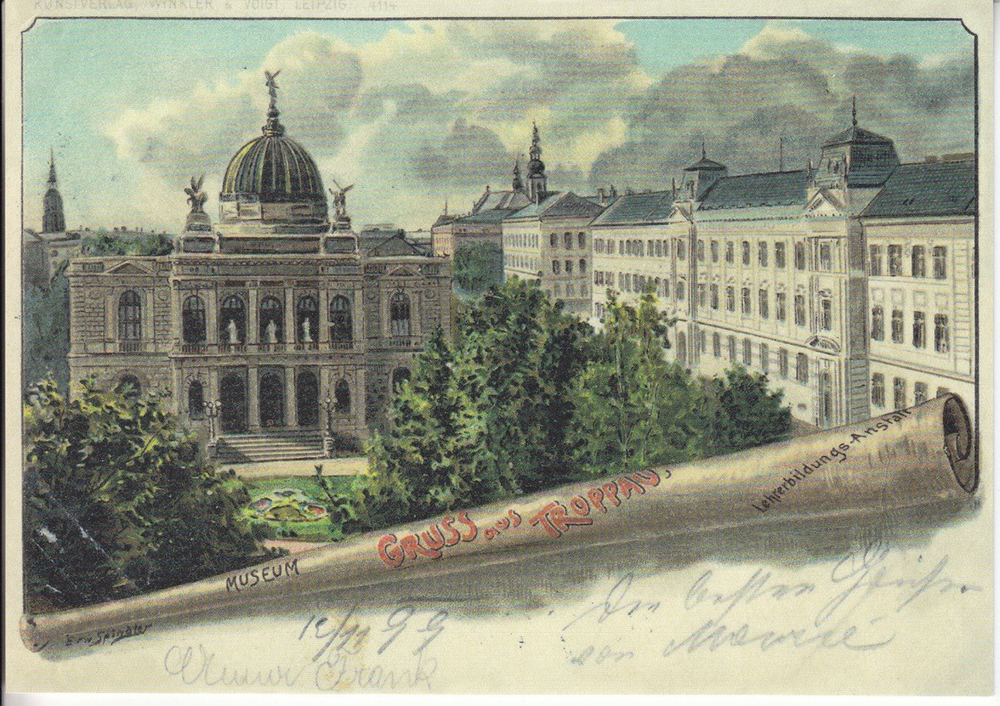
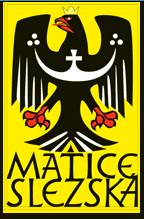
Die Bewohner Schlesiens nehmen die Region heute als eine kulturhistorische Region wahr, sie sind sich der Unterschiede in der Lebensweise, der Sprache, der Wahrnehmung der Religion und den Charaktereigenschaften der Bewohner zu anderen Regionen der Tschechischen Republik bewusst. Die schlesische Identität, die auf tschechischen und polnischen Traditionen beruht, ist immer noch lebendig, während der deutsche Teil der Traditionen in kollektive Vergessenheit geraten ist. Bedeutende Ereignisse (der Zweite Weltkrieg, der Österreichische Erbfolgekrieg) und wichtige Persönlichkeiten (Petr Bezruč, Marie Terezie, Leoš Janáček), die mit seiner Geschichte verbunden sind, sind im kollektiven Gedächtnis der hiesigen Bevölkerung erhalten geblieben. Viele historische Traditionen, Legenden und Geschichten, die mit der Gegend verbunden sind, sind ebenfalls erhalten geblieben. Hier sind eine Reihe von Organisationen und offiziellen staatlichen Einrichtungen (Theater, Museum, Universität, Institutionen) tätig, aber auch Amateurvereine, Verbände und Institutionen, die die Elemente des Schlesiertums unterstützen und die weitere Entwicklung der schlesischen Identität garantieren.
7.2 Vergleich von Teilbereichen auf Basis soziologischer Forschung
Das natürliche Bedürfnis eines jeden Menschen ist es, irgendwo dazuzugehören. Die Identifikation einer Person mit einem bestimmten sozialen Organismus entspringt ihrem Bedürfnis, sich in einen sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Kontext einzufügen, und wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst. In der soziologischen Forschung über Schlesien wurde die Beziehung der Einwohner zur schlesischen Region untersucht, sowohl im Hinblick auf das historische als auch das kulturelle Bewusstsein gegenüber der territorialen Einheit. Ziel war es, die Identifikation der Bewohner nicht nur mit dem Raum als solchem, sondern auch mit seinem sozialen Bereich herauszufinden, d.h. nicht nur die Beziehung der Menschen zur Landschaft, zur Stadt, zum Dorf im physischen Sinne, sondern auch die Identifikation mit den Menschen, die dort leben, ihrer Lebensweise, ihren Institutionen, Organisationen, ihrer Kultur, Geschichte usw.
Die stärkste territoriale Identität in allen untersuchten Teilgebieten wird von den Einwohnern zu dem Ort wahrgenommen, an dem sie leben, vor allem in der Region Opava ohne Hlučín (66,9%). Die schwächste territoriale Identität zu dem Ort, wo sie leben, ist in Gesenke (Teil von MSK) und im mährischen Teil von Ostrava, in diesen Teilgebieten gibt es einen stärkeren Einfluss der territorialen Identität zur Tschechischen Republik. In Gesenke gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen dem Teil, der zu MSK gehört und dem Teil, der zu OLK gehört.
Die Forschungen zur territorialen Identität haben gezeigt, dass es sich um ein multiplikatives Thema handelt, das komplexe Strukturen schafft und nicht aus einem früheren Bewusstsein der historischen Einheit in Gebieten stammt, die keine gemeinsame Entwicklung hatten und große Migrationswellen durchlaufen haben. Parallel zu dieser Feststellung wurde auch festgestellt, dass selbst in Gebieten, die einen relativ hohen Anteil an autochthoner (einheimischer) Komponente aufweisen, eine Reduktion der territorialen Identität der jüngeren Generation auf den unmittelbaren Wohnort festzustellen ist. Der Grund dafür liegt laut der Untersuchung darin, dass die junge Generation die Strömungen der Globalisierung stärker aufnimmt (in Kultur, Gastronomie, Mode usw.). Dies wirft die Frage auf, wie die jüngere Generation mit solch massiven globalisierenden Einflüssen umgehen wird und welche Auswirkungen dies auf die territoriale Identität zukünftiger Generationen haben wird. Historisch gesehen ist die Übertragung globaler Elemente, z.B. der Kultur, der Gastronomie, des Anbaus fremder Pflanzen, des technologischen Wissens, quer durch Europa nur einem kleinen Teil der Bevölkerung oder Einzelpersonen bekannt, z.B. Adelsfamilien, Kaufleuten, beruflich reisenden Handwerkern (sog. "erfahrenen"), Wissenschaftlern, Kennern. Verglichen mit der Vergangenheit gab es jedoch noch nie einen so massiven globalen Einfluss auf die untersuchte lokale Gemeinschaft. Die Annahme, dass die territoriale Identität einen hierarchischen Charakter hat, hängt von den historischen Kontext der Entwicklung des Gebietes, die Aufenthaltsdauer der Bewohner im Untersuchungsgebiet, die Wahrnehmung der Landschaft und die Zufriedenheit der Bewohner mit der Lebensqualität, einschließlich ihrer individuellen Aspekte. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung der territorialen Identität ist die Zugehörigkeit zu einer Altersgruppe. Mit zunehmendem Alter nimmt die Identifikation der Bevölkerung mit dem Territorium, in dem sie lebt, zu, während das Bedürfnis, sich mit Europa oder der Welt insgesamt, also einem hierarchisch weiter entfernten Territorium, zu identifizieren, abnimmt.
Ein wichtiger Teil der Untersuchung war auch eine Umfrage zur Zufriedenheit der Bewohner mit ihrer Lebensqualität (ein standardisierter Fragenkatalog aus der Untersuchung der europäischen Werte). Die Ergebnisse der Umfrage zeigten, dass die Einwohner von Jesenik (Teil von MSK) und Opava (ohne Hlučín) mit allen oben genannten Faktoren am zufriedensten waren, während die Einwohner von Ostrava und Hlučín am wenigsten zufrieden waren (siehe Diagramm 7.2). In ihren Antworten drückten diese Bewohner nicht nur ihre Unzufriedenheit mit der Wohnsituation, sondern auch mit ihrem Lebensstandard aus. Dennoch dachten die Bewohner der Region Hlučín nicht daran, von ihrem Wohnort wegzuziehen; im Gegenteil, die Bewohner der Regionen von Teschener-Schlesien und Ostrava dachten eher an diese Tatsache. Die Untersuchung zeigte, dass die Gesamtzufriedenheit hauptsächlich von der Zufriedenheit mit dem persönlichen Leben, der Wohnqualität, dem Lebensstandard, den Freunden und dem Sicherheitsgefühl beeinflusst wird (gemessen durch den Korrelationskoeffizienten). Es gibt Unterschiede im Einfluss einzelner Faktoren auf die Gesamtzufriedenheit zwischen den Teilregionen, z.B. beeinflusst die Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld die Gesamtzufriedenheit am meisten in Hlučín und dem mährischen Teil von Ostrava.
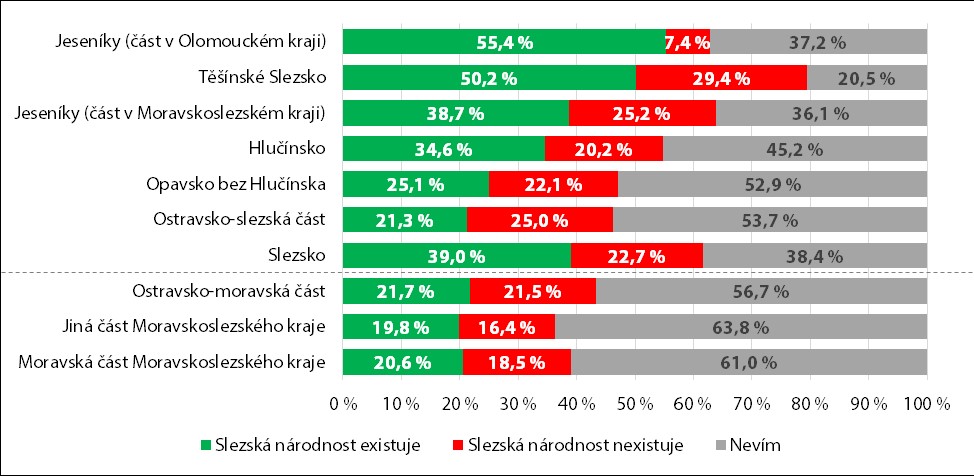
Aus der soziologischen Gesamterhebung wurden mehrere Karten ausgewählt, die zeigen, wie sich die Befragten in den Teilbereichen der Erhebung in ihren Antworten auf verschiedene Fragen zu ihrem Leben in der Region verteilen. Die Antworten zeigten, dass 75 % oder mehr der Bevölkerung mit der allgemeinen Lebensqualität in den Regionen Opava und Jeseníky (Teil der MSK) zufrieden sind, und am wenigsten in der Region Ostrava (mährischer Teil) (Karte 1). Die Zufriedenheit mit dem Wohnen liegt auch in den Regionen Jeseníky (Teil von MSK) und Opava bei mehr als 73 % (Karte 2). Die höchste Zufriedenheit mit der Qualität der Beziehungen zu Kindern gibt es in Jeseniky (Teil von MSK) (Karte 3). Die Bürger wollen nicht dauerhaft in einem Dorf oder einer Stadt bleiben, insbesondere in den Regionen Těšín und Ostrava (Karte 4). Der wichtigste Grund für das Verlassen des Wohnortes war die Aussicht auf einen besseren Arbeitsplatz, insbesondere für junge Menschen. 66,1 % der 18- bis 34-Jährigen in Schlesien gaben diesen Grund an. Die schlesischen Bewohner im Alter von 35-64 Jahren gaben auch den häufigsten Grund für den Wegzug wegen eines besseren Arbeitsplatzes an, und im Vergleich zur jüngeren Generation legten sie viel mehr Wert auf die Qualität der Umgebung. Die Frage der Umweltqualität war in der Bevölkerung ab 65 Jahren recht weit verbreitet. Stolz darauf, Bürger der Tschechischen Republik zu sein, empfinden mehr als 90 % der Menschen in der Region Jeseníky (Teil von OLK) (Karte 5). Der Unterschied der Einwohner Schlesiens zu den anderen Einwohnern der Tschechischen Republik wird vor allem von den Einwohnern (mehr als 80 %) in dem nicht zu Schlesien gehörenden Teil des MSK und auch von den Einwohnern der Region Těšín wahrgenommen (Karte 6).
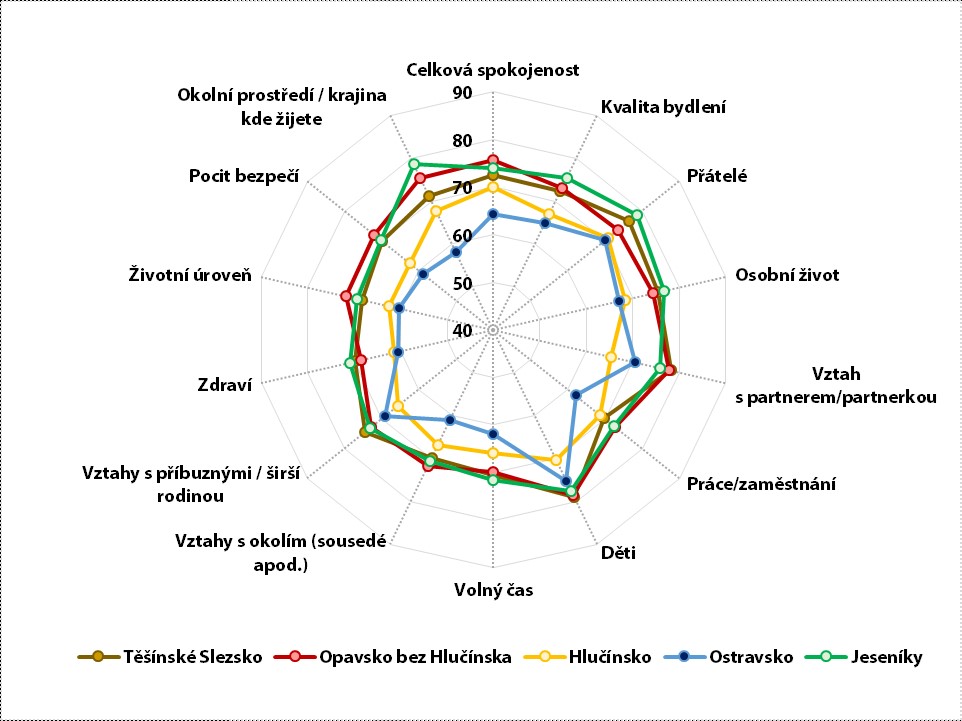
7.3 Region Jesenicko
Die Region Gesenke, die auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien liegt, ist Teil des ehemaligen Sudetenlandes. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebiet von der deutschen Bevölkerung dominiert, die im 13. bis 14. Jahrhundert während der gezielten "Großen Ostkolonisation" auf Einladung von Přemysl Otakar II. kam. Nach ihrer Vertreibung im Jahr 1945 wurde das Gebiet von Tschechen, Mähren und Slowaken, aber auch von Rumänen, Griechen und galizischen Böhmen und anderen Gruppen neu besiedelt. Seit dem Jahr 2000 ist die Region Jeseníky (Altvatergebirge) verwaltungstechnisch in zwei Teile geteilt, von denen der eine zur Region Olomouc (Olmütz) und der andere zur Mährisch-Schlesischen Region gehört.
"Ich werde zwei Gefühle ausdrücken, denn ich bin natürlich ein Patriot, weil ich hier geboren bin, aber ich würde sagen, ich habe ein gutes Gefühl für die Region Gesenke. Mährisch-Schlesische Region".
"Heute bin ich in Jeseníky mehr zu Hause. Ich meine allgemein, ich meine nicht nur Vrbno oder Jeseník, sondern von Zlaté hory über Jeseník bis Vrbno.“
Die Befragten konnten das Gebiet von Schlesien nicht definieren. Die Mehrheit nahm Schlesien als einen historischen Begriff wahr, der heute nicht mehr existiert. Einige wussten nicht mehr, dass sie in Schlesien waren, sie dachten, dass es territorial nicht mehr existierte. Niemand hier hatte eine besondere Beziehung zu Schlesien. Sie fühlten sich zur tschechischen oder mährischen Nationalität zugehörig. Der Begriff Schlesien verschwand mit den deutschen Einwohnern nach deren Abzug im Jahr 1945. Die neuen Einwanderer stellten keine Beziehung zu Schlesien her; ihre Wahrnehmung konzentrierte sich auf die Region Jesenik und die mährisch-schlesische bzw. Olmützer Region, d.h. auf das Gebiet, in dem sie wohnen oder das ihnen am nächsten liegt. Die Geschichte Schlesiens ist hier unterbrochen, und die heutigen Bewohner haben kein Bedürfnis, ihre Kenntnisse über die schlesische Geschichte dieses Gebietes zu erwerben oder zu vertiefen.
"Ich denke, die meisten von uns werden sich daran erinnern, dass Vrbno bis 1961 Vrbno ve Slezsku hieß, so dass die Menschen damals mit der Beziehung zu Schlesien etwas vertrauter waren, aber heute kehren wir wahrscheinlich dazu zurück. Nach der Umbenennung in Vrbno pod Pradědem würde ich sagen, dass Schlesien ein wenig gefallen ist. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass wir einfach zu Schlesien gehören."
"Für die jüngere Generation ist Schlesien heute nur noch ein historischer Begriff und existiert meiner Meinung nach nicht mehr als Schlesien. Historisch gesehen natürlich schon, aber ich empfinde nichts für Schlesien."
Respondents said that people in Jeseník are very independent and more resilient than in other regions. Either people don't perceive the differences, or they observe differences in culture, in gastronomy, in dialect. They have a strong attachment to the environment, strong neighborly relations based on friendship.
Die Befragten sagten, dass die Menschen in Jesenicko sehr unabhängig und widerstandsfähiger sind als in anderen Regionen. Entweder nehmen die Menschen die Unterschiede nicht wahr, oder sie beobachten Unterschiede in der Kultur, in der Gastronomie, im Dialekt. Sie haben eine starke Bindung an die Umwelt, starke nachbarschaftliche Beziehungen, die auf Freundschaft basieren.
Im Bezug auf die Lebensqualität hat Jesenicko ein höheres Maß an Ruhe (siehe die Diagramm unten). Die Bewohner sind mit den einzelnen gemessenen Aspekten der Lebensqualität vor allem im Gebiet von Jeseniky, das sich in der Mährisch-Schlesischen Region befindet, zufrieden. Aus soziologischer Sicht lässt sich feststellen, dass Menschen, die in dem Gebiet unzufrieden waren, dieses verlassen haben, während diejenigen, die geblieben sind, in der Umfrage eine höhere Zufriedenheit mit dem Leben angaben. Ähnliche Schlussfolgerungen wurden auch in der nationalen Umfrage gefunden, die 2006 im Rahmen des Projektes Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und Perspektiven der Bildung durchgeführt wurde, wo eine höhere Zufriedenheit unter den Einwohnern der Region Vysočina als unter den Einwohnern der Stadt Prag festgestellt wurde. In der Region Jesenicko ist die Zufriedenheit mit der Umgebung, der Landschaft, in der die Menschen leben, die Zufriedenheit mit den Beziehungen zu Freunden und zu ihren Kindern am höchsten. Das Gebiet von Jeseniky, das in der Region Olmütz liegt, hat deutlich niedrigere Werte, und die Zufriedenheit mit dem Sicherheitsgefühl ist extrem niedrig.
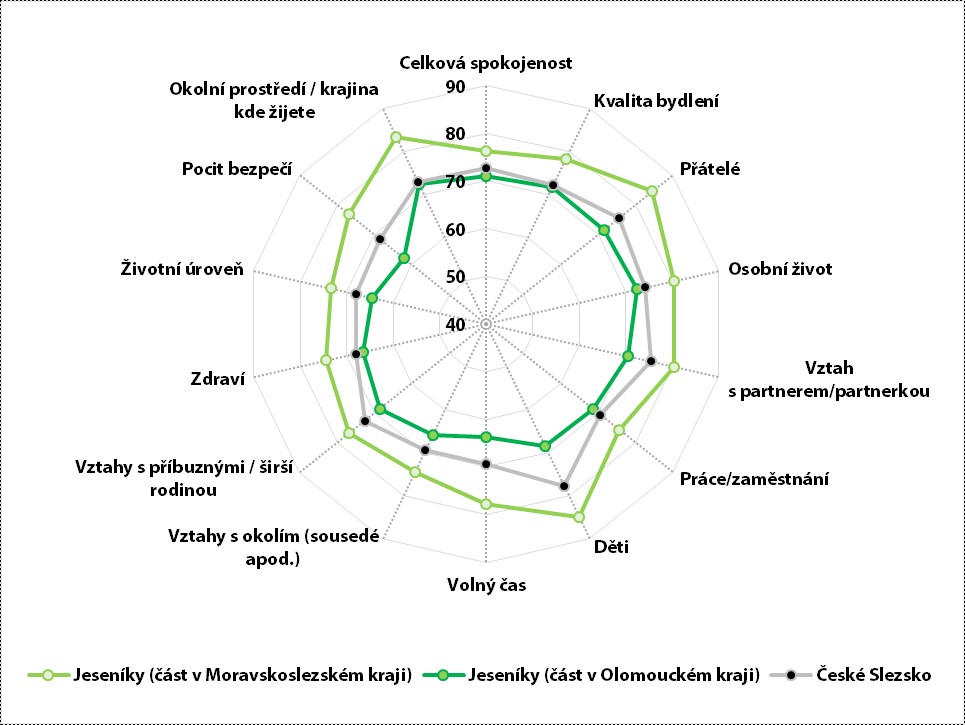
Die Befragten waren sich einig, dass das Schönste in dieser Gegend die ausgedehnten Wälder sind. Die Dominante der Landschaft ist der Berg Praděd, den man von fast überall aus sehen kann. Nach den aktuellen und früheren Informationen, die den Befragten aus den Medien zur Verfügung stehen, ist die Luft in Vrbno pod Pradědem und Karlova Studánka die sauberste in Mitteleuropa. Vrbno befindet sich im schönsten Tal im Gesenke. Überall, wo Sie hinaufsteigen, erreichen Sie schöne Panoramablicke auf die Kämme des Riesengebirges oder schöne lange Täler. In den Wäldern gibt es auf interessante, natürliche Weise schöne Felswände, die mit ihrer Struktur und Weite Neuankömmlinge überraschen können und immer die Herzen der einheimischen und alten Bewohner erfreuen. Die Befragten sagten, dass sie mit einer geringeren Entwicklung des Tourismus im Gesenke zufrieden sind, weil die Menschen nicht kommen, um sie zu zerstören. Nach der Wahrnehmung der Befragten gibt es auch einen Unterschied in der Besiedlung zwischen den Beskiden und Gesenke. Im Gesenke leben die Menschen in den Tälern und es gibt nur Hütten in den abgelegenen Gebieten, während in den Beskiden die Menschen auch an den höchsten Stellen in den abgelegenen Gebieten leben, wo sie z.B. ihre Herden weiden. Die Befragten gaben auch an, dass mit dem Beginn der Bergbauaktivitäten die ursprünglichen Buchenwälder verbrannt wurden, Weiden entstanden, auf denen Vieh gezüchtet wurde, und anschließend Fichten für den Bedarf an schnell wachsendem Holz gepflanzt wurden.
Die Befragten waren sich einig, dass der Bau eines neuen Staudamms in Heřmínovy notwendig ist, da das Gebiet von Wasserknappheit oder im Gegenteil von sehr gefährlichen Überschwemmungen bedroht ist. Alle wasserwirtschaftlichen Arbeiten, die dazu dienen sollen, Hochwasser zurückzuhalten, sind eine gute Sache und sollten auch für die Zukunft aufbewahrt werden. Vrbno und die Umgebung haben in ihrer Geschichte schon viele Male verheerende Überschwemmungen erlebt. Alle Befragten haben ihre eigenen Erfahrungen und berechtigte Sorgen vor sich wiederholenden Naturkatastrophen.
7.4 Region Opava
Die Region Opava wird durch den Verwaltungsbezirk der Gemeinde mit erweiterter Zuständigkeit Opava ohne den Teil des Gebiets gebildet, der in die Region Hlučín fällt, die sogenannte Prajz-Region. Darüber hinaus umfasst das Gebiet die Regionen Vítkovsko, Bílovecko und Odersko, die sich auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien befinden. Die statutarische Stadt Opava war das historische und administrative Zentrum von Österreichisch-Schlesien, das bis heute eine natürliche Mikroregion mit einem Einzugsgebiet bildet, das sich teilweise in die Region Kravařsko (d.h. einen Teil der Region Hlučínsko) erstreckt.
"Ich interessiere mich sehr für die Geschichte und alles, was mit Schlesien zu tun hat, weil zu Hause nicht viel darüber gesprochen wurde. Ich empfinde das als etwas Schlechtes, deshalb möchte ich, dass meine Nachkommen wissen, woher wir kommen und so weiter. Ich interessiere mich also aktiv für die Geschichte. Damit sie wissen, dass Nordmähren nicht Schlesien ist."
Die Geschichte Schlesiens, die die territoriale Identität seiner Bewohner bildet, ist ein interessantes Thema, das alle von einer Art das Geheimnis, das nach dem Abzug der deutschen Bewohner blieb. Was bleibt, sind Erinnerungen, architektonische Denkmäler, die Aktivitäten ehemaliger Vereine, familiäre Bindungen und die Namen von Persönlichkeiten, die zwar nicht völlig vergessen, aber nicht mehr allgemein bekannt sind. Es gibt hier Menschen, die daran interessiert sind, die Erinnerungen wiederzubeleben und an die alte, reiche und ruhmreiche Geschichte von Opauer Schlesien anzuknüpfen. Für Schlesier ist Opava die historische Hauptstadt von Tschechisch-Schlesien.
"Ich bin damit völlig einverstanden, ich sehe Schlesien als ein Land. Ein Land wie Wales, Bayern. Und ich sehe Schlesien in zweierlei Hinsicht. Das ganze Schlesien, das heißt, einschließlich des größten Teiles des Gebietes, das in Polen liegt, und dann eine Art Sonderkategorie Tschechisch-Schlesien oder Österreichisch-Schlesien."
"Jeder kennt das Lied: 'Wenn Mähren so wäre wie Schlesien', so ist es hier offensichtlich, dass Schlesien größer ist. Es sollte die Schlesisch-Ostrauer Region sein, entsprechend der Größe ihres Territoriums. In unserer Region gibt es nur ein kleines Stückchen Mähren."
Alle Befragten haben eine sehr positive Einstellung zu Opava, das sie als eine schöne Stadt mit reicher Geschichte, Kultur und Traditionen betrachten. Einige der Einwohner haben noch die deutsche Staatsbürgerschaft und sind stolz darauf. Sie alle fühlen sich als Schlesier, Opauer, Tschechen. Einige Befragte mit familiären Wurzeln in europäischen Ländern erwähnen die europäische Zugehörigkeit und die multikulturelle Wahrnehmung der Welt. Die Befragten waren sich einig, dass das Wesen der Schlesier durch eine andere Mentalität, einen anderen Dialekt, eine kürzere Sprache und Traditionen zum Ausdruck kommt. In den Herzen der Schlesier gibt es sowohl Traurigkeit über das harte Leben, aber auch Liebe zu ihrer Heimat. Die Mentalität der Region ist nicht immer die gleiche, es gibt keine Regel. Die Befragten sagten, dass die historische Aufteilung: kaiserlich vs. präsianisch, immer noch in den Köpfen der Menschen wirkt.
"Nach meinem Gespräch mit Meister Skácel (er war aus Hlučín): ist es ein großer Unterschied, wenn er nach Opava geht und dort Vorträge hält, als in Hlučín, es ist ein riesiger Unterschied geistig und spirituell."
Nach Meinung der Befragten fehlt es den Schlesiern an natürlichem Stolz, da viele Bürger nicht wissen, wo Schlesien innerhalb der Tschechischen Republik liegt. Hier wiederholt sich die Meinung, dass sich die Schlesier von Prag ignoriert fühlen, was ihnen nicht gefällt. Die meisten sind der Meinung, dass es nicht erwünscht war, in der Tschechischen Republik über Schlesien zu sprechen, da der Begriff der schlesischen Nationalität in der Vergangenheit politisch bewusst unterdrückt wurde. Manche Menschen schämen sich nach wie vor, aus Schlesien zu stammen, was mit der Vertreibung der Deutschen, den Veränderungen der Nationalität in der Geschichte und den damit verbundenen Ereignissen zusammenhängt.
"So eine Traurigkeit. Vor allem sehen wir es in der Kultur, in der Literatur. Die Literatur dieser schlesischen Region ist so anders, ihr fehlt diese mährische Fröhlichkeit, und das Gleiche in der Musik, wir sehen es sogar noch besser, denn wir bereiten das 'Hlučín-Liederbuch' vor, und es ist interessant, dass ich kein einziges Lied in einer fröhlichen Richtung wie in Südmähren sehe, alles elegisch, Moll-Tonarten. Es ist auch interessant, dass es sich teilweise an der österreichischen Musik orientiert."
"Die Mehrheit von Tschechisch-Schlesien, als größte Sprachgruppe, war deutsch, die es nach 1945 nicht mehr gibt, und an zweiter Stelle waren die Polen, oder in Anführungszeichen die Wasserpolacken, Schlonzacken und dann eine kleine Gruppe von Mähren, aber das ist eine historische Angelegenheit und die Leute nehmen es nicht mehr so wahr."
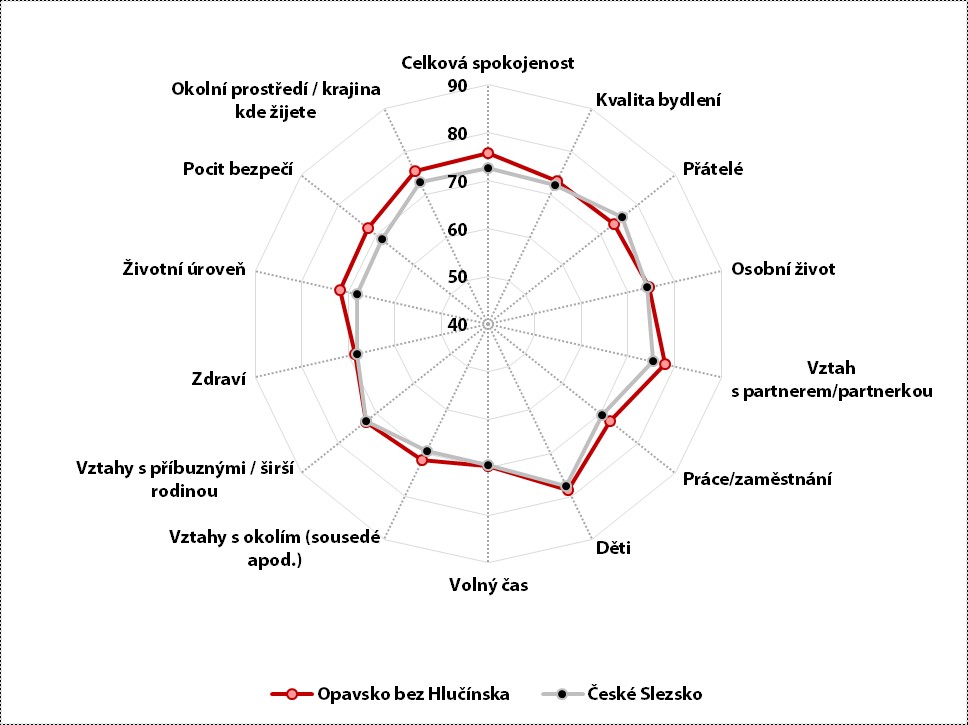
"Was ich hier ein bisschen spüre, aber ich sage es nicht, ist eine gewisse Weltlichkeit, ein Bedürfnis auszudrücken, dass wir es hier schwer haben, aber gleichzeitig ein großer Stolz auf den schönen Ort, an dem ich lebe. Die beiden Emotionen sind miteinander verwoben - wir haben ein verdammt hartes Leben hier, aber auf der anderen Seite ist es schön, es ist unser Ort. Ich denke, man kann eine Menge dieser Emotionen in den Versen vom Liedermacher Nohavica hören."
"Wir haben nicht diesen natürlichen Stolz und das natürliche Selbstvertrauen wie die Prager. Deshalb haben wir es hier gehört - wenn ich Schlesien sage, wissen manche Leute in der Tschechischen Republik nicht einmal, wo das ist. Aber kein Prager wird sagen, er sei aus Prag, er wird sagen, er sei aus Strasnice oder Žižkov. Aber wir sagen, die können sich das nicht richtig vorstellen, also sagen wir, wir sind aus Mähren, und jeder kann sich das besser vorstellen, ich sage, ich bin aus Nordmähren."
Laut einer quantitativen Umfrage sind die derzeitigen Bewohner von Opava mit der wahrgenommenen Lebensqualität zufrieden (siehe Diagramm). Im Vergleich zu anderen Einwohnern der Region Tschechisch-Schlesien ist vor allem die Zufriedenheit mit den Beziehungen zu Freunden geringer, während die Zufriedenheit mit der Gesundheit, den Beziehungen zu Eltern und Kindern, der Freizeit und der Wohnqualität ungefähr gleich ist.
Die Befragten gaben an, dass es in der Region Opava immer noch Landwirte gibt, die auf eine bestimmte Art und Weise Landwirtschaft betreiben, die vor dem Putsch entwickelt wurde (d.h. große Felder mit dem Einsatz von schweren landwirtschaftlichen Geräten). Hier herrschen große Landwirtschaftsbetriebe vor, die viele Hektar Land mit Monokulturen bewirtschaften, was sich negativ auf die Landschaft auswirkt. Die Region Opava gilt als ein landwirtschaftliches Gebiet. Neben den oben genannten Veränderungen, die durch die unwirtschaftliche Landwirtschaft verursacht werden, sehen die Befragten die schlimmste Veränderung in der Borkenkäferplage, die ganz Tschechien sehr intensiv betroffen hat. Bäume und Wälder verschwinden vor unseren Augen und die Menschen sind zu Recht besorgt über die Folgen dieser Situation. Ein weiteres Problem ist die Luftverschmutzung.
Die Befragten nehmen Schlesien als eine schöne Region mit vielen kulturellen Traditionen wahr, die von vielen lokalen Gemeinschaften entwickelt wurden. Sie definieren sich im Bezug auf Ostrava; nach Meinung der Befragten haben die Menschen, die hier leben, auch ganz andere Werte, Ideen, Traditionen.
ímají Slezsko jako krásnou oblast, rozmanitou na mnoho kulturních tradic, rozvinutých mnoho místních společenství. Vymezují se vůči Ostravě, lidé, kteří zde žijí, mají dle respondentů v sobě také zcela jinak poskládány hodnoty, myšlenky, tradice.
7.5 Region Hlučín
Das Gebiet wird im Osten durch die Oder und im Süden durch den Fluss Opava begrenzt. Gegenwärtig liegt der größte Teil davon im Verwaltungsbezirk Hlučín und Kravaře, teilweise peripher in Gemeinden, die in Opava liegen und in einigen Stadtteilen der statutarischen Stadt Ostrava. Nach den Schlesischen Kriegen gehörte dieses Gebiet ab 1742 zu Preußen und wurde 1920 auf der Grundlage des Versailler Friedensvertrages wieder der Tschechoslowakei zugesprochen. In den Jahren 1938-1945 wurde es Teil des Deutschen Reiches, nach 1945 wurde es Teil der Tschechoslowakei, die Vertreibung der Deutschen war minimal, etwa 10% der Bevölkerung. Die fast zwei Jahrhunderte währende Zugehörigkeit zu Preußen (später Deutschland) hat tiefe Spuren in der Kultur, den Werten, der Lebensweise und dem Denken der einheimischen Bevölkerung hinterlassen. Das Gebiet hat den höchsten Anteil von Einwohnern, die sich zur römisch-katholischen Kirche bekennen. Das Gebiet wird von Menschen bewohnt, die sich immer noch als "Prajzaks" bezeichnen und ihre Nachbarn im ehemaligen Österreich "Císaraks" nennen.
"Alle sehen Schlesien als eine Art Drittland an, die Bewohner werden irgendwie vernachlässigt und ausgegrenzt, und endlich fangen die Leute an, über uns zu schreiben." "Über Schlesien ist wenig bekannt. Mähren und Böhmen ist es nicht bewusst, dass sie gerne über sich sprechen. Schlesien muss sein Profil schärfen. Im Jahr 2020 werden es 100 Jahre Prajska sein. Jetzt feiern wir 100 Jahre Tschechische Republik, und im Grunde genommen hatten wir noch nichts zu feiern, weil zum Beispiel das Nachbardorf Pist erst 1921 der Tschechischen Republik beigetreten ist."
Die Befragten fühlten sich am stärksten territorial mit Schlesien verbunden, speziell mit Prajska. Außerdem fühlten sie sich dem Territorium zugehörig, in dem sie leben: Es gab Vřesianer, Hati und Hlučianer. Die Bewohner nahmen wahr, dass es einen Unterschied zwischen Prajzsko und Hlucinsko gibt.
"Wir sind wie ein Blut. Aber jedes Mal, wenn jemand anfängt zu reden, lernen wir uns kennen. Einen Verräter erkennt man überall. Wir versuchen, es zu fördern, damit es nicht stirbt." "Sie sind abnormal fleißig, sie stehen um vier Uhr morgens auf, um zu arbeiten, sie kommen nach Hause arbeiten auch dort, sie tun alles. Sie helfen sich alle gegenseitig sehr viel. Familie, Nachbarn. Die Familie hat das Haus gebaut."
Es gibt typische Merkmale von Schlesien. Sei es in der Kultur, im Ausdruck, im Denken, in den Schritten. Die typische Sprache ist "unser Weg", aber anders als in Teschen, ist es der "Prajzska Weg". Der Dialekt ist hier je nach Gebiet unterschiedlich. Die Befragten sehen sich selbst als eine sehr hart arbeitende Gemeinschaft von Menschen, die auf starken familiären Bindungen aufbaut. Sie sehen es als selbstverständlich an, dass man sich gegenseitig hilft, in der Familie, bei Nachbarn, bei Freunden. Infolge widriger historischer Ereignisse in der Region haben die Menschen hier gelernt, vorsichtig und rücksichtsvoll zu sein. Wenn etwas Wichtiges passiert, können sie an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten. Sie nehmen Neuankömmlinge nur langsam in ihre Mitte auf. Wenn jemand anfängt, über jemand anderen zu sprechen, ohne dass dieser anwesend ist, kann es sein, dass er immer auf jemanden aus seiner Familie stößt, da die Familienbande in diesem Gebiet sehr stark sind.
"Es wurde uns verboten, unsere Sprache in den Schulen zu sprechen. Und die Tschechen können ihren Dialekt sprechen, sie singen und sprechen einfach ihren Dialekt und niemand verbietet es ihnen. Wie das? Wir durften in den Schulen nicht unseren Dialekt sprechen, sie haben uns dafür gemaßregelt, uns mit schlechten Noten bestraft, so dass die Prajska-Sprache verschwunden ist. Die tschechische Sprache, das war ein Problem für uns. Wenn die Kinder zu Hause nicht richtig tschechisch hören konnten, dann war das ein Problem." "Andererseits sagt man heute, dass wir, wenn wir in die Tschechische Republik kommen, furchtbar nach der Schrift sprechen, dass wir wie neu gemacht sind. Wir sind so überarbeitet, dass wir eine bessere Rechtschreibung haben als die Prager oder die Südböhmen, aber wir haben einfach kurze Schnäbel. Wir haben keine Zeit. Wenn wir einen ganzen Satz sprechen, fangen die Prager erst an zu reden, oder zu denken."
Es gibt auch eine Ansicht, die die Selbstreflexion des Wesens der lokalen Bewohner offenbart:
"Einerseits helfen wir uns gegenseitig, andererseits sind wir aber auch ein bisschen neidisch. Wenn mein Nachbar einen Pool hat, muss ich auch einen Pool haben. Genau, und er hat ein neues Auto, also müssen wir auch ein neues Auto kaufen. Besser, teurer. Fremdes Unglück ist die reinste Freude, so lautet ein bekanntes Sprichwort. Er hat so ein schönes Grab, ich werde ein besseres haben. Das ist auch die Natur der Prärie. Aber die, die das nicht wollen, die gibt es überall, nicht nur in Prajska."
Die Ergebnisse der quantitativen Umfrage zeigen, dass die derzeitigen Bewohner von Prajzká in allen Aspekten der Lebensqualität unzufrieden sind (siehe Diagramm). Die soziologische Interpretation dieses Phänomens beruht auf anderen Gründen als in anderen Gebieten von Tschechisch-Schlesien. Die Unzufriedenheit rührt aus dem historisch gewachsenen Vergleich ihres Lebensstandards mit der Situation in Deutschland, wo es den Prajzianern besser geht als in Tschechien, und dazu gibt es einen bekannten Spruch: "Deutschland, Deutschland über alles", viele Bewohner haben noch lebende Verwandte in Deutschland. In Bezug auf die objektiven Faktoren ist dies ein reicheres Gebiet in Schlesien.
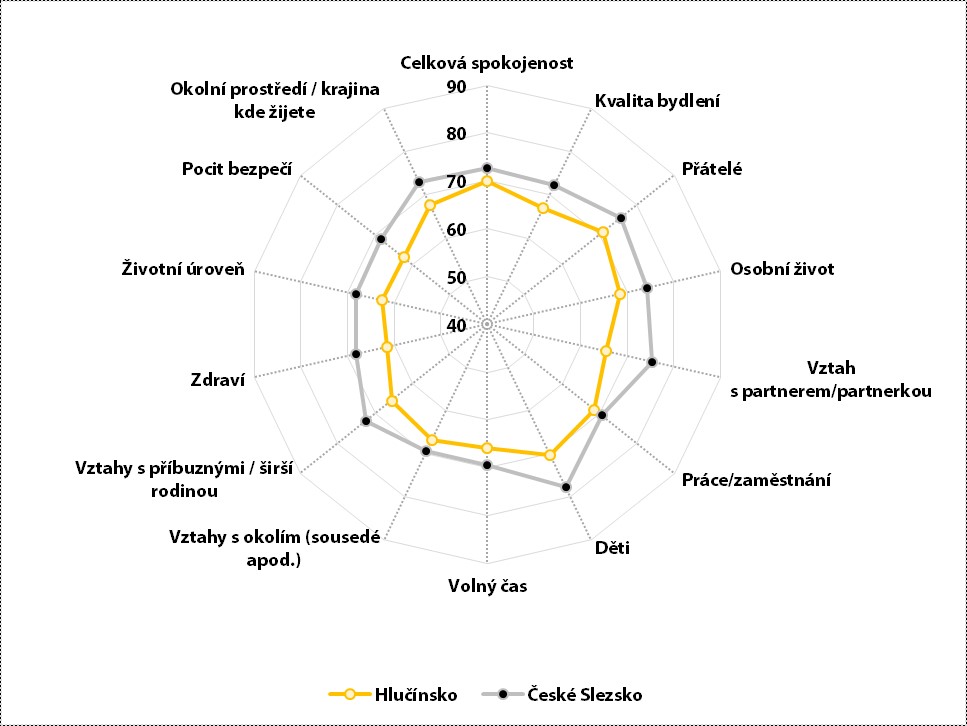
Die Bewohner nehmen ihre Landschaft als ein Territorium wahr, das von Menschen sorgfältig gereinigt und bearbeitet wird, und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass sie auf ihren Fleiß und ihre Sorgfalt bei der Arbeit gebührend stolz sind. Sie sind davon überzeugt, dass ihnen außerhalb von Prajzská niemand in der Tschechischen Republik das Wasser reichen kann. Perfekte Reinigung und schöne Gestaltung bedeutet für die Familien auch ein Grab auf dem Friedhof, denn sie nehmen alles als ihre eigene Visitenkarte ihrer Arbeit und Beziehung zu allem wahr, was sie besitzen. Von den Prajzacs wird hier gesagt, dass ihr Verhalten und ihre Handlungen den Einfluss der deutschen Disziplin widerspiegeln, die in der jüngsten Vergangenheit allgegenwärtig war.
Die Region Hlučín ist eine waldarme Agrarlandschaft, die in den letzten Jahren von Trockenheit bedroht war. Der Rückgang des Wassers macht sich auch in Brunnen bemerkbar. Es gibt Bedenken für die Zukunft.
"Wir gießen zwar aus unserem eigenen Brunnen, aber trotzdem merkt man manchmal, dass das Wasser so weit absinkt, dass es einfach nicht mehr funktioniert, naja."
Sie beschrieben auf lustige Art und Weise die Vorteile der Tschechischen Republik, die kein Küstenland ist.
"Wir haben die Prognose der Meteorologen für das nächste Jahr gelesen, dass uns wieder ein El Niño mit großen Temperaturschwankungen und Überschwemmungen und auf der anderen Seite mit großen Dürren treffen wird. Auf der einen Seite bedauert man, dass man nicht am Meer ist, dass man nicht die Ressource, die Möglichkeit hat, das Meer zu genießen; auf der anderen Seite sind wir froh, dass wir in der Mitte Europas sind, wo es noch eine Art relationalen Frieden gibt. Wenn sie gestört werden sollten, werden wir nicht gestört. Es gibt hier ein Sprichwort, das besagt, dass es auf mein Feld und auf das Heu meines Nachbarn regnen soll."
Die aktuelle Manifestation einer starken Identität im Gebiet sind die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken und die erstellten Webseiten, z.B. "Prajz Republik - Über Prajzak und seine Heimat" oder Facebook-Seiten, die sich auf die Geschichte der Dörfer konzentrieren (z.B. Petřkovice / Petrzkowitz / Petershofen).
7.6 Die Region Těšín
Der tschechische Teil von Těšín ist das Gebiet des ehemaligen Fürstentums Těšín, das im Westen von den Flüssen Ostravice und Odra und im Osten von der heutigen Staatsgrenze begrenzt wird. Ungefähr 10 % der Bevölkerung ist polnisch und einige Dörfer sind zweisprachig. Das historische Zentrum ist die Stadt Český Těšín, die mit der polnischen Stadt Těšín eine kompakte Stadt bildet. Andere wichtige Städte sind Karviná, Havířov, Bohumín, Třinec. Die Region Těšín umfasst einen Teil von Ostrava und die schlesische Stadt Frýdek (ohne die mährische Stadt Místek).
"Aber am nächsten kommt es mir, wenn mir jemand sagt, dass es von hier oder von dort kommt."
Die Lokalpatrioten verstehen sich als Šlonzáks (Schlesier, im lokalen Dialekt).
"In einem internationalen Umfeld (bei Auslandsreisen) neigt man dazu, sich als Tscheche oder Europäer zu identifizieren, zum Beispiel gegenüber Amerikanern. Aber natürlich, sagen wir auf der Mikro- oder Regionalebene, fühle ich mich als Šlonzák, denn schließlich habe ich die meiste Zeit meines Lebens dort gelebt."
In Bezug auf die Nationalität, gaben einige Folgendes an:
"Mein Vater hat mir eingeflößt, dass wir Schlesier sind, dass wir weder Polen wie Wolodiovsky noch Tschechen wie Švejk sind. Wir sind einfach einheimische Schlesier, ob wir Nachfahren einiger Walachen aus der Kolonialzeit sind, ist schwer zu sagen."
Es gibt einen interessanten Blick auf die Beziehungen zwischen Tschechen und Polen:
"Für mich endet die Grenze nicht an der Olše, sondern sie reicht bis nach Bielsko."
Einige Befragte sind der Meinung, dass die Beziehungen zwischen den beiden Nationen historisch belastet und unausgewogen sind. Sie befürchten, dass die Polen Gebiete beanspruchen, die ihnen nie gehörten, und sie berichten, dass es polnische Interessengruppen gibt, die gefährliche nationale Reibungen verursachen. Sie behaupten:
"Wenn die Tschechen polnische Zeitungen lesen würden, wären sie nicht so ruhig."
Im Gegensatz dazu beschrieben andere Befragte die Beziehungen zu den Polen als gut. Alle waren jedoch froh, wie sie berichteten, dass sich das Museum von Těšínsko mit diesen Beziehungen befasst. Es gibt viele historische Ereignisse und Informationen, die bewahrt, nicht vergessen und für andere Tschechen weitergegeben werden sollten. Sie halten es für wichtig, diese Region, die ihrer Meinung nach absichtlich in Vergessenheit geraten ist, wieder bekannt zu machen, da sie allen Tschechen in vielerlei Hinsicht so viel zu bieten hat.
In der Diskussion über die schlesische Identität wurde die Zugehörigkeit der Bürger von Těšín zu den Traditionen der evangelischen und katholischen Kirche als wesentlich erwähnt. Die Beziehung der Mitglieder der Evangelischen Kirche zu ihrer Kirche in Vyšní brána in Těšín wurde als mütterlich beschrieben. Die Frage der Weitergabe des Glaubens und der Beziehung zur Kirche wird hier als ein wesentlicher Teil der territorialen Identität gesehen.
"Meine Vorfahren mütterlicherseits, also meine Großmutter war orthodox-katholisch, väterlicherseits war sie orthodox-protestantisch, und ich bin ein Produkt von all dem."
Die Befragten glauben, dass die Schlesier hier mehr religiös orientiert sind.
"Die Vorfahren wanderten von der Walachei zur Vyšná brána und durch die Wälder, sie hatten Kirchen in den Wäldern und schliefen dort. Aber ihr Ziel war das Hohe Tor, es waren die Menschenmassen."
Těšín wird von seinen Bewohnern als die industriellste Region in der Tschechischen Republik angesehen, sowohl historisch als auch aktuell. Ihnen gefiel die Aussage eines bekannten und beliebten Sängers:
"Jarek Nohavica hat es sehr treffend gesagt, dass es eine eigenartige Region ist."
Dieser Eindruck, so die Befragten, basiert auf der harten Arbeit, die schon immer da war. Die Menschen hier mussten schon immer hart arbeiten, was sich auf ihren Charakter, ihr Wesen und ihr Denken auswirkte. Hier waren die Menschen ihrer Meinung nach immer härter als anderswo im Land.
"Unsere Vorfahren pflegten zu sagen, dass, egal wo sie sich in Deutschland oder sonstwo in Europa trafen, sie feststellten, dass Schlesier härter arbeitete als andere."
Sie glauben, dass die Menschen hier immer noch lernen, miteinander zu leben, angetrieben durch die multiethnische Zusammensetzung der Bevölkerung, die immer noch wegen der Arbeit hierher zieht, heute wie in der damals.
"Hier sind wir an der Kreuzung der Nationalitäten. Über den Brücken haben wir Ungarn, Oberungarn ist heute die Slowakei, also gibt es den slowakischen Einfluss, dann waren wir Teil von Österreichisch-Schlesien mit Galizien bis Krakau, also polnischer Einfluss, und natürlich Frýdek und runter nach Mähren und Ostrava, also tschechischer Einfluss. Wir stehen seit Jahrhunderten am Scheideweg und haben gelernt, miteinander zu leben und auszukommen, aber nicht immer erfolgreich."
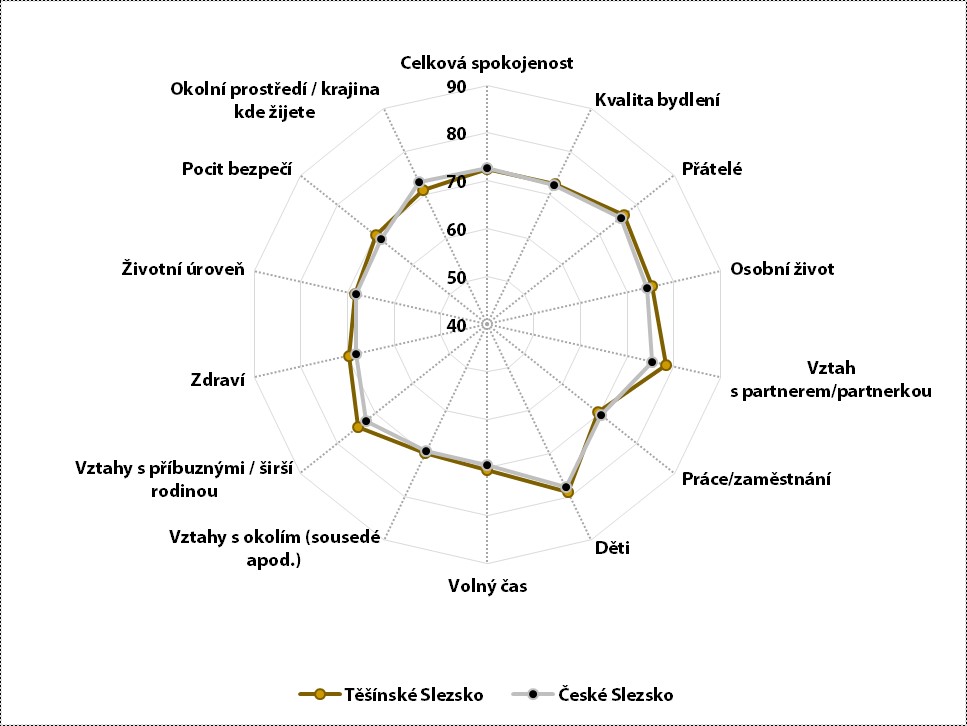
Böhmen und Mähren hatten historisch gesehen feste und unveränderliche Grenzen, im Gegensatz zu Schlesien. Nach Meinung der Befragten löste Böhmen seine ethnischen Probleme (Tschechen gegen Deutsche) vielleicht noch brutaler als Schlesien. Bis heute liegt, ohne dass es den Menschen bewusst ist, das gesamte Gebiet Schlesiens an der Grenze mehrerer Staaten. Sie erklärten weiter, dass es notwendig ist, sich ständig auf die Tatsache zu fixieren, dass ein Teil des so genannten unseren Schlesiens anderswo ist (d.h. auf dem Territorium eines anderen Staates), dass sich die Schlesier als Schlesier fühlen, auch die, die andere Sprachen als Tschechisch sprechen, die auf der anderen Seite der Grenze, d.h. die Polen. Hier gibt es eine echte gemeinsame Identität mehrerer Nationen, die aber gleichzeitig in vielerlei Hinsicht recht widersprüchlich sein kann. Heute, in einem vereinten Europa, spielen Grenzen nach Meinung der Befragten keine so große Rolle, wohl aber die Identifikation mit dem Territorium. Diese historischen Zusammenhänge spiegeln sich in gewisser Weise immer noch im Denken und Leben der Menschen in diesem Gebiet wider, denn sie existierten und sind immer noch in den Menschen lebendig.
Die Befragten gaben an, dass Schlesien zersplittert ist, weil es ihrer Meinung nach in der Vergangenheit leider keinen starken Herrscher gab, der Schlesien in ein Land mit allem verwandeln konnte. Das Territorium wurde von den Nachbarstaaten nach Belieben politisch umgestaltet. Die dort lebenden Menschen haben ihre Nationalität und Staatsangehörigkeit entsprechend geändert. Das ist der Grund, warum das Gebiet in vielerlei Hinsicht so fragmentiert ist. Oft wird hier ein lokaler Dialekt gesprochen, der weder tschechisch noch polnisch oder deutsch ist, sondern "unsere Art". Aber auch dieser Dialekt ist nicht einheitlich, denn Schlesien ist groß. Manche Gegenden waren rein deutsch, was auch den spezifischen Dialekt in diesen Orten beeinflusste, und "bei uns" herrscht wieder eine andere Sprache.
Die Ergebnisse der quantitativen Umfrage in Bezug auf die wahrgenommene Lebensqualität zeigen, dass die derzeitigen Bewohner Schlesiens mit ihren Kindern am zufriedensten sind. Im Vergleich zu anderen Einwohnern von Tschechisch-Schlesien unterscheidet sich ihre Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der Lebensqualität nicht vom Durchschnitt (siehe Diagramm).
Eine befragte Person erklärt:
"Schlesien ist ein kleines Labor von Europa. Wenn die Menschen hier lernen, in diesem kleinen Kreis zusammenzuleben, können wir ein Modell für ganz Europa sein, wo dieses Zusammenleben in einem größeren Maßstab stattfindet."
Der Befragte begründete das Wort "wir lernen" damit, dass die tschechisch-polnisch-slowakischen Beziehungen für die hiesigen Siedler ein Langstreckenlauf sind, sie halten sie für ungelöst und glauben, dass sie nicht gelöst werden. Wir müssen es immer wieder neu lernen, erinnern uns die Befragten, in jeder Generation.
"Die Menschen hier in der Tschechischen Republik sind weniger kritisch als die Presse, die ich in Polen lese. Wir sind Freunde und ich danke Gott dem Herrn für jeden Tag, den wir mit ihnen ohne viel Streit leben. Aber sich zu vertragen und zu einigen ist etwas anderes."
7.7 Region Ostrava
Es ist ein relativ junges Gebiet, dessen Bedeutung vor allem mit der Entwicklung des Kohlebergbaus im 19. Jahrhundert wuchs, mit einem wirtschaftlichen Zentrum, das vor allem aus den Städten Moravská Ostrava und Polská Ostrava besteht. Die Städte lagen historisch gesehen in zwei Ländern, Schlesien und Mähren. Schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es Tendenzen, ein Groß-Ostrau zu schaffen, einen konkreten Namen bekam es aber erst nach 1918. Die Behörden konnten sich nicht auf die Schaffung eines Groß-Ostrau einigen, so dass am 1. Januar 1924 nur 6 in Mähren gelegene Gemeinden an Mährisch-Ostrau angeschlossen wurden. Der Großraum Ostrava entstand erst nach der deutschen Okkupation, als im Jahr 1941 durch die Regierungsverordnung Nr. 236/1941 Slg. beschlossen wurde, das schlesische Ostrau und 7 weitere Gemeinden aus Schlesien und 4 Gemeinden aus Mähren der Stadt Mährisch Ostrau anzugliedern. Gegenwärtig, infolge der Migrationsprozesse seit 1950, ist der Unterschied zwischen dem mährischen und dem schlesischen Teil verschwunden, es bleiben nur die Unterschiede im Charakter der Gebäude. Im mährischen Teil von Ostrava befinden sich die großen Plattenbausiedlungen Hrabůvka, Dubina und Výškovice, in denen sich eine große Anzahl von Einwohnern konzentriert. Im schlesischen Teil von Ostrava gibt es den Stadtteil Ostrava-Poruba, aber auch das schlesische Ostrava mit seiner verstreuten Bebauung in Einfamilienhäusern und weitere kleinere Stadtteile.
Die Befragten fühlten sich nicht der schlesischen Nationalität zugehörig. Die meisten der erwachsenen Teilnehmer an der Gruppendiskussion betrachten sich als Ostrauer Patrioten und sind auf diese Zugehörigkeit auch entsprechend stolz. Sie sehen ihre Zugehörigkeit zur tschechischen Nation als selbstverständlich an und brauchten sie nicht durch die Zugehörigkeit zu Mähren oder Schlesien auszudrücken, obwohl sie ein herzliches Verhältnis zum gesamten Gebiet der Tschechischen Republik haben.
"Ich bin Tscheche und ich bin sehr stolz darauf. Und ansonsten bin ich Ostrauer. Darauf bin ich auch stolz."
"Nun, es mag Sie überraschen, aber ich habe mich mein ganzes Leben lang als Slawe gefühlt. Ich fühle meine Zugehörigkeit zu den slawischen Völkern sehr stark."
"Natürlich liebe ich die Tschechische Republik, ich liebe Mähren und ich bin auch stolz darauf. Ebenso liebe ich Ostrava. Sehr, also bin ich gleichzeitig ein Patriot von Ostrava. Ich bin stolz darauf. Ich bin stolz auf alles."
Die Befragten konnten nicht genau sagen, wo Schlesien liegt. Einige dachten, dass Schlesien irgendwo in der Region Teschen liegt, während andere dachten, dass es in der Region Prajska liegt. Sie konnten Schlesien nicht von Mähren unterscheiden; vielmehr waren sie im Allgemeinen mit der Kultur Mährens und Böhmens vertraut und verstanden die Größe dieser Gebiete gut. Einige Ostrauer, so berichten die Befragten, wissen nicht, dass Ostrava sowohl schlesisch als auch mährisch ist. Die meisten Befragten dachten, dass Schlesien ein Begriff ist, der heute nicht mehr verwendet wird, sie sind jetzt einfach in Mähren. Informationen über Schlesien erhielten sie nicht von ihren Eltern oder in der Schule, sondern durch ihre eigene Wahrnehmung der um sie herum fließenden Informationen oder durch Selbststudium. Wenn es um die Besonderheiten der Region geht, waren sich die Befragten über viele charakteristische Merkmale der in Ostrava lebenden Menschen einig:
"Ich denke auf jeden Fall, dass die Menschen hier in Schlesien und vor allem in Ostrava anders sind als in Böhmen und Mähren und Hana, ich würde sagen, sie sind grobkörniger, sie sind auf jeden Fall direkter, sie haben kein Problem damit, klar und deutlich zu sagen, was sie denken, oder die Sache auf den Punkt zu bringen, was für Menschen, die aus einem anderen Teil des Landes kommen, oft schockierend ist."
"Meine Tochter lebt seit etwa vier Jahren in der Nähe von Prag und sagt, dass sie sich nicht an die tschechische Mentalität gewöhnen kann, sie sagt, dass sie immer um den heißen Brei herumreden, dass niemand direkt sagt, was er denkt, und dass sie, wenn sie es sagt, als die Spinnerin gilt. Ja, sie sagt, dass sie deshalb als unhöflich angesehen wird. Und sie kommt hierher nach Hause und sagt, dass sie völlig erleichtert ist, dass alles wieder an seinem Platz ist."
"Ich denke, wir reden sehr schnell, kurz und bündig miteinander. Wenn etwas wirklich gut ist und man es mag, hat es einfach Erfolg, und dann ist es das wert. Beifall. Ja. Wir sind so und lassen andere wissen, was wir denken. Wir werden nicht nur so klatschen. Und das gefällt mir, damit fühle ich mich wohl."
Die spezifische Wahrnehmung der Bewohner war auch sehr positiv in Bezug auf Erinnerungen und Ereignisse, die mit der Kindheit im Sozialismus verbunden waren und die von gesamtgesellschaftlichen Feiern begleitet wurden (z.B. Maifeier, Spartakiade, Laternenumzug):
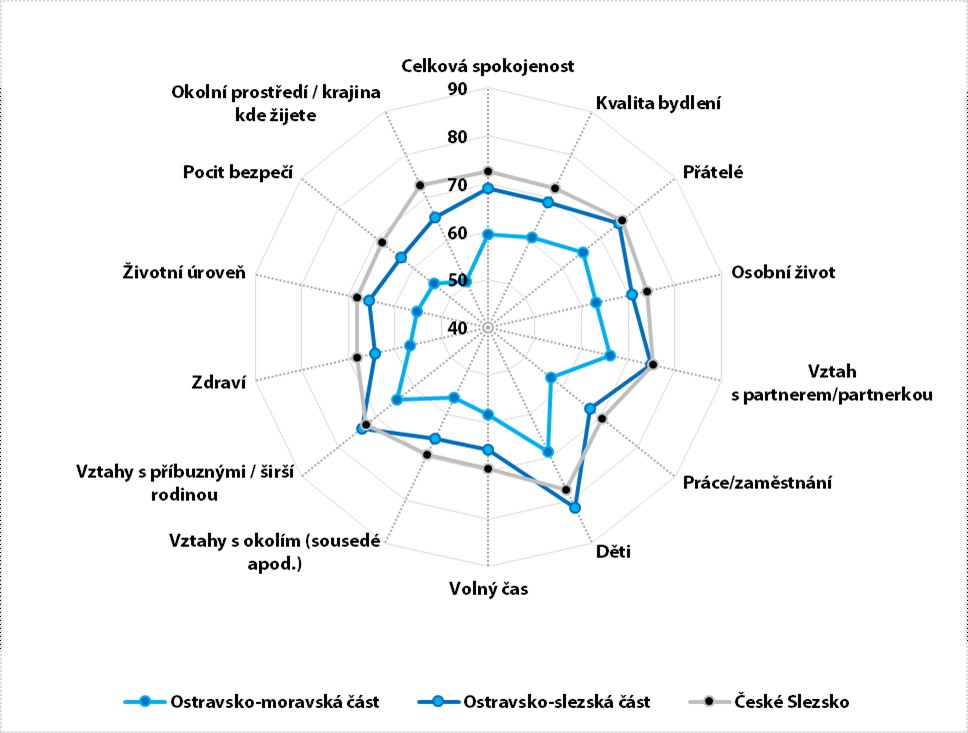
"Ich denke zum Beispiel an den 1. Mai, der ein bedeutendes, schönes Ereignis war. Mein Gott, das war ein schönes Ereignis, ja, das ich deutlich positiv in Erinnerung habe, trotz aller, ich würde sagen, Normalisierungsprozesse. Für uns ist es definitiv ein Teil unserer Vergangenheit."
"Wenn Sie bemerkt haben, was die amerikanischen Filme, die englischen Filme, uns gebracht haben, dass es eigentlich viele Sportarten, kulturelle Veranstaltungen in diesen nachbarschaftlichen Beziehungen gibt, Bräuche, die diese Nachbarn unabhängig oder sogar national halten, irgendwie wurde es nur bei uns nach der Revolution verteufelt. Ja, was mich heute stört, weil ich meine Kindheit, und da kann jeder sagen, was er will, als eindeutig positiv sehe, und auch die Spartakiade und die Übungen auf dem Spielplatz, wo alle geklatscht haben, und dann habe ich die Wurst und die Limo bekommen, das war einfach eine tolle Show für mich."
Die Ergebnisse der quantitativen Umfrage zeigen, dass die derzeitigen Einwohner von Ostrava im Vergleich zu anderen Einwohnern von Tschechisch-Schlesien mit der Lebensqualität unzufrieden sind. Es wurde ein großer Unterschied zwischen den Bewohnern des mährischen Teils von Ostrava und denen, die auf dem Gebiet des historischen Schlesiens leben, festgestellt, was vor allem auf die Art der Bebauung zurückzuführen ist (siehe Diagramm ).
Die Befragten schilderten getreu ihre sehr naturalistischen Eindrücke von Ostrava. Ostrava kämpft immer noch mit Luftverschmutzung und Umweltschäden, die durch Bergbau und Schwerindustrie verursacht werden. Die umliegende Aussicht auf die Beskiden von Ostrava aus wird von allen positiv wahrgenommen:
"Ich finde die Landschaft von Ostrava schön, aber es ist ein bisschen laut, die Luft ist ein bisschen zu verschmutzt, meiner Meinung nach. Zum Glück wohne ich in der Nähe eines Waldes, so dass ich das nicht so empfinde. Wenn man es im weiteren Sinne betrachtet, gefällt mir die Landschaft sogar noch besser, denn wenn man die Berge hinzunimmt, sind sie absolut beeindruckend."
Das industrielle Erbe von Ostrava wird von manchen als beängstigend, morbide, grausam empfunden. Andere sind begeistert von den ausgestellten Eisenkonstruktionen, die Erinnerungen an die Verbindung mit der Ostrauer Vergangenheit wecken. In der Region Ostrava, so die Befragten, gibt es ein Niemandsland, wo sich dichte bewachsene "Gebüsche" ausbreitet, eine Ruine mit Vegetation, an der niemand vorbeikommt und von der niemand weiß, was sich dort befindet. Es gibt einen Unterschied in der Wahrnehmung von Ostrava durch einheimische Ostrauer oder solche, die aus anderen Orten in der Umgebung von Ostrava zugewandert sind. Nicht jeder mag Ostrava, die Region Ostrava, nicht jeder ist begeistert von der spezifischen Manifestation der Ostrauer Kultur durch den so genannten eisernen Schrott.
7.8 Orte der Erinnerung
Denkmäler sind ein Zeichen der Erinnerung, Symbole der Vergangenheit, ein in dauerhaftem Material festgehaltenes Bewusstsein der Geschichte. Sie bilden Orte der Erinnerung. Aus ihrer einfachen Symbolik lässt sich das kollektive Gedächtnis als eine symbolische Identität rekonstruieren, die sozialen Gruppen dazu diente, soziale Hierarchie und Macht offenzulegen und zu dokumentieren.
Die Karte enthält nicht alle Denkmäler, die sich auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien befinden, denn in jedem Dorf gibt es einen lokalen Gedenkort, der in der Regel an die Ereignisse der Kriegsnöte des Ersten und Zweiten Weltkrieges oder an lokale prominente einheimische Personen oder Persönlichkeiten aus der Welt der Politik, Wissenschaft und Kunst erinnert. Darüber hinaus ist die Erinnerung an die vertriebene deutsche Bevölkerung der Region ein Phänomen der Nachkriegszeit, d.h. der Abriss von Denkmälern oder die Überdeckung des ursprünglichen ideologischen Erbes durch eine neue Ideologie. Die erste Welle der massenhaften Entfernung von Denkmälern für Kaiser Joseph II. und Vertreter der habsburgischen Macht fand in den Jahren nach dem Oktober 1918 statt. Das Republikschutzgesetz von 1923 sah in § 26 Sanktionen für den Fall vor, dass staatsfeindliche Denkmäler und Gedenkstätten für Angehörige der Familien Habsburg-Lothringen und Hohenzollern im öffentlichen Raum nicht entfernt oder aufgestellt werden.
Die Karte zeigt Denkmäler, die öffentlich an ein historisches Ereignis oder eine historische Persönlichkeit erinnern, die regionale Erinnerungsorte sind oder aus Sicht des Denkmalschutzes einen kulturhistorischen Wert haben. Auf der Grundlage soziologischer Erhebungen werden die Standorte von Vincenzo Priessnitz (Begründer der modernen Hydrotherapie und des Gräfenberger Bades) und des schlesischen Barden Petr Bezruč in die Karte aufgenommen.
Das Toleranz-Denkmal (1931), das sich am steilen Hang des Berges Godula am Ort der geheimen Treffen der Protestanten in der Zeit der Religionsfreiheit befindet, erinnert an die komplexe Geschichte des multireligiösen Zusammenlebens in der Region. Die Gedenkstätte für den Widerstand des schlesischen Volkes in Ostrá Hůrka erinnert an Schlüsselmomente in der Geschichte der tschechischen Bewegung in Schlesien (die Volkslager vom 12. September 1869, 11. September 1898, 22. September 1918, 1. September 1929,
25. September 1938, 23. September 1945, 21. September 1969 und 19. Mai 1990) und eine ähnliche Funktion im östlichen Teil Schlesiens erfüllt das Denkmal des Befreiten Landes auf der Schwarzen Erde in Sedliště.
Das Leid des Ersten Weltkrieges fängt in Bílý Potok ursprünglich das Denkmal aus der Bildhauerwerkstatt von Engelbert Kaps aus dem Jahr 1922 ein, das im Stadtgebiet der Gemeinde unversehrt erhalten geblieben ist und 2018 restauriert wurde. Das monumentale Denkmal der Gefallenen von Těšín (Orlová) erinnert an die Ereignisse des Sieben-Tage-Krieges und ist die letzte Ruhestätte von 56 Männern, die in dem blutigen tschechisch-polnischen Konflikt gefallen sind.
Am zahlreichsten in der Sammlung sind die Gedenkstätten, die an die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg erinnern: das Gebiet der Tschechoslowakei Befestigungsanlagen (Darkovičky), Internierungslager, Gedenkstätten für die Opfer des Todesmarsches, Gedenkstätten und Objekte der Partisanenbewegung in den Beskiden, Gedenkstätten in Lískovec u Frýdku, Životice und Ivančeně, Friedhöfe der gefallenen Soldaten (Hlučín) und das monumentale Nationale Denkmal des Zweiten Weltkrieges in Hrabyně. Der Friedhof der Nonnen in Bílá Voda erinnert an die Zeit der kommunistischen Unfreiheit.
7.9 Verschwundene deutsche Erinnerung - Hans Kudlich (*1823 - †1917)
Während seines langen Lebens prägte er das kollektive Gedächtnis der deutschsprachigen Bevölkerung des Sudetenlandes. Kudlichs Leben und Vermächtnis symbolisieren treffend die komplexe Situation in Schlesien in einer Zeit des eskalierenden Nationalismus und der schwierigen (wenn nicht gar unmöglichen) Suche nach einer Harmonie zwischen bürgerlichen und nationalen Prinzipien.
Da er im Oktober 1848 an der dritten Wiener Revolution des Jahres beteiligt war, musste er nach der Auflösung des Parlaments durch den Kaiser am 6. März 1849 das Land rasch verlassen (bis dahin war er durch die parlamentarische Immunität geschützt). Er zog in der Schweiz, wo er Augenheilkunde studierte. Auf diplomatischen Druck der österreichischen Regierung wurde er jedoch aus der Schweiz ausgewiesen und verbrachte anschließend den größten Teil seines langen Lebens als Arzt in den USA. Ein Jahr nach seiner Ausreise nach Amerika wurde er im Frühjahr 1854 in Österreich wegen angeblichen Hochverrates zum Tode verurteilt. 1867 wurde er jedoch amnestiert, und ab 1872 besuchte er regelmäßig seine alte Heimat. Sein längster Aufenthalt von elf Monaten fand vom Frühjahr 1872 bis zum Ende des Winters 1873 statt, den größten Teil davon verbrachte er in seiner Heimatregion. Auch nach seiner Rückkehr in die USA war Hans Kudlich in der österreichischen Öffentlichkeit präsent, da er in seinen Zeitungsartikeln und Briefen, die in deutschen Zeitschriften in den böhmischen und österreichischen Ländern gedruckt wurden, die politischen Ereignisse in der Monarchie kommentierte. Wie der Wiener Student äußerte auch der reife und dann ältere Kudlich in seinen Ansichten eine substanzielle Mischung aus Demokratismus, Antiklerikalismus, Philosemitismus und deutschem Chauvinismus, die sich sehr stark gegen die Slawen, insbesondere die Tschechen, richtete. Er identifizierte Deutschtum mit Fortschritt, Slawentum und Tschechentum mit reaktionärer Rückständigkeit. Bei seinem zweiten Besuch in der alten Heimat 1888 "verhärteten" sich seine Ansichten noch mehr. Es war der 40. Jahrestag der Revolution von 1848 und der Abschaffung der Leibeigenschaft. In diesem Jahr wurden die ersten Kudlich-Denkmäler enthüllt, ausschließlich in deutschsprachigen Gebieten, und Kudlich wurde von den Deutschen in den böhmischen Ländern bei Feierlichkeiten als Befreier der Bauern gefeiert. In diesem Zusammenhang ist es jedoch eine Ironie der Geschichte, dass sich Kudlich überhaupt nicht mehr um die sozialen und wirtschaftlichen Probleme auf dem Lande kümmerte. Seine öffentlichen Reden und Artikel zu dieser Zeit zeigen, dass er bereits in erster Linie ein deutsch-nationalistischer Aufwiegler war, der das zentralistische Regierungsmodell in Vorlitauen unterstützte und jegliche tschechische Emanzipationsforderungen verurteilte. In der tschechischen Öffentlichkeit konnte er kaum Sympathien gewinnen.
Diese entschiedenen Positionen behielt Kudlich bis zu seinem Tod im Jahr 1917. Zwischen 1888 und 1938 wurden in den böhmischen Ländern mindestens 55 Kudlich-Denkmäler errichtet, fast die Hälfte davon entstand während der Ersten Republik aus den ursprünglichen Denkmälern Josef II. oder Franz Josef I. (das Gedenken an Mitglieder der Habsburger-Dynastie im öffentlichen Raum war durch ein Gesetz von 1923 verboten). Zur Zeit ihrer feierlichen Enthüllung, also in einer Zeit des eskalierenden Nationalismus, sollten diese Denkmäler die Identität der deutschen Bevölkerung der böhmischen Länder manifestieren (und tatsächlich prägen). Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Zeit ihrer systematischen Entfernung, da sie an die vertriebene deutschsprachige Bevölkerung erinnerten. Heute bilden die nach 1990 restaurierten Denkmäler Brücken zum erneuerten multiethnischen Gedächtnis der lokalen Umgebung und sind ein echtes Symbol der Versöhnung mit einer komplizierten Vergangenheit.
Im Jahr 1908 wurde in Čaková eine Gedenk-Eiche zum Andenken an Hans Kudlich gepflanzt. Unter dem Baum wurde eine Gedenktafel mit dem Text "Hans Kudlich Eiche - Deutsche haltet den Nacken steif! - 1848-1908" angebracht. - Deutsche, beugt euch nicht!). Das Denkmal ist bis heute erhalten geblieben und wurde im Jahr 2005 mit Zustimmung der Stadtverwaltung renoviert. Der mittlere Teil der ursprünglichen Inschrift, der das Lebensbekenntnis Kudlichs enthält, wurde nicht restauriert.
Im Jahre 1908 wurde in Čaková eine Gedenk-Eiche gepflanzt. Das 1928 enthüllte Denkmal ist bis heute erhalten geblieben. Die Dominante des Denkmals ist ein Steinrelief von Hans Kudlich und eine Gedenktafel mit der Inschrift "Zum ewigen Andenken an den Bauernbefreier Hans Kudlich". Die Originaltafel enthielt auch Kudlichs Credo "Deutsche haltet den Nacken steif!" (Deutsche, verrenkt euch nicht den Hals!). Dieser Teil der ursprünglichen Inschrift ist aufgrund seines umstrittenen Charakters nicht auf der neuen Gedenktafel nach der Rekonstruktion des Denkmals im Jahr 2005 enthalten.
Das Kudlich-Denkmal in Jistebník wurde am 17. Juli 1910 enthüllt. Ein verirrter Felsblock, der im Dorf ausgegraben wurde, diente als Fundament. An ihm wurden zwei Kupferplaketten angebracht - eine mit Kudlichs Relief und die andere mit der Widmung "Gewidmet Hans Kudlich - dem deutschen Volksmanne, Robotbefreier 1848". Das Denkmal steht heute noch an seinem Platz, aber niemand weiß, was sein ursprünglicher Zweck war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zum Denkmal für die gefallenen Soldaten der Roten Armee "umgewidmet". Die beiden ursprünglichen Kupfertafeln wurden entfernt und zwei neue Gedenktafeln mit den Aufschriften "Ehre und Ruhm den 16 gefallenen Helden" angebracht. Sie starben für unsere Freiheit" und "Tschechoslowakei - UdSSR - Loyalität für Loyalität - 1. und 2. Mai 1945".

Im September 1888 organisierte die deutsche politische Vertretung von Krnov anlässlich des 40. Jahrestages der Aufhebung der Sklaverei und Leibeigenschaft, in Krnov die Enthüllung eines Denkmals für Kaiser Josef II. im Park und einer Gedenktafel für Hans Kudlich in der angrenzenden Grotte. Das Denkmal und die Gedenktafel wurden im Beisein von Hans Kudlich enthüllt. Auf der Gedenktafel stand: "Dem Bauernbefreier Hans Kudlich errichtet am 23. September 1888". Die Grotte wurde nach dem Zweiten Weltkrieg entfernt.
In Loučky (heute ein Ortsteil von Zátor) wurde anlässlich des hundertsten Geburtstages von Kudlich, also im Jahr 1923, im unteren Teil des Dorfes neben der Straße von Krnov nach Bruntál ein Denkmal enthüllt. Im Jahr 2004 wurden die Überreste des Denkmals entdeckt, das anschließend renoviert und 2006 an einem neuen Standort im Stadtpark enthüllt wurde.
Stará Rudná - In Stará Rudná, das heute zur Gemeinde Rudná pod Pradědem gehört, wurde 1898 in der Nähe der Kirche an der Straße von Mala Morávka nach Světlá Hora ein Gedenkstein enthüllt, der an den 50. Jahrestag der Herrschaft von Kaiser Franz Josef I. erinnert. Der Stein überstand die Nachkriegsereignisse und im Jahr 2005 wurde auf Initiative der Stadtverwaltung eine neue Gedenktafel angebracht. Sie ist zweisprachig und erinnert gleichzeitig an die frühere Widmung an den Kaiser und später an Hans Kudlich.
Dieses Denkmal hat wohl das vielfältigste Schicksal aller schlesischen Denkmäler für Hans Kudlich. Es wurde 1894 als Denkmal für Josef II. errichtet. Aufgrund der veränderten politischen Verhältnisse musste es 1923 entfernt werden und der leere Sockel wurde 1926 durch eine Büste von Hans Kudlich ersetzt, die der damals bekannte regionale Bildhauer Josef Obeth schuf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch das Kudlich-Denkmal entfernt und durch einen Obelisken zu Ehren der Roten Armee ersetzt. Diese Form hat es bis heute.
Die monumentalste Erinnerung an Hans Kudlich steht immer noch am oberen Rand seines Heimatdorfes. Sie hat die Form eines Aussichtsturms. Der Grundstein für den Turm wurde im September 1908 gelegt. Zwischen der Legung des Grundsteins und der Fertigstellung des Gebäudes vergingen fünf Jahre, da die notwendigen Gelder nur langsam gesammelt werden konnten. Elf Jahre später, im Jahr 1924, wurde beschlossen, am Fuße des Turms ein Mausoleum zu errichten. Im Jahr 1925 wurden die Urnen von Hans Kudlich und seiner Frau in das fertiggestellte Mausoleum gebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel der Aussichtsturm und Anfang der 1990er Jahre war er aufgrund seiner beschädigten Statik vom Abriss bedroht. Im Jahr 2000 wurde der Turm, vor allem dank der Initiative von Kudlichs Verwandtem Walther Kudlich, rekonstruiert.
FAZIT
Gegenwärtig ist das Gebiet von Tschechisch-Schlesien von den Prozessen der sozialen Transformation betroffen, die durch den Übergang von einer industriellen zu einer postindustriellen Gesellschaft verursacht werden, in der das Hauptentwicklungssegment der Dienstleistungssektor ist (z.B. Banken, Informations- und Kommunikationstechnologien). Einige Prozesse sind in der Geschichte verwurzelt, andere sind eine Manifestation der aktuellen paneuropäischen Globalisierungseffekte mit Auswirkungen auf Lokalitäten. Zu den wichtigsten sozioökonomischen Prozessen, die die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung des Gebietes von Tschechisch-Schlesien beeinflussen, gehört die Bevölkerungsinstabilität des Gebietes, die durch die sinkende Geburtenrate und die Abwanderung der Bevölkerung auf der Suche nach Arbeit verursacht wird. Die Überalterung der Bevölkerung und der natürliche Bevölkerungsverlust gehören zu den demographischen Problemen, mit denen das Gebiet von Tschechisch-Schlesien und eine Reihe von europäischen Ländern, wie z.B. Bayern, konfrontiert sind. Das Problem der Überalterung der Bevölkerung, das durch eine steigende Lebenserwartung und eine Zunahme des Anteiles älterer Menschen an der Bevölkerung gekennzeichnet ist, scheint sehr ernst zu sein. Dies führt zu einem steigenden Anteil wirtschaftlich abhängiger Menschen mit höheren Anforderungen an das Rentensystem, die Gesundheits- und Sozialfürsorge und den Wohnungsbau. Auf der anderen Seite können wir mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Territoriums eine steigende Anzahl von Ausländern im Territorium feststellen, die sich in den großen Städten und in Gebieten, in denen ausländische Unternehmen tätig sind, konzentrieren. Diese Prozesse konzentrieren sich auf die Gebiete von Jeseniky, Ostrava und Karviná, wo ein deutlicher Einfluss der Umsiedlung des Gebietes nach dem Zweiten Weltkrieg und der Ankunft der Bewohner zur Arbeit in der Industrie besteht.
Die aktuellen Transformationsprozesse der postindustriellen Gesellschaft wirken sich auch auf die Siedlungsstruktur des Territoriums von Tschechisch-Schlesien auf folgende Weise aus: Die grundlegende republikanische Entwicklungsachse verläuft in nordöstlicher Richtung von Brünn nach Kattowitz. Der Bau der Autobahn D1 spiegelt sich auch in einer erhöhten wirtschaftlichen Attraktivität in der Nähe ihrer Ausfahrten und der angrenzenden Städte wider. Im Hinblick auf die langfristige Entwicklung ist davon auszugehen, dass auch dieser Bereich dichter werden wird. Die zweite regionale Entwicklungsachse, die von Třinec über Český Těšín, Ostrava, Opava mit einer engeren Verbindung zu Krnov verläuft, wird durch die langfristige Entwicklung der Siedlungsstruktur beeinflusst und es ist anzunehmen, dass ihre Bedeutung für die Mährisch-Schlesische Region entscheidend bleiben wird. Diese Verbindung zwischen Ostrava und Opava wird nach der Modernisierung und dem Ausbau der Straße I/11, einschließlich der Fertigstellung der Nordumfahrung von Opava, verstärkt. Nach der Modernisierung der I/11, des östlichen Teils von Třinec bis Jablunkov mit einem Anschluss an das Kapazitätsstraßennetz nach Žilina, ist die Entwicklung der Siedlungen innerhalb der Entwicklungsachse Ostrava - Třinec - tschechisch-slowakische Grenze zu erwarten. Die Bedeutung der lokalen Entwicklungsachse Ostrava - Karviná sinkt aufgrund des Rückgangs der Arbeitsplätze und der Anzahl der Menschen in Karviná. Wenn die Verbindung von Karviná nach Bielsko-Biała nicht fertiggestellt wird, wird diese Achse schwächer werden. Im Gegensatz dazu wird sich die Achse Ostrava - Český Těšín - Bielsko-Biała entwickeln. Die Rolle der starken Städte und ihre Zusammenarbeit ist für die weitere Entwicklung des Gebietes entscheidend.
Der Prozess der Suburbanisierung auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien wird als Verlagerung von städtischen Funktionen (d.h. Industrie, Dienstleistungen, Wohnen usw.) und der Bevölkerung aus den Kernbereichen der Siedlungen in die angrenzenden peripheren Randgebiete verstanden. Es handelt sich um den Prozess der Ausdehnung der bebauten Fläche der Stadt, der sowohl in den meisten Städten der entwickelten Länder als auch in der historischen Entwicklung unserer Städte zu beobachten ist. Die Suburbanisierung bildet zusammen mit der Urbanisierung und der Reurbanisierung ein Trio von dynamischen Prozessen, mit denen das Energiesystem auf die Bedürfnisse der Gesellschaft und deren Veränderungen reagiert. Von Suburbanisierung kann man spätestens seit dem 18. Jahrhundert sprechen, als einerseits die Industrialisierung die Lebensbedingungen in den Siedlungskernen verschlechterte und andererseits der Schienenverkehr und später das Automobil die Mobilität der Bewohner verbesserte - die Folge war eine Abwanderung derjenigen, die es sich leisten konnten, in die an die Stadtränder angrenzenden ländlichen Gebiete, wo ihnen bessere Lebensbedingungen geboten wurden und von wo aus sie gleichzeitig den Anschluss an die beruflichen und sozialen Möglichkeiten, die mit dem Leben im Kernbereich der Stadt verbunden sind, nicht verlieren. Gegenwärtig wirken alle drei genannten dynamischen Prozesse in der Siedlung zusammen, nur die Intensität jedes einzelnen von ihnen ändert sich im Laufe der Zeit und damit in der Summe auch die resultierende Richtung ihrer Wirkung auf die Siedlung. Die Wohnsuburbanisierung manifestiert sich vor allem durch den Bau neuer Wohnungen im Umland der Stadt und die allmähliche Abwanderung von Menschen aus den Kernbereichen größerer Städte in neue Einfamilienhäuser (und neuerdings auch Mehrfamilienhäuser) in Randgebieten oder in benachbarten Dörfern.
Die aktuellen Transformationsprozesse der postindustriellen Gesellschaft wirken sich auch auf die Siedlungsstruktur des Territoriums von Tschechisch-Schlesien auf folgende Weise aus: Die grundlegende republikanische Entwicklungsachse verläuft in nordöstlicher Richtung von Brünn nach Kattowitz. Der Bau der Autobahn D1 spiegelt sich auch in einer erhöhten wirtschaftlichen Attraktivität in der Nähe ihrer Ausfahrten und der angrenzenden Städte wider. Im Hinblick auf die langfristige Entwicklung ist davon auszugehen, dass auch dieser Bereich dichter werden wird. Die zweite regionale Entwicklungsachse, die von Třinec über Český Těšín, Ostrava, Opava mit einer engeren Verbindung zu Krnov verläuft, wird durch die langfristige Entwicklung der Siedlungsstruktur beeinflusst und es ist anzunehmen, dass ihre Bedeutung für die Mährisch-Schlesische Region entscheidend bleiben wird. Diese Verbindung zwischen Ostrava und Opava wird nach der Modernisierung und dem Ausbau der Straße I/11, einschließlich der Fertigstellung der Nordumfahrung von Opava, verstärkt. Nach der Modernisierung der I/11, des östlichen Teils von Třinec bis Jablunkov mit einem Anschluss an das Kapazitätsstraßennetz nach Žilina, ist die Entwicklung der Siedlungen innerhalb der Entwicklungsachse Ostrava - Třinec - tschechisch-slowakische Grenze zu erwarten. Die Bedeutung der lokalen Entwicklungsachse Ostrava - Karviná sinkt aufgrund des Rückgangs der Arbeitsplätze und der Anzahl der Menschen in Karviná. Wenn die Verbindung von Karviná nach Bielsko-Biała nicht fertiggestellt wird, wird diese Achse schwächer werden. Im Gegensatz dazu wird sich die Achse Ostrava - Český Těšín - Bielsko-Biała entwickeln. Die Rolle der starken Städte und ihre Zusammenarbeit ist für die weitere Entwicklung des Gebietes entscheidend.
Der Prozess der Suburbanisierung auf dem Gebiet von Tschechisch-Schlesien wird als Verlagerung von städtischen Funktionen (d.h. Industrie, Dienstleistungen, Wohnen usw.) und der Bevölkerung aus den Kernbereichen der Siedlungen in die angrenzenden peripheren Randgebiete verstanden. Es handelt sich um den Prozess der Ausdehnung der bebauten Fläche der Stadt, der sowohl in den meisten Städten der entwickelten Länder als auch in der historischen Entwicklung unserer Städte zu beobachten ist. Die Suburbanisierung bildet zusammen mit der Urbanisierung und der Reurbanisierung ein Trio von dynamischen Prozessen, mit denen das Energiesystem auf die Bedürfnisse der Gesellschaft und deren Veränderungen reagiert. Von Suburbanisierung kann man spätestens seit dem 18. Jahrhundert sprechen, als einerseits die Industrialisierung die Lebensbedingungen in den Siedlungskernen verschlechterte und andererseits der Schienenverkehr und später das Automobil die Mobilität der Bewohner verbesserte - die Folge war eine Abwanderung derjenigen, die es sich leisten konnten, in die an die Stadtränder angrenzenden ländlichen Gebiete, wo ihnen bessere Lebensbedingungen geboten wurden und von wo aus sie gleichzeitig den Anschluss an die beruflichen und sozialen Möglichkeiten, die mit dem Leben im Kernbereich der Stadt verbunden sind, nicht verlieren. Gegenwärtig wirken alle drei genannten dynamischen Prozesse in der Siedlung zusammen, nur die Intensität jedes einzelnen von ihnen ändert sich im Laufe der Zeit und damit in der Summe auch die resultierende Richtung ihrer Wirkung auf die Siedlung. Die Wohnsuburbanisierung manifestiert sich vor allem durch den Bau neuer Wohnungen im Umland der Stadt und die allmähliche Abwanderung von Menschen aus den Kernbereichen größerer Städte in neue Einfamilienhäuser (und neuerdings auch Mehrfamilienhäuser) in Randgebieten oder in benachbarten Dörfern.
Der größte Einfluss auf die derzeitige Landschaft, wie er während der Arbeiten auf dem ATLAS festgestellt wurde, ist das starke Aufkommen des Borkenkäfers, dessen Ursachen auf die Etablierung von Fichtenwäldern vor 1938, sowie die derzeitige fragmentierte Eigentumsstruktur und den Klimawandel zurückzuführen sind. Ein weiteres negatives Phänomen sind Sturzfluten und Erdrutsche (vor allem in der Region der Beskiden). Von der traditionellen Landwirtschaft über die Kollektivierung bis zur heutigen Ökonomisierung (z.B. nur noch Mais- und Rapsanbau). Eine weitere Folge der Ökonomisierung ist, dass es für die Landwirte wichtiger ist, eine Biogasanlage mit Biomasse zu füllen, als diese als Viehfutter zu verwenden, was zu negativen Auswirkungen des einseitigen Anbaus auf die Biodiversität führt. Ein weiteres großes Thema ist die Austrocknung der Landschaft und ihre Auswirkungen. Das aktuelle Klima entspricht dem Ende des Interglazials: Zwei Jahreszeiten mit extremen Wetterschwankungen wechseln sich ab. Unter den ausgewählten Naturextremen und ihren Auswirkungen auf die Landschaft wurden Überschwemmungen, Dürren, starke Winde (Tornado in Krnov), Hagelstürme, geomorphologische Extreme (siehe Erdrutsche, Steinschlag) genannt. Ein Dauerthema, vor allem in der Region Ostrava, ist die Luftverschmutzung, die hauptsächlich aus dem Tschechisch-Polnischen Becken kommt (lokale Heizwerke werden angesprochen). Auch invasive Pflanzen- und Tierarten sind hier zu finden. Modelle und Vorhersagen am Beispiel ausgewählter invasiver Pflanzen bilden auch Fachkarten.
Zu den Megatrends der Globalisierung, die die Zukunft des Territoriums von Tschechisch-Schlesien beeinflussen, gehören auch Zivilisationskrankheiten, wo bisher unbekannte Krankheiten, die durch verschiedene Faktoren der modernen Zivilisation verursacht werden, auf dem Vormarsch sind. Ihre Zunahme ist auf einen veränderten Lebensstil, veränderte Ernährungsgewohnheiten, die Exposition der Bevölkerung gegenüber neuen chemischen Stoffen und allgemein auf eine höhere Lebenserwartung und ein höheres Durchschnittsalter der Bevölkerung zurückzuführen. So wird sich zum Beispiel die gesellschaftliche Wahrnehmung des Alters verändern. Die Städte entwickeln Programme für aktives Altern, Projekte zur Vorbereitung auf das Alter und zur Veränderung der Wohnsituation. Insbesondere der Verzehr von industriell hergestellten kalorienhaltigen Lebensmitteln, übermäßiger Nahrungs-, Alkohol- und Zigarettenkonsum, übermäßiger und anhaltender Stress sowie Bewegungsmangel gelten als Ursachen für Zivilisationskrankheiten. Der wachsende Individualismus und die Macht des Einzelnen stellen einen starken Trend des zunehmenden Einflusses des Einzelnen oder kleiner Gruppen auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entscheidungsprozesse sowie gegenüber der Gesellschaft und wirtschaftlichen Akteuren dar. Verstärkt wird dieser Trend durch die zunehmende Bildung der Bevölkerung, das Drängen auf unveräußerliche Menschenrechte, die Ausweitung individueller Freiheiten und neue Technologien. Die hohe Mobilität ermöglicht die globale Vernetzung von Konsum- und Produktionsmustern, neue Arbeitsweisen sowie soziale Kontakte und Interaktionen. Dieser starke Trend beeinflusst auch die Aufhebung von Barrieren für den Verkehr von Menschen, Gütern und Informationen. Die Mobilität beinhaltet nicht nur die Bewegung von Menschen, Materialien und Gütern, sondern auch Umwelt- und Sozialbelastungen. Trotz des Wachstums der Mittelschicht nehmen die Einkommensunterschiede weiter zu, und die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern werden trotz ihres konvergierenden Trends immer noch nicht beseitigt. Auch die wachsende Schulden- und Technologielücke zwischen den Ärmsten und den Reichsten ist ein starker Trend.
Zu den Megatrends der Globalisierung, die die Zukunft des Territoriums von Tschechisch-Schlesien beeinflussen, gehören auch Zivilisationskrankheiten, wo bisher unbekannte Krankheiten, die durch verschiedene Faktoren der modernen Zivilisation verursacht werden, auf dem Vormarsch sind. Ihre Zunahme ist auf einen veränderten Lebensstil, veränderte Ernährungsgewohnheiten, die Exposition der Bevölkerung gegenüber neuen chemischen Stoffen und allgemein auf eine höhere Lebenserwartung und ein höheres Durchschnittsalter der Bevölkerung zurückzuführen. So wird sich zum Beispiel die gesellschaftliche Wahrnehmung des Alters verändern. Die Städte entwickeln Programme für aktives Altern, Projekte zur Vorbereitung auf das Alter und zur Veränderung der Wohnsituation. Insbesondere der Verzehr von industriell hergestellten kalorienhaltigen Lebensmitteln, übermäßiger Nahrungs-, Alkohol- und Zigarettenkonsum, übermäßiger und anhaltender Stress sowie Bewegungsmangel gelten als Ursachen für Zivilisationskrankheiten. Der wachsende Individualismus und die Macht des Einzelnen stellen einen starken Trend des zunehmenden Einflusses des Einzelnen oder kleiner Gruppen auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entscheidungsprozesse sowie gegenüber der Gesellschaft und wirtschaftlichen Akteuren dar. Verstärkt wird dieser Trend durch die zunehmende Bildung der Bevölkerung, das Drängen auf unveräußerliche Menschenrechte, die Ausweitung individueller Freiheiten und neue Technologien. Die hohe Mobilität ermöglicht die globale Vernetzung von Konsum- und Produktionsmustern, neue Arbeitsweisen sowie soziale Kontakte und Interaktionen. Dieser starke Trend beeinflusst auch die Aufhebung von Barrieren für den Verkehr von Menschen, Gütern und Informationen. Die Mobilität beinhaltet nicht nur die Bewegung von Menschen, Materialien und Gütern, sondern auch Umwelt- und Sozialbelastungen. Trotz des Wachstums der Mittelschicht nehmen die Einkommensunterschiede weiter zu, und die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern werden trotz ihres konvergierenden Trends immer noch nicht beseitigt. Auch die wachsende Schulden- und Technologielücke zwischen den Ärmsten und den Reichsten ist ein starker Trend.
Zusammenfassung
Der Atlas konzentriert sich auf die Erforschung des Abdrucks des historischen Gedächtnisses des Schlesiens, der in der Siedlungsstruktur, in der Landschaft und in der kreativen menschlichen Tätigkeit immer noch markant ist sowieso auch in den Köpfen der Menschen, die in diesem Gebiet leben, ihre Bräuche, Werte und Kultur. Der Atlas des tschechischen Schlesiens wurde von einem multidisziplinären Expertenteam aus den Bereichen Geschichte, Demographie, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft, Städtebau und Naturwissenschaften geschrieben. Die Synthese von Fachkenntnissen, die im Atlas benutzerfreundlich interpretiert wird, hat einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des Gebietes geschaffen, das in Mitteleuropa häufig großen historischen Veränderungen ausgesetzt wurde. Alle diese Ereignisse hatten großen Einfluss auf das historische Gedächtnis der hier lebenden Einwohner, auf die Wahrnehmung ihrer Identität mit dem Territorium und auf die soziokulturelle Entwicklung. Der Atlas besteht aus einer Sammlung von kommentierten Karten, die das Gebiet des tschechischen Schlesiens in sieben Abschnitten darstellen und sich mit der Physische Geographie, Historische Geographie, Demographie, soziokulturelle Entwicklung, den wirtschaftlichen Prozessen, Landschaftsentwicklung und der Identität der Bewohner des Gebiets befassen. Neben historischen und geografischen Informationen beschäftigten sich Experten auch mit den soziologischen Konzepten von Identität und Kultur. Soziologische Informationen über die Bewohner des analysierten Gebiets wurden durch eine umfassende quantitative Untersuchung einer Stichprobe der Bevölkerung (3.000 Befragte) erhalten. Diese Untersuchung wurde durch eine qualitative Umfrage in Form von 10 Gruppendiskussionen in fünf Bereichen des analysierten Gebiets vertieft. Die Informationen sind im siebten Abschnitt des Atlas enthalten. Das Hauptziel des Atlas ist die Identifikation der historischen Prozesse, die die Bevölkerung und die Landschaft von 1848 bis heute beeinflusst haben. Auf dem Territorium des tschechischen Schlesiens und des territorial verwandten "Mährischen Keil" wurden die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Landschaft, Landschaftsmanagement (Geschichte der Forstwirtschaft, Landwirtschaft) und andere Prozesse auf dem Territorium (Einfluss des Bergbaus, historische Kriege) beschrieben. Es wird die Kausalität der Entwicklung der territorialen, regionalen, nationalen und kulturellen Identität untersucht und erklärt, einschließlich der Entwicklung der Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Lebensqualität und ihrer Wahrnehmung der Landschaft. Kartografische Daten erklären die langfristigen wirtschaftlichen und soziodemografischen Prozesse, einschließlich der Entwicklung der Siedlungsstruktur. Durch die umfassende Forschung der Besonderheiten der Entwicklung der Kulturlandschaft, die dramatische Veränderungen ausgesetzt wurde, werden auch Spuren von Ereignissen in der Landschaft identifiziert und die Veränderungen dokumentiert, die in der Region stattgefunden haben. Die multidisziplinäre Einstellung zum Atlas ermöglichte das umfassende Verständnis der Landschaft und der sozioökonomischen Aktivitäten und erweiterte auch die Möglichkeiten historischer Museumspräsentationen um Ansichten nach einzelner wissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Disziplinen, die die gegenseitigen historischen und aktuellen Einflüsse der Bevölkerung auf die Landschaft und Siedlungen erklären.
VERWENDETE LITERATUR
ABT, Lukáš, 2007. Atlas jesenických pramenů a jiných drobných památek. Hnutí Brontosaurus Jeseníky. Jeseník. ISBN 978-80-239-8935-9
ADAMUS, Alois, 1935. Dějiny novinářství na Ostravsku v přehledu. Moravská Ostrava.
AL SAHEB, Jan, 2007. Povýšení olomoucké církevní provincie na arcidiecézi roku 1777. Studia Comeniana et historica. 32(77–78), s. 132–145. ISSN 0323-2220.
AL SAHEB, Jan, 2011. K některým aspektům pobělohorské rekatolizace opavského knížectví. In: JIRÁSEK, Zdeněk a kol.: Církevní dějiny Slezska 18. až 20. století. Opava, s. 103–117.
ANDĚRA, Miloš, GAISLER, Jiří, 2012. Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochra-na. Nakladatelství Academia. Praha. ISBN 9788020029942
ANDĚRA, Miloš, HORÁČEK, Ivan, 2005. Poznáváme naše savce. Nakladatelství Sobotáles. Praha. ISBN 8086817083
ANONYM, 1781. Catalogus Petrino-Sarcandrinus. Deinde vero archi-presbyteratus, decantus, parochias, administraturas, capellanias, & cooperaturas locales in hac alma dioecesi archi-episcopali Olomucena existentes. Olomucii.
ANONYM, 1808. Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis almae dioecesis Wratislaviensis Austriacae ditionis 1807. Teschinii.
ANONYM, 1914. Handbuch des Bistums Breslau und Delegatur-Bezirks für das Jahr 1914. Breslau.
ANONYM, 1924. BEVÖLKERUNG Slezska a Hlučínska v několika důležitějších směrech na základě sčítání lidu ze dne 15. února 1921 se zvláštním ohledem na předešlá sčítání lidu. S dodatkem / Die Bevölkerung Schlesiens und des Hultschiner Gebietes in einigen wichtigeren Beziehungen auf Grund der Volkszählung vom 15. Februar 1921 mit besonderer Berücksichtigung der vorhergegangenen Volkszählungen. Mit einem Anhang. Opava.
ANONYM, 1929. Historisch-statistische Übersicht über die Verwaltungsbehörden, Anstalten und Seelsorgstellen des Bistums. Real-Handbuch des Bistums Breslau. Breslau.
ANONYM, 1968. Apoštolská administratura v Českém Těšíně. Stav k 1. prosinci 1968. Český Těšín.
BAKALA, Jaroslav a kol., 1992. Slezsko. Opava: Matice slezská.
BALATKOVÁ, Jitka, 2003. Organizační vývoj československé církve (husitské) na Moravě a ve Slezsku. In: KORDIOVSKÝ, Emil a JAN, Libor (eds.): Vývoj církevní správy na Moravě. Brno, s. 227–241. XXVII. Mikulovské sympozium.
BAŁATROWICZ, Piotr, 2004. Biskup Franciszek Śniegoń w służbie Kościoła. In: BUDNIAK, Józef a MOZOR, Karol (eds.). Kształtowanie tożsamości religijnej i kulturowej na Śląsku Cieszyńskim w latach działalności Książęco-Biskupiego Wikariatu Generalnego Księstwa Cieszyńskiego (1770–1925). Cieszyn, s. 69–79.
BALCAR, Lubomír a kol. (eds.). 1969. Církev v proměnách času. Sborník k 50. výročí spojení českobratrské církve evangelické. Praha.
BARÁNEK, Daniel, 2015. Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci. Praha. Fontes, 15.
BARCUCH, Antonín, 2005. Počátky československé církve (husitské) v Radvanicích. Těšínsko. 48(3), s. 20–23.
BARCUCH, Antonín, ROHLOVÁ, Eva, 2001. Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 20. Ostrava, s. 270–303. ISBN 80-86101-41-X
BARTOŠ, Josef a kol., 1966. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. I. Územně správní vývoj státních a společenských institucí a organizací na Moravě a ve Slezsku v letech 1848–1960. Ostrava.
BARUŠ, Vlastimil a kol., 1989. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. Díl 2. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci. Státní zemědělské nakladatelství. Praha. ISBN 07-029-89
BEK, Pavel a kol., 2018. Historie státních drah 1918–2018. Praha: České dráhy, a. s. ISBN 978-80-8510-427-1.
BERGER, Józef, 1930. Ewangelicki zbór cieszyński po podziale Śląska w r. 1920. Czeski Cieszyn.
BEZDÍČEK, Josef, 1936. Silniční síť v obvodu technického referátu v Novém Jičíně. In: Technická práce na Ostravsku 1926–1936, s. 533–535.
BIAŁY, Franciszek, Biały, Lucyna (eds.), 2008. Periodyki śląskie od XV wieku do 1945 roku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN: 978-83-229-3041-0.
BIERMANN, Bogumił, 1859. Historya wiary ewangielickiéj w Ślązku austryackém, z osobliwym względem na dzieje ewangielickiego kościoła z laski danego przed Cieszynem. Pamiętnik ku 150letniemu jubileuszowi ewangielickiego kościoła Jezusowego przed Cieszynem. Cieszyn.
BÍLEK, Jiří, 2011. Kyselá těšínská jablíčka: československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945. Praha: Epocha. ISBN 978-80-7425-097-2.
BÍNA, Jan, DEMEK, Jaromír, 2012. Z nížin do hor. Geomorfologické jednotky České republiky. Academia, Praha. ISBN 978-80-200-2026-0
BLAHUT, Alois, 1977. Z historie letectví na Ostravsku a na památku bratří Žurovcových z Hartů na Novojičínsku, průkopníků letectví. Praha.
BOLTON, Jonathan, 2015. Světy disentu. Charta 77, Plastic People of Universe a česká kultura za komunismu. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2462-6.
BORÁK, Mečislav a kol., 2016. Ivančena: kamenné svědectví hrdinství a odvahy. Český Těšín: Muzeum Těšínska. ISBN 978-80-86696-43-0.
BORÁK, Mečislav, 1984. Zločin v Životicích. Ostrava: Profil.
BORÁK, Mečislav, 1997. Zábor Těšínska v říjnu 1938 a první fáze delimitace hranic mezi Československem a Polskem (výběr dokumentů). Časopis Slezského zemského muzea, série B. 46(3), 206–248. ISSN 0323-0678.
BORÁK, Mečislav, 2000. Druhá fáze delimitace hranic mezi Československem a Polskem na Těšínsku v listopadu 1938 (výběr dokumentů). Časopis Slezského zemského muzea, série B. 49(1), 51–94. ISSN 0323-0678.
BORÁK, Mečislav, 2003. Oskar Schindler ve službách abwehru na Ostravsku. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 21. Šenov u Ostravy: Tilia, s. 240–262. ISBN 80-86101-77-0.
BORÁK, Mečislav, ed., 1998. Slezsko v dějinách českého státu. Opava: Slezský ústav SZM. ISBN 80-86101-18-5.
BORÁK, Mečislav, GAWRECKI, Dan (eds.), 1992. Nástin dějin Těšínska. Ostrava – Praha: Advertis.
BORÁK, Mečislav. 1984. Zločin v Životicích. Ostrava.
BRÁZDIL, Rudolf a kol., 2007. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slez-sku. Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. 432 s. ISBN 978-80-210-4173-8.
BRŇOVJÁK, Jiří, 2018. Šlechtická společnost rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740–1918). In: JEŽ, Radim a PINDUR, David (eds.). Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska // Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Český Těšín: Muzeum Těšínska, s. 57–96. Cieszyńskie studia muzealne 6 // Těšínský muzejní sborník 6. ISBN 978-80-86696-47-8.
BROŽ, Miroslav (ed.), 2002. Církev v proměnách času 1969–1999. Sborník Českobratrské církve evangelické. Praha.
BUBÍK, Pavel a kol., 2010. 100-lecie Związku Stanowczych Chrześcijan / 100. výročí Svazu rozhodných křesťanů. Cieszyn: Wydawnictvo Arka. ISBN 978-83-924755-6-9.
BUHL, Paul, 1973. Troppau von A bis Z. Ein Stadtlexikon. München. ISBN 978-37-61200-93-3
CASTLES, S., MILLER, M. J.: The Age Of Migration–International Population Movements in the Modern World. New York, The Guliford Press 1993.
CEKOTA, Vojtěch, 2008. K založení Ostravsko-opavské diecéze. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 34(2), 26–30. ISSN 1213-3140.
CRHOVÁ, Marie, 1995. Židé ve Slezsku. In: Židé a Morava. Sborník z konference konané v říjnu 1994 v Kroměříži. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, s. 43–47. ISBN 80-85945-09-6.
CZUDEK, Tadeáš, 2005. Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Moravské zemské muzeum, Brno. ISBN 80-7028-270-3
ČECHÁK, Vladimír, 2004. Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945–2004). Praha: Vysoká škola finanční a správní. ISBN 80-86754-22-7.
ČERMÁK, Jan, 1971. Zahájení výstavby přehrad v povodí Odry. In: Vodní hospodářství v povodí Odry 1945–1970. Reprezentační sborník. Ostrava, s. 88–96.
ČERMÁK, Jan. Přehrada na Moravici u Kružberka. Ostrava: Povodí Odry, podnik pro provoz a využití vodních toků, 1969. 92 stran.
ČERNÝ, Walter, DRCHAL, Karel, 1997. Ptáci. Aventinum nakladatelství, s.r.o., Praha. ISBN 80-7151-008-4
ČIHAŘ, Jiří, 2003. Naše ryby. Ottovo nakladatelství. Praha. ISBN 80-7181-904-2
ČSÚ (2014) Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu – 2011. Praha: ČSÚ. Dostupné na https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl
D´ELVERT, Christan, (1893). Zur Geschichte des katholischen Clerus in Mähren und Oesterreichischen-Schlesien. Brünn.
DĚDKOVÁ, Libuše a GRŮZA, Antonín, 2004. Zámek v Linhartovech. Průzkumy památek. 11(1), 153–173. ISSN 1212-1487.
DĚDKOVÁ, Libuše, 2000. Dva náhrobníky od sochaře Amanda Strausse. In: Památkový ústav v Ostravě. Výroční zpráva 1999. Ostrava: Památkový ústav v Ostravě, s. 63–65. ISBN 80-85034-18-2.
DOKOUPIL, Lumír, 1977. Struktury populace ostravské aglomerace před první světovou válkou. In: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě 55, řada C-12. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 21–54. Studie k vývoji průmyslových oblastí.
DOKOUPIL, Lumír, 1986. Obyvatelstvo ostravské průmyslové oblasti do sčítání 1869. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
DOKOUPIL, Lumír, MYŠKA, Milan, SVOBODA, Jiří a kol., 2005. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity. ISBN 80-7368-024-6.
DOKOUPIL, Lumír, NESLÁDKOVÁ, Ludmila a LIPOVSKI, Radek, 2014. Populace rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace (od 60. let 19. století do první světové války). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7464-729-1.
DOKOUPIL, Lumír, NESLÁDKOVÁ, Ludmila a LIPOVSKI, Radek, 2020. Demografický vývoj v letech 1869–1914. In: ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. II. díl. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 869–951. ISBN 978-80-7599-133-1.
DUDA, Josef, KRKAVEC, František, 1959. Zelené klenoty – zámecké parky na Hlučínsku a Opavsku. Ostrava.
DUDA, Josef, KŘÍŽ, Zdeněk, 1962. Dřeviny opavských parků a zahrad 1. Časopis Slezského muzea, série A, 11, s. 15–19.
DUNGEL, Jan, GAISLER, Jiří, 2002. Atlas savců České a Slovenské republiky. Nakladatelství Academia. Praha. ISBN 80-200-1026-2
DUNGEL, Jan, HUDEC, Karel, 2001. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Nakladatelství Academia. Praha. ISBN 80-200-0927-2
DUNGEL, Jan, ŘEHÁK, Zdeněk, 2005. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Nakladatelství Academia. Praha. ISBN 80-200-1282-6
DUŠEK, Pavel, 2003. Encyklopedie městské dopravy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri. ISBN 80-7277-159-0.
DVOŘÁK, Jan a kol., 1994. 100 let městské hromadné dopravy v Ostravě. Ostrava: Dopravní podnik města Ostravy.
EICHLER, Karel, 1888. Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rak. Slezsku. I/II. Brno.
FAJMAN, Marek, 2008. Architektura tolerančních modliteben církve augsburského vyznání na území Čech, Moravy a rakouského Slezska do roku 1800. In: MACEK, Ondřej (ed.): Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. Praha, s. 489–518.
FIALOVÁ, Ludmila a kol., 1996. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta. ISBN 80-204-0283-7.
FIEDOR, Jiří, 2007. Bílé vrány v černém kraji. Chartisté a nezávislé iniciativy na Ostravsku. Dějiny a současnost. 29(2), 40–43. ISSN 0418-5129.
FOLDYNOVÁ, Ivana, HRUŠKOVÁ, Andrea, ŠOTKOVSKÝ, Ivan, KUBÁŇ, David a kol. 2018 Socio-ekonomická studie zájmového území. Ostrava: ACCENDO.
FOLTYSOVÁ, Jana, 2021. Opava zvelebí neatraktivní místa. Hláska. Zpravodaj statutárního města Opavy 26 (2), s. 10–11.
FOLTÝN, Dušan a kol., 2005. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha.
FOLWARCZNÁ, Kristýna, 2014. Průmyslová, živnostenská, kulturní a hospodářská výstava Těšínska a Ostravska v Orlové 1926. Ostrava. Diplomová práce. Ostravská univerzita. Filozofická fakulta. Katedra historie.
FROLEC, Václav. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Brno: Blok, 1974. 399 s.
FUKALA, Radek, 2007. Slezsko neznámá země koruny české. České Budějovice, ISBN 978-80-86829-23-4.
GABRIELOVÁ, Petra, 2009. Historie rozhodných křesťanů letničních v dokumentech Státní bezpečnosti (70. a 80. léta 20. století). Sborník Archivu bezpečnostních složek. 7, s. 113–121.
GAISLER, Jiří, ZIMA, Jan, 2007. Ekologická nika. In: Zoologie obratlovců. Nakladatelství Academia. Praha, s. 154 – 158. ISBN 978-80-200-1484-9
GALOS, Adam, 1992. Kardynał Kopp – postać fascynująca i kontrowesyjna. In: Matwijowski, Krystin (ed.): Ludzie śląskiego Kościoła katolickiego. Wrocław, s. 53–59.
GARBA, Karel, 1974. Úzkorozchodné dráhy na Ostravsku 1902–1973. I. a II. díl. Brno: Technické muzeum v Brně.
GARBA, Karel, 1990. Dopravní spojení Hlučínska s Ostravskem. Ostrava: Dopravní podnik města Ostravy.
GAWRECKÁ, Marie, 2002. Němci ve Slezsku 1918 - 1938. Opava, ISBN 80-86458-10-5.
GAWRECKÁ, Marie, 2004. Československé Slezsko mezi světovými válkami 1918 – 1938. Opava, ISBN 80-7248-233-5.
GAWRECKI, Dan a kol., 2003. Dějiny českého Slezska 1740–2000. Opava: Slezská univerzita v Opavě. ISBN 80-7248-226-2.
GAWRECKI, Dan, 1999. Politické a národnostní poměry v těšínském Slezsku 1918–1938. Český Těšín: Muzeum Těšínska. Studie o Těšínsku, 15. ISBN 80-902355-4-9.
GAWRECKI, Dan, 2000. Der schlesische Landtag. In: WANDRUSZKA, Adam a URBANITSCH, Peter (Hrsg.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band 7, Teilband 2. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 2105–2130. ISBN 3-7001-2871-1.
GAWRECKI, Dan, 2000. Pokusy o zřízení biskupství v Opavě. In: Opava. Sborník k dějinám města, 2. Kravaře: AVE Centrum Kravaře, s. 45–48. ISBN 80-86268-02-0.
GAWRECKI, Dan, 2002. Slezsko, územní vymezení, pojmy, úvahy. Vlastivědné listy, č. 1, s. 1–5. č. 2, s. 1–4.
GAWRECKI, Dan, 2003b. Slezský zemský sněm a otázka zřízení biskupství v Opavě v letech 1866–1868. In: KORDIOVSKÝ, Emil a JAN, Libor (eds.): Vývoj církevní správy na Moravě. Brno, s. 141–149. XXVII. Mikulovské sympozium.
GEBAUER, Josef, 1992. Hnojník a Beesové. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 18(1), 19–21. ISSN 1213-3140.
GOJNICZEK, Wacław a KACZMAREK, Ryszard (eds.), 2017. 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku. Katowice.
GOSS, J. D. a LINDQUIST, B.: Conceptualizing International Labor Migration: A Structuration Perspective. International Migration Review, Summer 1995, 29(2), 317–351.
GRIM, Tomáš, 2014. Vývoj státních hranic v Českém Slezsku. In: Opava. Sborník k dějinám města, 8. Opava: Statutární město Opava ve spolupráci s Maticí slezskou, s. 16–22. ISBN 978-80-86887-20-3.
GROBELNÝ, Andělín, 1985. Heinrich Jöckel ve Skrochovicích na Opavsku na podzim 1939. In: Terezínské listy 14. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, s. 20–37.
GROF, Leopold, 1994. Kročeje ostravskou železniční historií: v obvodu bývalého provozního oddílu ČSD Ostrava 1847–1990. Ostrava: APEX.
GRÖSCHEL, Bernhard, 1993. Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945. Dokumentation und Strukturbeschreibung. Berlin: Gebr. Mann. Schriften der Stiftung Haus Oberschlesien, 4. ISBN 978-3786116691.
GRŮZA, Antonín, 2004. Osudy slezskoostravského hradu v 19. století. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, s. 50–65. ISBN 80-85034-30-1.
HALBWACHS, Maurice, 2009. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, ISBN 978-80-7419-016-3.
HAMPL, M. (2005) Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
HAMPLOVÁ, D. (2010) Česká religiozita – církevní příslušnost a víra ve světle Sčítání lidu a dat ISSP 2008. NAŠE SPOLEČNOST číslo 1 roč. 2010
HAMZA, Pavel, 2005. 30. duben 1945 u Říšského mostu v centru Ostravy aneb Opravdu Miloš Sýkora? In: Ostrava 22. s. 250–271. ISBN 80-86904-05-9.
HANIČÁK, Ondřej, KOLÁŘ, Ondřej, ed., 2017. 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku. Opava, ISBN 978-80-86887-24-1.
HAVLÍČEK, T. – Klingorová, K. – Lysák, J. Atlas náboženství Česka: The atlas of religions in Czechia. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3794-5.
HELLER, Michał, 2000. Zmiany w strukturach organizacyjnych Kościołów katolickiego i ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim (1918–1937). In: Chmiel, Peter a Drabina, Jan (eds.): Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien von Mittelater bis zur Gegenwart / Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności. Ratingen: Stiftung Haus Oberschlesien, s. 203–214. Tagungsreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 9. ISBN 83-908802-3-7.
HERMAN, Gustav a SVOBODA, Josef, 1928. Československé silnice. Jejich zlepšení ze silničního fondu. Praha: Ministerstvo veřejných prací.
HERNOVÁ, Šárka, 1968. Demografická charakteristika Slováků, Poláků a Němců podle výsledků sčítání lidu z let 1950 a 1961. Slezský sborník. 66(3), 289–309. ISSN 0037-6833.
HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. a kol., 2009. Kulturní regiony a geografie kultury. Praha: ASPI, a.s., ISBN 978-80-7357-339-3.
Historie Československé státní automobilové dopravy, n. p. Ostrava, nositele státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“, 1949–1980. Ostrava: ČSAD. Interní tisk.
HLAVAČKA, Milan, Marès, Antoin, 2011. Paměť míst, událostí a osobností. Historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav, ISBN 978-80.7286-186-6.
HOMAN, Aleš, 2003. Moravská Ostrava jako útočiště uprchlíků z německého a polského záboru na podzim roku 1938. In: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 21. Šenov u Ostravy: Tilia, s. 221–239. ISBN 80-86101-77-0.
HOMOLA, Irena, 1968. Tygodnik Cieszyński i Gwiazdka Cieszyńska pod redakcją Pawła Stalmacha 1848–1887. Katowice: Państwowe Wydawn. Naukowe.
HONS, Josef, 1975. Dejiny dopravy na území ČSSR. Bratislava: Alfa. Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry.
HORSKÁ, Pavla a kol., 1990. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha: Panorama. ISBN 80-7038-011-X.
HRUŠKA Lubor a kol. Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje. (s textovým rozborem) Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., 2012. ISBN: 978-80-904810-6-0.
HRUŠKA, L.; HRUŠKOVÁ, A.; ŠLACHTOVÁ, H.; BUJOK, P.; KUBÁŇ, D. a kol. Epidemiologická studie zájmového území. Ostrava: ACCENDO, 2018.
HRUŠKA-TVRDÝ Lubor. Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů: Pohled prostorové sociologie s využitím multikriteriálních analýz. 1. vyd. Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-904810-4-6. 318 s.
HUBÁČEK, Adam a KOLÁŘ, František, 2016. Oderský zámek. Zaniklý klenot města. Odry: Muzeum Oderska. ISBN 978-80-270-0849-0.
HURT, Rudolf, 1960. Dějiny rybníkářství na Moravě a ve Slezsku, díl 1. a 2. Krajské nakladatelství Ostrava.
HŮRSKÝ, Josef, 1979. Osobní doprava ve Slezsku v letech 1850–1889 (ve srovnání s Moravou). Slezský sborník. 77(3), 199–210. ISSN 0037-6833.
HŮRSKÝ, Josef, 1983. Vývoj dopravního zpřístupnění slezských měst před první světovou válkou. Slezský sborník. 81(3), 196–210. ISSN 0037-6833.
CHLEBEK, Karel, 2014. 100 let služby Moravskoslezského sdružení. Ostrava.
CHROMCOVÁ, Gabriela, 2004. Noviny Těšínské 1894–2004. Český Těšín: Město Český Těšín – Městský úřad Český Těšín, Odbor školství a kultury ve spolupráci s Muzeem Těšínska. ISBN 80-254-0078-6.
CHROMÝ, Pavel, 2009. Region a regionalismus, Geografické rozhledy, 19 (1), 2-5.
CHYTRÝ, Milan et al., 2010. Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-03-0
INDRA, Bohumír, 1996. Přestavba starého a stavba nového zámku ve Velkých Heralticích koncem 17. a 18. století. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 45(1), 1–15. ISSN 0323-0678.
IVÁNEK, Jakub, Smolka, Zdeněk (eds.), 2013. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. 2. vydání. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7464-385-9.
IZYDORCZYK, Fabiana a SPYRA, Janusz, 2002. Dzieje Miłosierdzia. Zgromadzenie Siostr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Cieszynie (1876–2001). Kraków.
JAKL, Tomáš, 2004. Květen 1945 v českých zemích: pozemní operace vojsk Osy a Spojenců. Praha: Miroslav Bílý. ISBN 80-86524-07-8.
JANÁK, Jan, 1990. Moravská a slezská správa a samospráva v letech 1740 až 1948. Vlastivědný věstník moravský. 42(3), s. 338–356. ISSN 0323-2581.
JANČUROVÁ, Jaroslava, 1967. Vliv migračních pohybů obyvatelstva v letech 1960-1964 na populační situaci v Severomoravském kraji. Slezský sborník. 65(2), 145–170. ISSN 0037-6833.
JANKOWIAK, Stanisław, 2002. Śląsk Cieszyński w stosunkach polsko-czechosłowackich po II wojnie światowej. In: Czubiński, Antoni (ed.). Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 577–587. ISBN 978-8323212065.
JANOSCH, Hermann, 1930. Das Hultschiner Ländchen. Ratibor.
JEMELKA, Martin a Štofaník, Jakub, 2020. Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938). Praha.
JEMELKA, Martin, 2014. Ostrava duchovním a náboženským centrem republiky československé? Studia historica brunensia. 61(2), s. 230–232.
JEMELKA, Martin, 2018. Mezi národem, konfesí a třídou: pluralita náboženských kultur meziválečného Slezska. In: KOLÁŘ, Ondřej a kol.: Slezsko a Ostravsko v Masarykově republice. Opava: Slezské zemské muzeum, s. 37–47. ISBN 978-80-87789-51-3.
JINDRA, Martin a Sladkowski, Marcel (eds.), 2020. Biografický slovník Církve československé husitské. Praha.
JINDRA, Martin, 2017. Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. Praha: ÚSTR, Církev československá husitská. ISBN 978-80-87912-80-5.
JIRÁSEK, Zdeněk, 1991. Slezská idea v poválečném Československu. Časopis Slezského zemského muzea, série B, 40, s. 185–191.
JIRÁSEK, Zdeněk, 2014. "Ocelová koncepce" hospodářství českých zemí 1947-1953. Opava: Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7510-116-7.
JIŘÍK, Karel a kol., 1993. Dějiny Ostravy. Ostrava: Sfinga. ISBN 80-85491-39-7.
KACZMARCZYK, Stanislav a kol., 2005. Křesťanské společenství na Těšínsku. Český Těšín.
KADLEC, Petr a kol., 2016: Národnostní statistika v českých zemích 1880–1930. Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. II. díl. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7422-551-2.
KADLEC, Petr, 2013. Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7464-253-1.
KALETA, Jan a kol., 1981. Církev bratrská na Těšínsku. In: Košťál, Miloslav a kol.: Sto let ve službě evangelia (1880–1980). Jubilejní sborník Církve bratrské. Praha, s. 145–152.
KAMIŃSKI, Marek, 2004. Konflikt polsko-czeski 1918–1921. Warszawa: Instytut Historii PAN. ISBN 83-88973-05-3.
KÁRNÍKOVÁ, Ludmila, 1965. Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754–1914. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
KASZPER, Roman, Małysz, Bohdan a Szymeczek, Józef. 2009. Poláci na Těšínsku: studijní materiál. Český Těšín.
KILIÁNOVÁ, Gabriela, KOWALSKÁ, Eva a KREKOVIČOVÁ, Eva, ed., 2009. My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: Veda, ISBN 978-80-224-1025-0.
KIRCHNER, Karel, SMOLOVÁ, Irena, 2010. Základy antropogenní geomorfologie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. ISBN 978-80-244-2376-0
KLADIWA, Pavel a kol., 2016. Národnostní statistika v českých zemích 1880–1930. Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. I. díl. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7422-550-5.
KLADIWA, Pavel a POKLUDOVÁ, Andrea, 2012. Hans Kudlich (1823–1917): cesta života a mýtu. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7464-159-6.
KLADIWA, Pavel, POKLUDOVÁ, Andrea, KAFKOVÁ, Renata, 2008. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850 – 1914. Díl II./1. Ostrava. ISBN 978-80-7368-595-9
KLADIWA, Pavel et. al, 2016. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. 1. Praha
KLADIWA, Pavel, 2015. Smýšlením Němci, statisticky Češi. Národnostní klasifikace na meziválečném Hlučínsku. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 64(1), 21–34. ISSN 0323-0678.
KLADIWA, Pavel, POKLUDOVÁ, Andrea a KAFKOVÁ, Renáta, 2008. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914. Díl II. Sv. 1. Muži z radnice. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7368-595-9.
KLADIWA, Pavel, POKLUDOVÁ, Andrea a KAFKOVÁ, Renáta, 2009. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914. Díl II. Sv. 2. Budování infrastruktury. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7368-738-0.
KNAPÍK, Jiří, 2003. Slezský ústav v Praze a vědecký výzkum Slezska v letech 1945-1950. Práce z dějin vědy. sv.6, Praha, s. 475-548.
KNAPÍK, Jiří, 2004. Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958: proměny vědeckého pracoviště v regionu. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Práce z dějin vědy, sv. 15. ISBN 80-86103-80-3.
KNAPÍK, Jiří, JIRÁSEK, Zdeněk, 2010. Nechtěné Slezsko. Reflexe českého „slezanství“ v poválečném Československu (1945-1969). Soudobé dějiny, č. 3, s. 421-440.
KNAPÍKOVÁ, Jaromíra, 2007. Matice opavská. Spolek osobnosti a národní snahy ve Slezsku 1877-1948. Opava, ISBN:978-80-86887-08-1.
KOLÁŘ, Ondřej, 2017. K vnímání „nepřítele“ a „osvoboditele“ v bojích jara 1945 v paměti českého obyvatelstva Slezska a Ostravska. Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy. 8(2), 183–196. ISSN 1803-7550.
KOLÁŘOVÁ, Eva, 2004. Státní zámek Hradec nad Moravicí. Vývojové polohy exteriérů a interiérů se zvláštním zaměřením na 19. století. Východiska a výsledky dosavadní památkové obnovy. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, s. 21–37. ISBN 80-85034-30-1.
KOLÁŘOVÁ, Eva, 2009. Příběh zámku a mauzolea knížat Lichnovských v Chuchelné a vzájemné vazby na zámek Hradec. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, s. 61–84. ISBN 978-80-85034-55-4.
KOLÁŘOVÁ, Eva, 2015. Příběh raduňského zámku. Kroměříž: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87231-28-9.
KOLÁŘOVÁ, Ivana a KOLÁŘ, Ondřej, 2020. Československé četnictvo a policie ve sporu o Těšínsko (1918–1920). Praha: Academia. ISBN 978-80-200-3140-2.
KOLATSCHEK, Julius A., 1869. Die evangelische Kirche Oesterreichs in den deutsch-slavischen Ländern. Wien.
Kolektiv autorů, 2013. Ostravsko-opavská operace v paměti českých veteránů. Montanex. Ostra-va. ISBN 9788072253845
KOLEKTIV, 2008. Ostravský oblastní vodovod 1958–2008. Ostrava.
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. [online]. Dostupné na: https://ma21.msk.cz/cz/doprava/koncepce-rozvoje-dopravni-infrastruktury-40486/ [cit. dne 30. 1. 2021].
KOPECKÝ, Milan, 2001. 1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR: tankisté československé zahraniční armády na Východní frontě 1943–1945. Praha: MBI. ISBN 80-86524-00-0.
KORBELÁŘOVÁ, Irena a ŽÁČEK, Rudolf, 2003. Přínos statistických pramenů olomoucké diecéze z předjosefinského období pro historiografii Slezska. In: KORDIOVSKÝ, Emil a JAN, Libor (eds.): Vývoj církevní správy na Moravě. Brno, s. 341–346. XXVII. Mikulovské sympozium 2002.
KOUŘILOVÁ, Markéta a PELC, Martin, 2007. Historický kontext proměn zámku ve Studénce. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 56(1), 59–72. ISSN 0323-0678.
KOVAŘÍK, Petr, 2019. Naše studánky. Pověsti – legendy – místopis. Universum, Praha. ISBN 978-80-242-6303-8
KOŽENÝ, Metoděj, 1936. Silniční síť na Opavsku. In: Technická práce na Ostravsku 1926–1936, s. 531–532.
KRAJÍČEK, L.; Vorel, I., Hruška-Tvrdý, L. a kol. Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje – Návrhová část I.
KRÁL, Martin, IVÁNEK, Jakub a PECHÁČEK, Jiří, 2013. Zámek v Hlavnici. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 39(1), 29–32. ISSN 1213-3140.
KREJČIŘÍK, Mojmír. 2009. Kleinové: historie moravské podnikatelské rodiny. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna. ISBN 978-80-86736-13-6.
KREJSA, František (1986). Katalog olomoucké arcidiecéze za biskupa ThDr. Josefa Vrany. Olomouc.
KŘÍŽ, Zdeněk, 1961. Krajské arboretum v Novém Dvoře u Opavy. Ostrava.
KŘÍŽ, Zdeněk, 1971. Významné parky Severomoravského kraje. Ostrava.
KUBICA, Michal, 2019. Utváření nové hranice Slezska roku 1742 se zřetelem k Těšínskému knížectví. Těšínsko. 62(1), 3–16. ISSN 0139-7605.
KUBÍČEK, Jaromír, 2001. Noviny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918. Brno: Moravská zemská knihovna. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, 39. ISBN 80-7051-133-8.
KUČA, Karel. Oblasti dochovaných strukturálně výrazných plužin v České republice. Zprávy památkové péče, 2014, 74(1), s. 34-49. ISSN 1210-5538.
KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl, Ml-Pan. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 941 s. ISBN 80-85983-12-5.
KUČERA, Rudolf a kol., 2012. Identity v českých zemích 19. a 20. století. Hledaní a proměny, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, ISBN 978-80-86495-98-9.
KUFA, Pavel, 2018. Letní sídlo Larisch-Mönnichů ve Fryštátě. In: JEŽ, Radim a PINDUR, David (eds.). Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska // Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Český Těšín: Muzeum Těšínska, s. 271–286. Cieszyńskie studia muzealne 6 // Těšínský muzejní sborník 6. ISBN 978-80-86696-47-8.
KUPKA, Vladimír a kol., 2006. Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha, Libri. ISBN 978-80-7277-096-0
LARISCH, Jan, 2015. Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace na území ostravsko-opavské diecéze. Ostrava.
LÁZNIČKA, Zdeněk. Půdorys slezských měst. [Opava: Matice moravská], 1945. [19] s.
LÁZNIČKA, Zdeněk. Typy venkovského osídlení v Československu = Tipy derevenskogo rasselenija v Čechoslovakii = Typen des ländlichen Siedlungswesens in der Tschechoslowakei. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956. s. 95–134. Práce Brněnské základny Československé akademie věd = Acta Academiae scientiarum Čechoslovenciae basis Brunensis; 1956: ročník 28.: sešit 3.: spis 338.
LÍDL, Václav a kol., 2009. Silnice a dálnice v České republice. Rudná u Prahy: Agentura Lucie. ISBN 978-80-87138-14-4.
LIPOVSKI, Radek, 2020. Demografický vývoj a národnostní otázka od poloviny 19. století do současnosti. In: Český Těšín 1920–2020. Český Těšín–Ostrava–Třinec: Wart, s. 147–201. ISBN 978-80-905079-7-5.
LOBKOWICZ, František Václav, 2011. Patnáct let existence Diecéze ostravsko-opavské v úvahách a vzpomínkách prvního ostravsko-opavského biskupa. In: ŽÁČEK, Rudolf a kol.: Ostravsko-opavská diecéze. Kořeny a souvislosti. Opava, s. 120–125.
LOKOČ, Radim, DOVALA, Ondřej, PŘASLIČÁK, Miroslav a kol., 2011. Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska. Místní akční skupina Opavsko, Místní akční skupina Rozvoj Krnovska. ISBN 978-80-254-5803-7
LOKOČ, Radim, LOKOČOVÁ, Michaela, 2010. Vývoj krajiny v České republice. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno. ISBN 978-80-904807-3-5
LOKOČ, Radim, TINZOVÁ, Bohumila, DOVALA, Ondřej, 2013. Moravský sladkoplodý jeřáb z Ostružné do světa. Eberesche, Jeseník. ISBN 978-80-260-4725-4
LONDZIN, Józef, 1926. Historja generalnego wikarjatu w Cieszynie. Cieszyn.
LOSOS, Bohumil a kol., 1984. Člověk jako ekologický faktor. In: Ekologie živočichů. Státní pe-dagogické nakladatelství. Praha, s. 281 – 301.
LUKEŠ, Josef, 1913. Obraz Slezska v číslech. Praha: Národní rada česká.
MACEK, Jaroslav, ŽÁČEK, Václav, 1958. Krajská správa v českých zemích a její archivní fondy. Praha Archivní správa ministerstva vnitra ČSR.
MAHEL, Richard, 2002. Stanovení státní hranice ve Slezsku v roce 1742–43 podle materiálů Královského úřadu v Opavě. In: Státní okresní archiv Kroměříž, archivní ročenka, 8. Holešov: Státní okresní archiv Kroměříž, s. 8–55. ISBN 80-239-0334-9.
ADAMUS, Alois, 1935. Dějiny novinářství na Ostravsku v přehledu. Moravská Ostrava.
AL SAHEB, Jan, 2007. Povýšení olomoucké církevní provincie na arcidiecézi roku 1777. Studia Comeniana et historica. 32(77–78), s. 132–145. ISSN 0323-2220.
AL SAHEB, Jan, 2011. K některým aspektům pobělohorské rekatolizace opavského knížectví. In: JIRÁSEK, Zdeněk a kol.: Církevní dějiny Slezska 18. až 20. století. Opava, s. 103–117.
ANDĚRA, Miloš, GAISLER, Jiří, 2012. Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochra-na. Nakladatelství Academia. Praha. ISBN 9788020029942
ANDĚRA, Miloš, HORÁČEK, Ivan, 2005. Poznáváme naše savce. Nakladatelství Sobotáles. Praha. ISBN 8086817083
ANONYM, 1781. Catalogus Petrino-Sarcandrinus. Deinde vero archi-presbyteratus, decantus, parochias, administraturas, capellanias, & cooperaturas locales in hac alma dioecesi archi-episcopali Olomucena existentes. Olomucii.
ANONYM, 1808. Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis almae dioecesis Wratislaviensis Austriacae ditionis 1807. Teschinii.
ANONYM, 1914. Handbuch des Bistums Breslau und Delegatur-Bezirks für das Jahr 1914. Breslau.
ANONYM, 1924. BEVÖLKERUNG Slezska a Hlučínska v několika důležitějších směrech na základě sčítání lidu ze dne 15. února 1921 se zvláštním ohledem na předešlá sčítání lidu. S dodatkem / Die Bevölkerung Schlesiens und des Hultschiner Gebietes in einigen wichtigeren Beziehungen auf Grund der Volkszählung vom 15. Februar 1921 mit besonderer Berücksichtigung der vorhergegangenen Volkszählungen. Mit einem Anhang. Opava.
ANONYM, 1929. Historisch-statistische Übersicht über die Verwaltungsbehörden, Anstalten und Seelsorgstellen des Bistums. Real-Handbuch des Bistums Breslau. Breslau.
ANONYM, 1968. Apoštolská administratura v Českém Těšíně. Stav k 1. prosinci 1968. Český Těšín.
BAKALA, Jaroslav a kol., 1992. Slezsko. Opava: Matice slezská.
BALATKOVÁ, Jitka, 2003. Organizační vývoj československé církve (husitské) na Moravě a ve Slezsku. In: KORDIOVSKÝ, Emil a JAN, Libor (eds.): Vývoj církevní správy na Moravě. Brno, s. 227–241. XXVII. Mikulovské sympozium.
BAŁATROWICZ, Piotr, 2004. Biskup Franciszek Śniegoń w służbie Kościoła. In: BUDNIAK, Józef a MOZOR, Karol (eds.). Kształtowanie tożsamości religijnej i kulturowej na Śląsku Cieszyńskim w latach działalności Książęco-Biskupiego Wikariatu Generalnego Księstwa Cieszyńskiego (1770–1925). Cieszyn, s. 69–79.
BALCAR, Lubomír a kol. (eds.). 1969. Církev v proměnách času. Sborník k 50. výročí spojení českobratrské církve evangelické. Praha.
BARÁNEK, Daniel, 2015. Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci. Praha. Fontes, 15.
BARCUCH, Antonín, 2005. Počátky československé církve (husitské) v Radvanicích. Těšínsko. 48(3), s. 20–23.
BARCUCH, Antonín, ROHLOVÁ, Eva, 2001. Místopis starých Vítkovic. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 20. Ostrava, s. 270–303. ISBN 80-86101-41-X
BARTOŠ, Josef a kol., 1966. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. I. Územně správní vývoj státních a společenských institucí a organizací na Moravě a ve Slezsku v letech 1848–1960. Ostrava.
BARUŠ, Vlastimil a kol., 1989. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. Díl 2. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci. Státní zemědělské nakladatelství. Praha. ISBN 07-029-89
BEK, Pavel a kol., 2018. Historie státních drah 1918–2018. Praha: České dráhy, a. s. ISBN 978-80-8510-427-1.
BERGER, Józef, 1930. Ewangelicki zbór cieszyński po podziale Śląska w r. 1920. Czeski Cieszyn.
BEZDÍČEK, Josef, 1936. Silniční síť v obvodu technického referátu v Novém Jičíně. In: Technická práce na Ostravsku 1926–1936, s. 533–535.
BIAŁY, Franciszek, Biały, Lucyna (eds.), 2008. Periodyki śląskie od XV wieku do 1945 roku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN: 978-83-229-3041-0.
BIERMANN, Bogumił, 1859. Historya wiary ewangielickiéj w Ślązku austryackém, z osobliwym względem na dzieje ewangielickiego kościoła z laski danego przed Cieszynem. Pamiętnik ku 150letniemu jubileuszowi ewangielickiego kościoła Jezusowego przed Cieszynem. Cieszyn.
BÍLEK, Jiří, 2011. Kyselá těšínská jablíčka: československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945. Praha: Epocha. ISBN 978-80-7425-097-2.
BÍNA, Jan, DEMEK, Jaromír, 2012. Z nížin do hor. Geomorfologické jednotky České republiky. Academia, Praha. ISBN 978-80-200-2026-0
BLAHUT, Alois, 1977. Z historie letectví na Ostravsku a na památku bratří Žurovcových z Hartů na Novojičínsku, průkopníků letectví. Praha.
BOLTON, Jonathan, 2015. Světy disentu. Charta 77, Plastic People of Universe a česká kultura za komunismu. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2462-6.
BORÁK, Mečislav a kol., 2016. Ivančena: kamenné svědectví hrdinství a odvahy. Český Těšín: Muzeum Těšínska. ISBN 978-80-86696-43-0.
BORÁK, Mečislav, 1984. Zločin v Životicích. Ostrava: Profil.
BORÁK, Mečislav, 1997. Zábor Těšínska v říjnu 1938 a první fáze delimitace hranic mezi Československem a Polskem (výběr dokumentů). Časopis Slezského zemského muzea, série B. 46(3), 206–248. ISSN 0323-0678.
BORÁK, Mečislav, 2000. Druhá fáze delimitace hranic mezi Československem a Polskem na Těšínsku v listopadu 1938 (výběr dokumentů). Časopis Slezského zemského muzea, série B. 49(1), 51–94. ISSN 0323-0678.
BORÁK, Mečislav, 2003. Oskar Schindler ve službách abwehru na Ostravsku. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 21. Šenov u Ostravy: Tilia, s. 240–262. ISBN 80-86101-77-0.
BORÁK, Mečislav, ed., 1998. Slezsko v dějinách českého státu. Opava: Slezský ústav SZM. ISBN 80-86101-18-5.
BORÁK, Mečislav, GAWRECKI, Dan (eds.), 1992. Nástin dějin Těšínska. Ostrava – Praha: Advertis.
BORÁK, Mečislav. 1984. Zločin v Životicích. Ostrava.
BRÁZDIL, Rudolf a kol., 2007. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slez-sku. Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. 432 s. ISBN 978-80-210-4173-8.
BRŇOVJÁK, Jiří, 2018. Šlechtická společnost rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740–1918). In: JEŽ, Radim a PINDUR, David (eds.). Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska // Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Český Těšín: Muzeum Těšínska, s. 57–96. Cieszyńskie studia muzealne 6 // Těšínský muzejní sborník 6. ISBN 978-80-86696-47-8.
BROŽ, Miroslav (ed.), 2002. Církev v proměnách času 1969–1999. Sborník Českobratrské církve evangelické. Praha.
BUBÍK, Pavel a kol., 2010. 100-lecie Związku Stanowczych Chrześcijan / 100. výročí Svazu rozhodných křesťanů. Cieszyn: Wydawnictvo Arka. ISBN 978-83-924755-6-9.
BUHL, Paul, 1973. Troppau von A bis Z. Ein Stadtlexikon. München. ISBN 978-37-61200-93-3
CASTLES, S., MILLER, M. J.: The Age Of Migration–International Population Movements in the Modern World. New York, The Guliford Press 1993.
CEKOTA, Vojtěch, 2008. K založení Ostravsko-opavské diecéze. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 34(2), 26–30. ISSN 1213-3140.
CRHOVÁ, Marie, 1995. Židé ve Slezsku. In: Židé a Morava. Sborník z konference konané v říjnu 1994 v Kroměříži. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, s. 43–47. ISBN 80-85945-09-6.
CZUDEK, Tadeáš, 2005. Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Moravské zemské muzeum, Brno. ISBN 80-7028-270-3
ČECHÁK, Vladimír, 2004. Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945–2004). Praha: Vysoká škola finanční a správní. ISBN 80-86754-22-7.
ČERMÁK, Jan, 1971. Zahájení výstavby přehrad v povodí Odry. In: Vodní hospodářství v povodí Odry 1945–1970. Reprezentační sborník. Ostrava, s. 88–96.
ČERMÁK, Jan. Přehrada na Moravici u Kružberka. Ostrava: Povodí Odry, podnik pro provoz a využití vodních toků, 1969. 92 stran.
ČERNÝ, Walter, DRCHAL, Karel, 1997. Ptáci. Aventinum nakladatelství, s.r.o., Praha. ISBN 80-7151-008-4
ČIHAŘ, Jiří, 2003. Naše ryby. Ottovo nakladatelství. Praha. ISBN 80-7181-904-2
ČSÚ (2014) Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu – 2011. Praha: ČSÚ. Dostupné na https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl
D´ELVERT, Christan, (1893). Zur Geschichte des katholischen Clerus in Mähren und Oesterreichischen-Schlesien. Brünn.
DĚDKOVÁ, Libuše a GRŮZA, Antonín, 2004. Zámek v Linhartovech. Průzkumy památek. 11(1), 153–173. ISSN 1212-1487.
DĚDKOVÁ, Libuše, 2000. Dva náhrobníky od sochaře Amanda Strausse. In: Památkový ústav v Ostravě. Výroční zpráva 1999. Ostrava: Památkový ústav v Ostravě, s. 63–65. ISBN 80-85034-18-2.
DOKOUPIL, Lumír, 1977. Struktury populace ostravské aglomerace před první světovou válkou. In: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě 55, řada C-12. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 21–54. Studie k vývoji průmyslových oblastí.
DOKOUPIL, Lumír, 1986. Obyvatelstvo ostravské průmyslové oblasti do sčítání 1869. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
DOKOUPIL, Lumír, MYŠKA, Milan, SVOBODA, Jiří a kol., 2005. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity. ISBN 80-7368-024-6.
DOKOUPIL, Lumír, NESLÁDKOVÁ, Ludmila a LIPOVSKI, Radek, 2014. Populace rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace (od 60. let 19. století do první světové války). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7464-729-1.
DOKOUPIL, Lumír, NESLÁDKOVÁ, Ludmila a LIPOVSKI, Radek, 2020. Demografický vývoj v letech 1869–1914. In: ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. II. díl. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 869–951. ISBN 978-80-7599-133-1.
DUDA, Josef, KRKAVEC, František, 1959. Zelené klenoty – zámecké parky na Hlučínsku a Opavsku. Ostrava.
DUDA, Josef, KŘÍŽ, Zdeněk, 1962. Dřeviny opavských parků a zahrad 1. Časopis Slezského muzea, série A, 11, s. 15–19.
DUNGEL, Jan, GAISLER, Jiří, 2002. Atlas savců České a Slovenské republiky. Nakladatelství Academia. Praha. ISBN 80-200-1026-2
DUNGEL, Jan, HUDEC, Karel, 2001. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Nakladatelství Academia. Praha. ISBN 80-200-0927-2
DUNGEL, Jan, ŘEHÁK, Zdeněk, 2005. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Nakladatelství Academia. Praha. ISBN 80-200-1282-6
DUŠEK, Pavel, 2003. Encyklopedie městské dopravy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri. ISBN 80-7277-159-0.
DVOŘÁK, Jan a kol., 1994. 100 let městské hromadné dopravy v Ostravě. Ostrava: Dopravní podnik města Ostravy.
EICHLER, Karel, 1888. Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rak. Slezsku. I/II. Brno.
FAJMAN, Marek, 2008. Architektura tolerančních modliteben církve augsburského vyznání na území Čech, Moravy a rakouského Slezska do roku 1800. In: MACEK, Ondřej (ed.): Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. Praha, s. 489–518.
FIALOVÁ, Ludmila a kol., 1996. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta. ISBN 80-204-0283-7.
FIEDOR, Jiří, 2007. Bílé vrány v černém kraji. Chartisté a nezávislé iniciativy na Ostravsku. Dějiny a současnost. 29(2), 40–43. ISSN 0418-5129.
FOLDYNOVÁ, Ivana, HRUŠKOVÁ, Andrea, ŠOTKOVSKÝ, Ivan, KUBÁŇ, David a kol. 2018 Socio-ekonomická studie zájmového území. Ostrava: ACCENDO.
FOLTYSOVÁ, Jana, 2021. Opava zvelebí neatraktivní místa. Hláska. Zpravodaj statutárního města Opavy 26 (2), s. 10–11.
FOLTÝN, Dušan a kol., 2005. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha.
FOLWARCZNÁ, Kristýna, 2014. Průmyslová, živnostenská, kulturní a hospodářská výstava Těšínska a Ostravska v Orlové 1926. Ostrava. Diplomová práce. Ostravská univerzita. Filozofická fakulta. Katedra historie.
FROLEC, Václav. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Brno: Blok, 1974. 399 s.
FUKALA, Radek, 2007. Slezsko neznámá země koruny české. České Budějovice, ISBN 978-80-86829-23-4.
GABRIELOVÁ, Petra, 2009. Historie rozhodných křesťanů letničních v dokumentech Státní bezpečnosti (70. a 80. léta 20. století). Sborník Archivu bezpečnostních složek. 7, s. 113–121.
GAISLER, Jiří, ZIMA, Jan, 2007. Ekologická nika. In: Zoologie obratlovců. Nakladatelství Academia. Praha, s. 154 – 158. ISBN 978-80-200-1484-9
GALOS, Adam, 1992. Kardynał Kopp – postać fascynująca i kontrowesyjna. In: Matwijowski, Krystin (ed.): Ludzie śląskiego Kościoła katolickiego. Wrocław, s. 53–59.
GARBA, Karel, 1974. Úzkorozchodné dráhy na Ostravsku 1902–1973. I. a II. díl. Brno: Technické muzeum v Brně.
GARBA, Karel, 1990. Dopravní spojení Hlučínska s Ostravskem. Ostrava: Dopravní podnik města Ostravy.
GAWRECKÁ, Marie, 2002. Němci ve Slezsku 1918 - 1938. Opava, ISBN 80-86458-10-5.
GAWRECKÁ, Marie, 2004. Československé Slezsko mezi světovými válkami 1918 – 1938. Opava, ISBN 80-7248-233-5.
GAWRECKI, Dan a kol., 2003. Dějiny českého Slezska 1740–2000. Opava: Slezská univerzita v Opavě. ISBN 80-7248-226-2.
GAWRECKI, Dan, 1999. Politické a národnostní poměry v těšínském Slezsku 1918–1938. Český Těšín: Muzeum Těšínska. Studie o Těšínsku, 15. ISBN 80-902355-4-9.
GAWRECKI, Dan, 2000. Der schlesische Landtag. In: WANDRUSZKA, Adam a URBANITSCH, Peter (Hrsg.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band 7, Teilband 2. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 2105–2130. ISBN 3-7001-2871-1.
GAWRECKI, Dan, 2000. Pokusy o zřízení biskupství v Opavě. In: Opava. Sborník k dějinám města, 2. Kravaře: AVE Centrum Kravaře, s. 45–48. ISBN 80-86268-02-0.
GAWRECKI, Dan, 2002. Slezsko, územní vymezení, pojmy, úvahy. Vlastivědné listy, č. 1, s. 1–5. č. 2, s. 1–4.
GAWRECKI, Dan, 2003b. Slezský zemský sněm a otázka zřízení biskupství v Opavě v letech 1866–1868. In: KORDIOVSKÝ, Emil a JAN, Libor (eds.): Vývoj církevní správy na Moravě. Brno, s. 141–149. XXVII. Mikulovské sympozium.
GEBAUER, Josef, 1992. Hnojník a Beesové. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 18(1), 19–21. ISSN 1213-3140.
GOJNICZEK, Wacław a KACZMAREK, Ryszard (eds.), 2017. 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku. Katowice.
GOSS, J. D. a LINDQUIST, B.: Conceptualizing International Labor Migration: A Structuration Perspective. International Migration Review, Summer 1995, 29(2), 317–351.
GRIM, Tomáš, 2014. Vývoj státních hranic v Českém Slezsku. In: Opava. Sborník k dějinám města, 8. Opava: Statutární město Opava ve spolupráci s Maticí slezskou, s. 16–22. ISBN 978-80-86887-20-3.
GROBELNÝ, Andělín, 1985. Heinrich Jöckel ve Skrochovicích na Opavsku na podzim 1939. In: Terezínské listy 14. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, s. 20–37.
GROF, Leopold, 1994. Kročeje ostravskou železniční historií: v obvodu bývalého provozního oddílu ČSD Ostrava 1847–1990. Ostrava: APEX.
GRÖSCHEL, Bernhard, 1993. Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945. Dokumentation und Strukturbeschreibung. Berlin: Gebr. Mann. Schriften der Stiftung Haus Oberschlesien, 4. ISBN 978-3786116691.
GRŮZA, Antonín, 2004. Osudy slezskoostravského hradu v 19. století. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, s. 50–65. ISBN 80-85034-30-1.
HALBWACHS, Maurice, 2009. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, ISBN 978-80-7419-016-3.
HAMPL, M. (2005) Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
HAMPLOVÁ, D. (2010) Česká religiozita – církevní příslušnost a víra ve světle Sčítání lidu a dat ISSP 2008. NAŠE SPOLEČNOST číslo 1 roč. 2010
HAMZA, Pavel, 2005. 30. duben 1945 u Říšského mostu v centru Ostravy aneb Opravdu Miloš Sýkora? In: Ostrava 22. s. 250–271. ISBN 80-86904-05-9.
HANIČÁK, Ondřej, KOLÁŘ, Ondřej, ed., 2017. 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku. Opava, ISBN 978-80-86887-24-1.
HAVLÍČEK, T. – Klingorová, K. – Lysák, J. Atlas náboženství Česka: The atlas of religions in Czechia. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3794-5.
HELLER, Michał, 2000. Zmiany w strukturach organizacyjnych Kościołów katolickiego i ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim (1918–1937). In: Chmiel, Peter a Drabina, Jan (eds.): Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien von Mittelater bis zur Gegenwart / Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności. Ratingen: Stiftung Haus Oberschlesien, s. 203–214. Tagungsreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 9. ISBN 83-908802-3-7.
HERMAN, Gustav a SVOBODA, Josef, 1928. Československé silnice. Jejich zlepšení ze silničního fondu. Praha: Ministerstvo veřejných prací.
HERNOVÁ, Šárka, 1968. Demografická charakteristika Slováků, Poláků a Němců podle výsledků sčítání lidu z let 1950 a 1961. Slezský sborník. 66(3), 289–309. ISSN 0037-6833.
HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. a kol., 2009. Kulturní regiony a geografie kultury. Praha: ASPI, a.s., ISBN 978-80-7357-339-3.
Historie Československé státní automobilové dopravy, n. p. Ostrava, nositele státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“, 1949–1980. Ostrava: ČSAD. Interní tisk.
HLAVAČKA, Milan, Marès, Antoin, 2011. Paměť míst, událostí a osobností. Historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav, ISBN 978-80.7286-186-6.
HOMAN, Aleš, 2003. Moravská Ostrava jako útočiště uprchlíků z německého a polského záboru na podzim roku 1938. In: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 21. Šenov u Ostravy: Tilia, s. 221–239. ISBN 80-86101-77-0.
HOMOLA, Irena, 1968. Tygodnik Cieszyński i Gwiazdka Cieszyńska pod redakcją Pawła Stalmacha 1848–1887. Katowice: Państwowe Wydawn. Naukowe.
HONS, Josef, 1975. Dejiny dopravy na území ČSSR. Bratislava: Alfa. Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry.
HORSKÁ, Pavla a kol., 1990. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha: Panorama. ISBN 80-7038-011-X.
HRUŠKA Lubor a kol. Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje. (s textovým rozborem) Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., 2012. ISBN: 978-80-904810-6-0.
HRUŠKA, L.; HRUŠKOVÁ, A.; ŠLACHTOVÁ, H.; BUJOK, P.; KUBÁŇ, D. a kol. Epidemiologická studie zájmového území. Ostrava: ACCENDO, 2018.
HRUŠKA-TVRDÝ Lubor. Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů: Pohled prostorové sociologie s využitím multikriteriálních analýz. 1. vyd. Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-904810-4-6. 318 s.
HUBÁČEK, Adam a KOLÁŘ, František, 2016. Oderský zámek. Zaniklý klenot města. Odry: Muzeum Oderska. ISBN 978-80-270-0849-0.
HURT, Rudolf, 1960. Dějiny rybníkářství na Moravě a ve Slezsku, díl 1. a 2. Krajské nakladatelství Ostrava.
HŮRSKÝ, Josef, 1979. Osobní doprava ve Slezsku v letech 1850–1889 (ve srovnání s Moravou). Slezský sborník. 77(3), 199–210. ISSN 0037-6833.
HŮRSKÝ, Josef, 1983. Vývoj dopravního zpřístupnění slezských měst před první světovou válkou. Slezský sborník. 81(3), 196–210. ISSN 0037-6833.
CHLEBEK, Karel, 2014. 100 let služby Moravskoslezského sdružení. Ostrava.
CHROMCOVÁ, Gabriela, 2004. Noviny Těšínské 1894–2004. Český Těšín: Město Český Těšín – Městský úřad Český Těšín, Odbor školství a kultury ve spolupráci s Muzeem Těšínska. ISBN 80-254-0078-6.
CHROMÝ, Pavel, 2009. Region a regionalismus, Geografické rozhledy, 19 (1), 2-5.
CHYTRÝ, Milan et al., 2010. Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-03-0
INDRA, Bohumír, 1996. Přestavba starého a stavba nového zámku ve Velkých Heralticích koncem 17. a 18. století. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 45(1), 1–15. ISSN 0323-0678.
IVÁNEK, Jakub, Smolka, Zdeněk (eds.), 2013. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. 2. vydání. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7464-385-9.
IZYDORCZYK, Fabiana a SPYRA, Janusz, 2002. Dzieje Miłosierdzia. Zgromadzenie Siostr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Cieszynie (1876–2001). Kraków.
JAKL, Tomáš, 2004. Květen 1945 v českých zemích: pozemní operace vojsk Osy a Spojenců. Praha: Miroslav Bílý. ISBN 80-86524-07-8.
JANÁK, Jan, 1990. Moravská a slezská správa a samospráva v letech 1740 až 1948. Vlastivědný věstník moravský. 42(3), s. 338–356. ISSN 0323-2581.
JANČUROVÁ, Jaroslava, 1967. Vliv migračních pohybů obyvatelstva v letech 1960-1964 na populační situaci v Severomoravském kraji. Slezský sborník. 65(2), 145–170. ISSN 0037-6833.
JANKOWIAK, Stanisław, 2002. Śląsk Cieszyński w stosunkach polsko-czechosłowackich po II wojnie światowej. In: Czubiński, Antoni (ed.). Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 577–587. ISBN 978-8323212065.
JANOSCH, Hermann, 1930. Das Hultschiner Ländchen. Ratibor.
JEMELKA, Martin a Štofaník, Jakub, 2020. Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938). Praha.
JEMELKA, Martin, 2014. Ostrava duchovním a náboženským centrem republiky československé? Studia historica brunensia. 61(2), s. 230–232.
JEMELKA, Martin, 2018. Mezi národem, konfesí a třídou: pluralita náboženských kultur meziválečného Slezska. In: KOLÁŘ, Ondřej a kol.: Slezsko a Ostravsko v Masarykově republice. Opava: Slezské zemské muzeum, s. 37–47. ISBN 978-80-87789-51-3.
JINDRA, Martin a Sladkowski, Marcel (eds.), 2020. Biografický slovník Církve československé husitské. Praha.
JINDRA, Martin, 2017. Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. Praha: ÚSTR, Církev československá husitská. ISBN 978-80-87912-80-5.
JIRÁSEK, Zdeněk, 1991. Slezská idea v poválečném Československu. Časopis Slezského zemského muzea, série B, 40, s. 185–191.
JIRÁSEK, Zdeněk, 2014. "Ocelová koncepce" hospodářství českých zemí 1947-1953. Opava: Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7510-116-7.
JIŘÍK, Karel a kol., 1993. Dějiny Ostravy. Ostrava: Sfinga. ISBN 80-85491-39-7.
KACZMARCZYK, Stanislav a kol., 2005. Křesťanské společenství na Těšínsku. Český Těšín.
KADLEC, Petr a kol., 2016: Národnostní statistika v českých zemích 1880–1930. Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. II. díl. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7422-551-2.
KADLEC, Petr, 2013. Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7464-253-1.
KALETA, Jan a kol., 1981. Církev bratrská na Těšínsku. In: Košťál, Miloslav a kol.: Sto let ve službě evangelia (1880–1980). Jubilejní sborník Církve bratrské. Praha, s. 145–152.
KAMIŃSKI, Marek, 2004. Konflikt polsko-czeski 1918–1921. Warszawa: Instytut Historii PAN. ISBN 83-88973-05-3.
KÁRNÍKOVÁ, Ludmila, 1965. Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754–1914. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
KASZPER, Roman, Małysz, Bohdan a Szymeczek, Józef. 2009. Poláci na Těšínsku: studijní materiál. Český Těšín.
KILIÁNOVÁ, Gabriela, KOWALSKÁ, Eva a KREKOVIČOVÁ, Eva, ed., 2009. My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: Veda, ISBN 978-80-224-1025-0.
KIRCHNER, Karel, SMOLOVÁ, Irena, 2010. Základy antropogenní geomorfologie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. ISBN 978-80-244-2376-0
KLADIWA, Pavel a kol., 2016. Národnostní statistika v českých zemích 1880–1930. Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. I. díl. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7422-550-5.
KLADIWA, Pavel a POKLUDOVÁ, Andrea, 2012. Hans Kudlich (1823–1917): cesta života a mýtu. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7464-159-6.
KLADIWA, Pavel, POKLUDOVÁ, Andrea, KAFKOVÁ, Renata, 2008. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850 – 1914. Díl II./1. Ostrava. ISBN 978-80-7368-595-9
KLADIWA, Pavel et. al, 2016. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. 1. Praha
KLADIWA, Pavel, 2015. Smýšlením Němci, statisticky Češi. Národnostní klasifikace na meziválečném Hlučínsku. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 64(1), 21–34. ISSN 0323-0678.
KLADIWA, Pavel, POKLUDOVÁ, Andrea a KAFKOVÁ, Renáta, 2008. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914. Díl II. Sv. 1. Muži z radnice. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7368-595-9.
KLADIWA, Pavel, POKLUDOVÁ, Andrea a KAFKOVÁ, Renáta, 2009. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914. Díl II. Sv. 2. Budování infrastruktury. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7368-738-0.
KNAPÍK, Jiří, 2003. Slezský ústav v Praze a vědecký výzkum Slezska v letech 1945-1950. Práce z dějin vědy. sv.6, Praha, s. 475-548.
KNAPÍK, Jiří, 2004. Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958: proměny vědeckého pracoviště v regionu. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Práce z dějin vědy, sv. 15. ISBN 80-86103-80-3.
KNAPÍK, Jiří, JIRÁSEK, Zdeněk, 2010. Nechtěné Slezsko. Reflexe českého „slezanství“ v poválečném Československu (1945-1969). Soudobé dějiny, č. 3, s. 421-440.
KNAPÍKOVÁ, Jaromíra, 2007. Matice opavská. Spolek osobnosti a národní snahy ve Slezsku 1877-1948. Opava, ISBN:978-80-86887-08-1.
KOLÁŘ, Ondřej, 2017. K vnímání „nepřítele“ a „osvoboditele“ v bojích jara 1945 v paměti českého obyvatelstva Slezska a Ostravska. Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy. 8(2), 183–196. ISSN 1803-7550.
KOLÁŘOVÁ, Eva, 2004. Státní zámek Hradec nad Moravicí. Vývojové polohy exteriérů a interiérů se zvláštním zaměřením na 19. století. Východiska a výsledky dosavadní památkové obnovy. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, s. 21–37. ISBN 80-85034-30-1.
KOLÁŘOVÁ, Eva, 2009. Příběh zámku a mauzolea knížat Lichnovských v Chuchelné a vzájemné vazby na zámek Hradec. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, s. 61–84. ISBN 978-80-85034-55-4.
KOLÁŘOVÁ, Eva, 2015. Příběh raduňského zámku. Kroměříž: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87231-28-9.
KOLÁŘOVÁ, Ivana a KOLÁŘ, Ondřej, 2020. Československé četnictvo a policie ve sporu o Těšínsko (1918–1920). Praha: Academia. ISBN 978-80-200-3140-2.
KOLATSCHEK, Julius A., 1869. Die evangelische Kirche Oesterreichs in den deutsch-slavischen Ländern. Wien.
Kolektiv autorů, 2013. Ostravsko-opavská operace v paměti českých veteránů. Montanex. Ostra-va. ISBN 9788072253845
KOLEKTIV, 2008. Ostravský oblastní vodovod 1958–2008. Ostrava.
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. [online]. Dostupné na: https://ma21.msk.cz/cz/doprava/koncepce-rozvoje-dopravni-infrastruktury-40486/ [cit. dne 30. 1. 2021].
KOPECKÝ, Milan, 2001. 1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR: tankisté československé zahraniční armády na Východní frontě 1943–1945. Praha: MBI. ISBN 80-86524-00-0.
KORBELÁŘOVÁ, Irena a ŽÁČEK, Rudolf, 2003. Přínos statistických pramenů olomoucké diecéze z předjosefinského období pro historiografii Slezska. In: KORDIOVSKÝ, Emil a JAN, Libor (eds.): Vývoj církevní správy na Moravě. Brno, s. 341–346. XXVII. Mikulovské sympozium 2002.
KOUŘILOVÁ, Markéta a PELC, Martin, 2007. Historický kontext proměn zámku ve Studénce. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 56(1), 59–72. ISSN 0323-0678.
KOVAŘÍK, Petr, 2019. Naše studánky. Pověsti – legendy – místopis. Universum, Praha. ISBN 978-80-242-6303-8
KOŽENÝ, Metoděj, 1936. Silniční síť na Opavsku. In: Technická práce na Ostravsku 1926–1936, s. 531–532.
KRAJÍČEK, L.; Vorel, I., Hruška-Tvrdý, L. a kol. Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje – Návrhová část I.
KRÁL, Martin, IVÁNEK, Jakub a PECHÁČEK, Jiří, 2013. Zámek v Hlavnici. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 39(1), 29–32. ISSN 1213-3140.
KREJČIŘÍK, Mojmír. 2009. Kleinové: historie moravské podnikatelské rodiny. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna. ISBN 978-80-86736-13-6.
KREJSA, František (1986). Katalog olomoucké arcidiecéze za biskupa ThDr. Josefa Vrany. Olomouc.
KŘÍŽ, Zdeněk, 1961. Krajské arboretum v Novém Dvoře u Opavy. Ostrava.
KŘÍŽ, Zdeněk, 1971. Významné parky Severomoravského kraje. Ostrava.
KUBICA, Michal, 2019. Utváření nové hranice Slezska roku 1742 se zřetelem k Těšínskému knížectví. Těšínsko. 62(1), 3–16. ISSN 0139-7605.
KUBÍČEK, Jaromír, 2001. Noviny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918. Brno: Moravská zemská knihovna. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, 39. ISBN 80-7051-133-8.
KUČA, Karel. Oblasti dochovaných strukturálně výrazných plužin v České republice. Zprávy památkové péče, 2014, 74(1), s. 34-49. ISSN 1210-5538.
KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl, Ml-Pan. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 941 s. ISBN 80-85983-12-5.
KUČERA, Rudolf a kol., 2012. Identity v českých zemích 19. a 20. století. Hledaní a proměny, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, ISBN 978-80-86495-98-9.
KUFA, Pavel, 2018. Letní sídlo Larisch-Mönnichů ve Fryštátě. In: JEŽ, Radim a PINDUR, David (eds.). Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska // Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Český Těšín: Muzeum Těšínska, s. 271–286. Cieszyńskie studia muzealne 6 // Těšínský muzejní sborník 6. ISBN 978-80-86696-47-8.
KUPKA, Vladimír a kol., 2006. Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha, Libri. ISBN 978-80-7277-096-0
LARISCH, Jan, 2015. Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace na území ostravsko-opavské diecéze. Ostrava.
LÁZNIČKA, Zdeněk. Půdorys slezských měst. [Opava: Matice moravská], 1945. [19] s.
LÁZNIČKA, Zdeněk. Typy venkovského osídlení v Československu = Tipy derevenskogo rasselenija v Čechoslovakii = Typen des ländlichen Siedlungswesens in der Tschechoslowakei. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956. s. 95–134. Práce Brněnské základny Československé akademie věd = Acta Academiae scientiarum Čechoslovenciae basis Brunensis; 1956: ročník 28.: sešit 3.: spis 338.
LÍDL, Václav a kol., 2009. Silnice a dálnice v České republice. Rudná u Prahy: Agentura Lucie. ISBN 978-80-87138-14-4.
LIPOVSKI, Radek, 2020. Demografický vývoj a národnostní otázka od poloviny 19. století do současnosti. In: Český Těšín 1920–2020. Český Těšín–Ostrava–Třinec: Wart, s. 147–201. ISBN 978-80-905079-7-5.
LOBKOWICZ, František Václav, 2011. Patnáct let existence Diecéze ostravsko-opavské v úvahách a vzpomínkách prvního ostravsko-opavského biskupa. In: ŽÁČEK, Rudolf a kol.: Ostravsko-opavská diecéze. Kořeny a souvislosti. Opava, s. 120–125.
LOKOČ, Radim, DOVALA, Ondřej, PŘASLIČÁK, Miroslav a kol., 2011. Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska. Místní akční skupina Opavsko, Místní akční skupina Rozvoj Krnovska. ISBN 978-80-254-5803-7
LOKOČ, Radim, LOKOČOVÁ, Michaela, 2010. Vývoj krajiny v České republice. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno. ISBN 978-80-904807-3-5
LOKOČ, Radim, TINZOVÁ, Bohumila, DOVALA, Ondřej, 2013. Moravský sladkoplodý jeřáb z Ostružné do světa. Eberesche, Jeseník. ISBN 978-80-260-4725-4
LONDZIN, Józef, 1926. Historja generalnego wikarjatu w Cieszynie. Cieszyn.
LOSOS, Bohumil a kol., 1984. Člověk jako ekologický faktor. In: Ekologie živočichů. Státní pe-dagogické nakladatelství. Praha, s. 281 – 301.
LUKEŠ, Josef, 1913. Obraz Slezska v číslech. Praha: Národní rada česká.
MACEK, Jaroslav, ŽÁČEK, Václav, 1958. Krajská správa v českých zemích a její archivní fondy. Praha Archivní správa ministerstva vnitra ČSR.
MAHEL, Richard, 2002. Stanovení státní hranice ve Slezsku v roce 1742–43 podle materiálů Královského úřadu v Opavě. In: Státní okresní archiv Kroměříž, archivní ročenka, 8. Holešov: Státní okresní archiv Kroměříž, s. 8–55. ISBN 80-239-0334-9.
MAHEL, Richard, 2005. Stanovení státní hranice v niském knížectví v rámci nové slezské hranice po míru vratislavském 1742. In: Jesenicko. Vlastivědný sborník, 6. Jeseník: SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, s. 5–23. ISBN 80-903430-3-1.
MAHEL, Richard, 2013. Stanovení státní hranice ve Slezsku mezi podunajskou monarchií a pruským královstvím v letech 1742–1743, s přihlédnutím k Hlučínsku a Opavsku. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 3(2), 17–22. ISSN 1804-6967.
MACHAČOVÁ, Jana a ŠRAJEROVÁ, Oľga, ed., 2009. Slezský ústav SZM: profil - výzkum – perspektivy. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 4. a 5. listopadu 2008 v Opavě, Slezské zemské muzeum: Opava 2009, ISSN 0037-6833, 270 s. (vyšlo na CD jako příloha Slezského sborníku, č. 2/3.
MACHOVEC, Martin, 2008. Pohledy zevnitř. Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích. Praha: Pistoius & Olšanská. ISBN 978-80-87053-22-5.
MAKOWSKI, Mariusz, 2005. Szlacheckie siedziby na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego. ISBN 80-239-6051-2.
MATĚJ, K., 1926. Silniční síť na Ostravsku. In: Technická práce na Ostravsku, s. 517–524.
MATĚJ, Miloš, KLÁT, Jaroslav, KORBELÁŘOVÁ, Irena, 2009. Kulturní památky Ostravsko-karvinského revíru. Ostrava. ISBN 978-80-85034-52-3
MATĚJČEK, Jiří, STEINER, Jan, 1970: Vývoj počtu obyvatelstva ve Slezsku a na severovýchodní Moravě v letech 1910–1930. Slezský sborník. 68(3), 280–295. ISSN 0037-6833.
MATEJKO-PETERKA, Ilona et alii, 2016. Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea. Opava: Slezské zemské muzeum. ISBN 978-80-87789-39-1.
MIHOVÁ, Tereza a ŠOPÁK, Pavel, 2015. Nápisy na hrobech. Městský hřbitov v Opavě v letech 1789–1804. Opava: Slezská univerzita. ISBN 978-80-7510-175-4.
MICHEJDA, Karol, 1909. Dzieje kościoła ewangelickiego w księstwie Cieszyńskiem. Cieszyn.
MIKETOVÁ, Hana, MÜLLER, Karel a kol., 2012. Opavský zámek. Opava: Opavská kulturní organizace. ISBN 978-80-87632-01-7.
MIKOLÁŠ, Jaroslav Ludvík, 1930. Okolo biskupství Českého Slezska. Frýdek.
MLÍKOVSKÝ, Jiří, ed. a STÝBLO, Petr, ed., 2006. Nepůvodní druhy fauny a flóry České repub-liky. Praha: ČSOP. 496 s. ISBN 80-86770-17-6.
MOTYČKOVÁ, Hana, MOTYČKA, Vladimír, 2018. Přistěhovalci, emigranti a navrátilci I. Naše příroda 1, s. 40–52.
MOZOR, Karol, 2005. Miejsca pielgrzymkowe i szczególnego kultu na Śląsku Cieszyńskim w obecnych granicach Rzeczypospolitej. In: Lubos-Kozieł, Joanna a kol.: Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Wrocław, s. 520–539. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2846. Historia Sztuki, XXII.
MÜLLER, Karel B., 2007. Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity / Forming Positive Identities between the Past and the Future. A Contribution to the European Identity Project. Sociologický Časopis / Czech Sociological Review [online]., 43(4), 785 [cit. 2021-02-09]. ISSN 00380288.
MÜLLER, Karel, 2012. Heraldické památky Těšínska. Český Těšín: Muzeum Těšínska. ISBN 978-80-86696-30-0.
MÜLLER, Karel, POLÁCH, Radek a ZEZULČÍK, Jaroslav, 2008. Kamenné svědectví minulosti. Heraldické památky Novojičínska. Praha: Libri, Nový Jičín: Muzeum Novojičínska. ISBN 978-80-7277-360-2.
MUSIL, František a PLAČEK, Miroslav, 2003. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska. Praha: Libri. ISBN 80-7277-154-X.
MUSIL, František, 2015. Neznámé zámky Moravy a Slezska. Ostrava: Šmíra Print. ISBN 978-80-87427-97-2.
MYSZOR, Jerzy, 2000. Administracja kośćielna polskiego Śląska Zaolziańskiego 1938–1940. In: Chmiel, Peter a Drabina, Jan (eds.): Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien von Mittelater bis zur Gegenwart / Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności. Ratingen, s. 215–252. Tagungsreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 9.
MYŠKA, Milan, 1967. Migranti z Haliče a jejich podíl na vytváření dělnické třídy v uhelném průmyslu Moravské Ostravy v 2. polovině 19. století. In: Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 4. Ostrava: Profil, s. 147–181. ISSN 0232-0967.
MYŠKA, Milan, 1969. Historicko-demografická charakteristika západní části ostravské průmyslové oblasti na konci 19. století. In: Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 5. Ostrava: Profil, s. 86–97. ISSN 0232-0967.
MYŠKA, Milan, 2011. Hrabě Hodic a jeho svět. Zámecká kultura ve Slezsku mezi barokem a osvícenstvím. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7368-952-0.
NENIČKA, Lubomír, 2010. Druhá republika na Ostravsku 1938–1939. Opava: Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7248-600-7.
NENTWIG, Wolfgang (ed.), 2014. Nevítaní vetřelci. Nakladatelství Academia, Praha. ISBN 978-80-200-2316-2
NESLÁDKOVÁ, Ludmila, 2001. Židé v procesu proměny poddanského městečka Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 20. Ostrava: Tilia, s. 7–27. ISBN 80-86101-41-X.
NESLÁDKOVÁ, Ludmila, 2008. Profesní a sociální charakteristika židovské populace v Československu za první republiky. Demografie. 50(1), 1–14. ISSN 0011-8265.
NEŠPOR, Zdeněk R. a Vojtíšek, Zdeněk, 2015. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha.
NEŠPOR, Zdeněk R., 2009. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska. Praha.
NEUBAUEROVÁ, Michaela, 2008 Římskokatolická církev na Jesenicku v letech 1945–1956. Jesenicko. 9, s. 41–57.
NITRA, Tomáš, 2010. Ostravská letiště se zaměřením na stavební vývoj. Ostrava. ISBN 978-80-85034-56-1
NOWACK, Alfons, 1937. Schlesische Wallfahrtsorte älterer und neuer Zeit im Erzbistum Breslau. Breslau.
NOWAK, Krzysztof a kol., 2008. První nezávislost: Poláci v Těšínském Slezsku v roce 1918. Cieszyn: Biuro Promocji i Informacji, Urząd Miejski. ISBN 9788389835413.
NOWAK, Krzysztof a Panic, Idzi (eds.), 2013. Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918). Cieszyn. Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, V.
OTIPKA, Martin (ed.), 2010. Ostravsko-opavská operace 1945 v paměti českých veteránů: Ostravsko-opavskaja operacije 1945. Memuary češskich veteranov. Ostrava: Montanex. ISBN 978-80-7225-317-3.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena a kol., 2004. Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri. ISBN 80-7277-279-1.
PAŁKA, Elżbieta, 2007. Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej organizaci religijnej do Kościoła czeskiego. Wrocław.
PALLAS, Ladislav, 1970. Jazyková otázka a podmínky vytváření národního vědomí ve Slezsku. Ostrava: Profil.
Památník vydaný ku slavnosti odhalení pomníku, postaveného na hřbitově v Orlové padlým při obsazování Těšínska a za plebiscitu: 30.9.1928 za oslav 10letého výročí Republiky československé. 1928. Orlová.
PASEK, Zbigniew, 2000. Neopietyzm i wolne Kościoły na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku. In: CHMIEL, Peter a DRABINA, Jan (eds.): Die konfesionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart / Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesnosci. Ratingen, s. 155–172. Tagungsreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 9.
PATER, Józef, 1998. Wrocławska Kapituła Katedralna w XIII wieku. Wrocław.
PATER, Józef, 2000. Poczet biskupów wrocławskich. Wrocław.
PATZELT, Herbert, 1969. Der Pietismus im Teschener Schlesien 1709–1730. Göttingen.
PATZELT, Herbert, 1981. Anfänge der Toleranzzeit in Österreichisch-Schlesien. In: Barton, Peter F. (ed.): Im Lichte der Toleranz. Aufsätze zur Toleranzgesetzgebung des 18. Jahrhunderts in den Reichen Joseph II., ihren Voraussetzungen und ihren Folgen. Wien, s. 279–319.
PATZELT, Herbert, 1989. Geschichte der evangelischen Kirche in Österreichisch-Schlesien. Dülmen. Schriften der Stiftung Haus Oberschlesien, 5.
PAVELČÍK, František, 2012. Polní pilot letec Rudolf Škuta. Frýdek-Místek. ISBN 978-80-260-6266-0
PAVELČÍKOVÁ, Nina, 2013. Církevní život na Těšínsku jako objekt zájmu komunistického režimu. Časopis Matice moravské. 82(2), 407–443. ISSN 0323-052X.
PAVLÍČEK, Jaromír, 2003. Opavské Slezsko v boji proti nacistické okupaci 1938–1945. Opava: Matice Slezská. ISBN 80-903055-7-1.
PAVLÍČEK, Stanislav. 2002. Naše lokálky. Místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Dokořán. ISBN 80-86569-13-6.
PAVLOUSEK, Otakar, 1936. Silnice ze železa. In: Technická práce na Ostravsku 1926–1936, s. 542–559.
PERGL, Jan a kol., 2016. Black, Grey and Watch List of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. NeoBiota 28, s. 1–37. ISSN 1314-2488
PETR, Stanislav, 1995. Rukopisné fondy zámeckých a hradních knihoven na Moravě a ve Slezsku. In: KUBÍČEK, Jaromír (ed.). Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník ze 4. odborné konference Olomouc, 11.–12. října 1994.
PIĘTAK, Stanislav, PINDUR, David a SPRATEK, Daniel, 2020. Dějiny evangelíků na Těšínsku od reformace do tolerance. Český Těšín.
PINDUR, David, 2009. Přehled nejstarší církevně správní organizace Těšínska. Od středověku do vzniku generálního vikariátu v roce 1770. In: JIRÁSEK, Zdeněk (ed.): Polská papežská nunciatura v Opavě (Slezsko v církevních dějinách 18. století). Opava, s. 57–92.
PINDUR, David, 2011. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku / Bazylika Nawiedzenia Marii Panny we Frydku. Český Těšín.
PINDUR, David, 2015. Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654–1770. Struktury, procesy, lidé. Český Těšín. Studie o Těšínsku, 22.
PINDUR, David, 2016. Mons. Otto Furch. Významná osobnost římskokatolické církve na Těšínsku ve 20. století. Těšínsko 59(2), 37–50.
PINDUR, David, 2019. Úprava hranic farnosti Staré Hamry na podzim roku 1939. Příspěvek k dějinám církevní správy Slezska. Těšínsko 62(2), 37–60.
PINDUR, David, 2020. Náboženský vývoj od poloviny 19. století do současnosti. In: JEŽ, Radim, PINDUR, David a WAWRECZKA, Henryk: Český Těšín 1920–2020. Český Těšín – Ostrava – Třinec, s. 378–443.
PITRONOVÁ, Blanka, 1967. Vývoj lidnatosti v ostravské průmyslové oblasti v období jejího vzniku. Slezský sborník. 65(4), 442–454. ISSN 0037-6833.
PITRONOVÁ, Blanka, 1969. Vývoj lidnatosti ve Slezsku a na severovýchodní Moravě v období 1869–1910. Slezský sborník. 67(3), 313–335. ISSN 0037-6833.
PITRONOVÁ, Blanka, 1980. Vývoj národnostních poměrů pracovníků v hutnictví železa českých zemí v období 1880–1939. In: Hospodářské dějiny 5. Praha: Historický ústav ČSAV, s. 87–180.
PLAČEK, Miroslav, 2001. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri. ISBN 80-7277-036-5.
PLAČEK, Vilém, 2000. Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742–1960. Hlučín: Kulturní dům Hlučín, Kravaře: Kulturní středisko zámek Kravaře. ISBN 80-902526-5-6.
PLAČEK, Vilém, 2007. Prajzáci II aneb Hlučínsko ve staronové vlasti 1920–1938. Háj ve Slezsku: Maj-Tiskárna. ISBN 978-80-86458-24-3.
POKLUDOVÁ, Andrea a MORYS-TWAROWSKI, Michael, 2013. Opieka zdrowotna. In: Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. Tom V. Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918). Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, s. 397–415. ISBN 978-83-935147-3-1.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2005. Karel Jaromír Bukovanský – Pedagog, vlastivědný pracovník, archeolog, publicista a zakladatel českého muzejnictví ve Slezsku. Časopis slezského zemského muzea, Série B. 54, 26–52.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2007. Zprávy o zdravotních poměrech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století. In: DYRDA, J. M. a GRUSZKI, B. (eds.). Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle zasobów źródłowych. Katowice: Śląska Akademia Medyczna, s. 80–99. Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska, 11. ISSN 1231-4412.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2014. Frýdek a Místek v letech 1848–1918. In: Frýdek-Místek. Praha, s. 225–270.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2015. Pomníky – místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí. In: Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse. Opole: Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, s. 209–218. ISBN 978-83-7126-309-5.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2017. Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti rakouského Slezska 1848–1914. In: 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku. Opava, s. 11–35.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2018. Národnostní poměry Slezska a Ostravska. In: Slezsko a Ostravsko 1918–1938. Opava, s. 24–36.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2020. Proměny spolkového života. In: ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 626–634. ISBN 978-80-7599-133-1.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2020. Regionální tisk v procesu modernizace. In: ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 634–644. ISBN 978-80-7599-133-1.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2020. Rozvoj moderní samosprávy. In: ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 604–626. ISBN 978-80-7599-133-1.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2020. Zdravotní stav populace. In: ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 953–1001. ISBN 978-80-7599-133-1.
POPELKA, Petr, 2011. Zrod moderní podnikatelstva: bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a Rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7368-841-7.
POPELKA, Petr, 2013. Hlavní problémy budování moderní silniční infrastruktury v českých zemích v době tereziánské a josefínské (na příkladu Slezsko-haličské silnice). Slezský sborník. 11(2), 211–236. ISSN 0037-6833.
POPELKA, Petr, 2013. Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7464-384-2.
POPELKA, Petr, 2015. Powstanie nowoczesnego transportu na Śląsku Austriackim 1742–1914. Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka. 70(3), 23–37. ISSN 0037-7511.
POTŮČKOVÁ, Martina, MAŇAS, Vladimír a ORLITA, Zdeněk, 2010. Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc.
PROKOP, Radim, 2005. Vodní díla, přehradní nádrže. In: Kulturněhistorická encyklopedie Slez-ska a severovýchodní Moravy. Ostrava, s. 394–395. ISBN 80-7368-024-6
RATAJ, Michael, 2016. Německá žurnalistika a opavští Němci v ČSR. Svědectví dobového tisku. Troppau. ISBN 978-80-270-0781-3.
RIEZNER, Jiří, 2008. Založení evangelického sboru v Holčovicích na Krnovsku. In: MACEK, Ondřej (ed.): Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. Praha, s. 114–125.
ROHÁČEK, Jindřich a kol., 2003. Příroda Slezska. Slezské zemské muzeum. Opava. ISBN 978-80-86224-95-4
RYGULA, Piotr, 2004. Uwarunkowania polityczno-prawne generalnego wikariatu. In: BUDNIAK, Józef a MOZOR, Karol (edd.). Kształtowanie tożsamości religijnej i kulturowej na Śląsku Cieszyńskim w latach działalności Książęco-Biskupiego Wikariatu Generalnego Księstwa Cieszyńskiego (1770–1925). Cieszyn, s. 49–67.
Ředitelství silnic a dálnic ČSR. [online]. Dostupné na: https://www.rsd.cz/wps/portal/ [cit. dne 30. 1. 2021]
ŘEHA, Tomáš, 2014. Města rakouského Slezska první poloviny 19. století nahlížené soudobými statisticko-topografickými prameny. Ostrava, Rukopis, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny.
ŘÍHA, Jiří (ed.), 1931. Zdravotnická ročenka československá 4. Praha: Piras.
SÁDLO, Jiří et al. Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. 3., upr. vyd. Praha: Malá skála, 2008. 255 s. ISBN 978-80-86776-06-4.
SAHEB, Jan, 2018. Strukturální proměny církevní správy rakouského Slezska na prahu modernismu. (K procesu transformace duchovní správy v 18. a v první polovině 19. století). In: VAŘEKA, Marek a ZÁŘICKÝ, Aleš (eds.). Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 54–66. ISBN 978-80-7599-046-4.
SAHEB, Jan, 2020. Náboženský život. In: ZÁŘICKÝ, Aleš (ed.). Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. 2. díl. Ostrava, s. 795–841.
SAMEK, Bohumil, 1994. Umělecké památky Moravy a Slezska. Sv. 1. Praha: Academia. ISBN 80-200-0474-2.
SAMEK, Bohumil, 1994. Umělecké památky Moravy a Slezska. Sv. 2. Praha: Academia. ISBN 80-200-0695-8.
SÁDLO, Jiří, STORCH, David, 2000. Biologie krajiny. Vesmír. Praha. ISBN 80-85977-31-1
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. [online]. Dostupné na: http://www.prodlouzena-rudna.cz/ [online]. [cit. dne 30. 1. 2021].
SEDLÁČEK, Kamil a kol., 1988. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. Díl 1. Ptáci. Státní zemědělské nakladatelství. Praha. ISBN 80-209-0036-5
SEPPELT, Franz Xaver, 1929. Geschichte des Bistums Breslau. Breslau.
SETTARI, Olga, 1992–1993. Zámek Jánský Vrch a město Javorník v minulosti. Příspěvek k hudební topografii Slezska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada hudebněvědná (H). 41–42(27–28), 45–53. ISSN 0231-522X.
SCHELLE, Karel, 2002. Vývoj veřejné správy v letech 1848–1948. Praha: Eurolex Bohemia. ISBN 80-86432-25-4.
SCHENKOVÁ, Marie, 2010. Poutní tradice v českém Slezsku. In: MIHOLA, Jiří (ed.). Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno, s. 83–98.
SCHIPP, Joseph Carl, 1828. Historisch-tographische Beschreibung des Breslauer k. k. Diöcesantheils. Teschen.
SCHIPP, Joseph Karl, 1821. Stand des Breslauer k. k. Diözesantheils mit endes des Jahrs 1820. Teschen.
SCHLÉE, Fidelis. Stavební řád pro Moravu a Slezsko s výkladem, judikaturou a vzorci. V Praze: [Nákladem "Sociální služby"], 1932. 340 s. Knihovna veřejné správy a samosprávy; Sv. 7.
SCHWARZ, Karl W., 2010. Superintendent Theodor Haase – ein Protestant aus dem Teschnerland. Aus Anlass seines 100. Todestages. In: CZYŻ, Renata, GOJNICZEK, Wacław a SPRATEK, Daniel (eds.): Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie. Cieszyn, s. 206–225.
Silnice země Moravskoslezské v pětiletém plánu obnovy, 1946. Brno: Zemský národní výbor v Brně.
SIWEK, Tadeusz a KAŇOK, Jaromír. Vědomí slezské identity v mentální mapě. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. 97 s. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity = Scripta Philosophicae Universitatis Ostraviensis; č. 136. ISBN 80-7042-576-8.
SIWEK, Tadeusz, BOGDOVÁ, Kamila, 2007. České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 43(4), 1039–1053.
SLÁDEK, Pavel, VAVŘAČOVÁ, Michaela a kol., 2014. Historie trati Ostrava-Svinov – Český Těšín. Místní dráha Svinov-Vítkovice – Těšín s odbočkou do Fryštátu. 100 let tratě Suchá ve Slezsku – Těšín. 50 let Polanecké spojky. Ostrava: Železniční muzeum moravskoslezské. Knihovna muzea č. 2. ISBN 978-80-905805-0-3.
SOKOLOVÁ, Gabriela, HERNOVÁ, Šárka a ŠRAJEROVÁ, Oľga, 1997. Češi, Slováci a Poláci na Těšínsku a jejich vzájemné vztahy. Opava: Slezský ústav SZM, ISBN 80-86101-03-7.
SPRATEK, Daniel, 2002. Právní poměry v evangelické církvi na Těšínsku v letech 1709–1781 a jejich vliv na uspořádání toleranční církve v Rakousku (2. díl). Revue církevního práva – Church Law Review. 22(2), 93–126. ISSN 1211-1635.
SPURNÝ, František a kol., 1983. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sv. 2. Severní Morava. Praha: Svoboda.
SPURNÝ, František, 2003. Počátky starokatolické církve na Moravě před 1. světovou válkou. In: In: KORDIOVSKÝ, Emil a JAN, Libor (eds.): Vývoj církevní správy na Moravě. Brno, s. 221–225. XXVII. Mikulovské sympozium.
SPYRA, Janusz a WODZIŃSKI, Marcin (eds.), 2001. Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku. Český Těšín.
SPYRA, Janusz, 2005. Źydzi na Śląsku Austriackim 1742–1918. Od tolerowanych Źydów do źydowskiej gminy vyznaniowej. Katowice: Muzeum Śląskie. ISBN 8387455148.
SPYRA, Janusz, 2009. Żydowskie gminy wyznaniowe na Śląsku Austriackim (1742–1918). Katowice.
SPYRA, Janusz, 2012. Śląsk Cieszyński w okresie 1653–1848. Cieszyn. Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych pod redakcją Idziego Panica, IV.
SPYRA, Janusz, 2015. Biografický slovník rabínů rakouského Slezska. Ostrava.
STANĚK, Tomáš, 1991. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha: Academia. ISBN 80-200-0328-2.
STANZEL, Josef G., 2007. Kirchliche Organisation, insbes. die Pfarreiorganisation im Freiwaldauer Gebiet vom 18. Jahrhundert bis Gegenwart. In: Historický seminář na téma Církevní život v dějinách Jesenicka. Sborník referátů. Jeseník, s. 18–26. VII. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku.
STAROSTA, Antonín, 1936. O spotřebě vody průmyslové na Ostravsku. In: Technická práce na Ostravsku 1926–1936. Vydáno k XVI. sjezdu československých inženýrů. Moravská Ostrava, s. 116–121.
STARÝ, Marek, 2007. Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1848. Praha: Vysoká škola finanční a správní. ISBN 978-80-86754-79-6.
SVĚRÁK, Tomáš, 1921. Květena ulic Opavských. Věstník Matice opavské 26, s. 50–54
SZYMECZEK, Józef (ed.), 2004. Stát, církev a národ v československé části těšínského Slezska (1945–1953). Český Těšín. Bibliotheca Tessinensis, II. Seria Bohemica, 1.
SZYMECZEK, Józef, 2008. Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945–1950. Cieszyn.
SZYMECZEK, Józef, 2010: Vznik Československa a evangelíci augsburského vyznání v těšínském Slezsku 1918–1923. Český Těšín.
ŠAFÁŘ, Jiří. a kol., 2003. Olomoucko. In: MACKOVČIN Peter, SEDLÁČEK Miroslav (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp. ISBN 80-86064-46-8
ŠIGUT, František, 1968. Pokusy o zřízení biskupství v Opavě. Slezský sborník. 66, s. 526–527.
ŠIGUT, Josef, 1947. Církevně správní reformy na pruských hranicích po uzavření míru těšínského 1779. Slezský sborník. 47, s. 13–32.
ŠIMEČEK, Zdeněk, 1968. K počátkům novinářství v Opavě. Slezský sborník. 66(1), 40–59.
ŠÍL, Jiří. A5.14 Produkce letce Adolfa Warchalowského…. In: ŠOPÁK, Pavel a kolektiv: Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava, s. 116. ISBN 978-80-86224-91-6
ŠKUTA, Vladimír a Vávrovský, Emil (eds.), 1965. Partyzánská obec Morávka: několik vzpomínek na boje našeho lidu proti fašismu v letech 1939–1945. Frýdek-Místek: Okresní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků.
ŠOPÁK, Pavel a kol., 2011. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava: Slezské zemské muzeum. ISBN 978-80-86224-90-9.
ŠOPÁK, Pavel a kol., 2012. Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava: Slezské zemské muzeum. ISBN 978-80-86224-91-6.
ŠOPÁK, Pavel a kol., 2013. Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava. Slezsko: Lidé a země, III.
ŠOPÁK, Pavel, 2002. Mezi raciem a emocí. Stavby Franze Biely (1789–1871). Časopis Slezského zemského muzea, série B. 51(1), 60–72. ISSN 0323-0678.
ŠOPÁK, Pavel, 2003. Klasicistní architektura Opavy let 1780–1850. Opava: Matice Slezská. ISBN 80-903055-5-5.
ŠOPÁK, Pavel, 2014. Vzdálené ohlasy. Moderní architektura českého Slezska ve středoevropském kontextu. Sv. 1. Opava: Slezská univerzita. ISBN 978-80-7510-068-9.
ŠOPÁK, Pavel, 2015. Schillerův park ve Zlatých Horách. In: Jesenicko. Vlastivědný sborník 16. Jeseník, s. 36–37. ISSN 1213-0192
ŠRAJEROVÁ, Oľga, 2013. Marginalizácia sliezskej identity. In: SOUKUPOVÁ, Blanka, NOSKOVÁ, Helena a BEDNAŘÍK, Petr, ed., Paměť-národ-menšiny-marginalizace-identity 1. Praha, Urbánní studie, sv. 6, s. 71-86, ISBN 978-80-87398-50-0.
ŠRAJEROVÁ, Oľga, 2015. Historické a aktuálne otázky vývoja národnostných vzťahov, kultúr a identít v národnostne zmiešanej oblasti Sliezska a severenej Moravy. Slezsko: Pamäť -Identita- Region. Opava: Slezské zemské muzeum, ISBN 978-80-87789-29-2.
ŠRAJEROVÁ, Oľga, 2017. Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava). Človek a spoločnosť / Individual and Society [online]., 20(1), 1–21 [cit. 2021-02-08]. ISSN 13353608
ŠRAJEROVÁ, Oľga, 2019. Vývoj sliezskej identity - porovanie dlhodobých sociologických výskumov (1967-2018). In: Hruška, L., Šrajerová, O. eds., Regionální a národní identita. Recenzovaný sborník z mezinárodního odborného workshopu. Konaný dne 16.10.2019 v Českém Těšíně. Ostrava: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum z.ú.2019, ISBN 978-80-87955-08-6, s. 20-48.
ŠRAJEROVÁ, Oľga, ed., 2001. Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea. ISBN 80-86224-27-9.
ŠRAJEROVÁ, Oľga, ed., 2006. Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace. Opava ISBN 80-86224-60-0.
ŠRAJEROVÁ, Oľga, ed., 2003. České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky. Opava, ISBN 80-86101-70-3.
ŠTAFL, Adolf. Stavební řády moravské a stavební řád slezský s příslušnými zákony, nařízeními, výnosy, výkladem, poznámkami a judikaturou. V Praze: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1940. viii, 849 s. Právnická knihovna; sv. 54.
ŠTAIF, Jiří, 2005. Obezřetná elita 1830–1851. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. Praha: Dokořán. ISBN 80-7363-014-1.
ŠTARHA, Ivan, 2005. Přehled dějin správy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Moravský zemský archiv v Brně. ISBN 80-86931-02-1.
ŠTEFEK, Petr, Uhelné dráhy v Ostravsko – karvinském revíru. [online]. Dostupné na: http://spz.logout.cz/trate/bdr.html [cit. dne 29. 1. 2021].
ŠTEMBERK, Jan, 2010. Podnikání v českých zemích v automobilové dopravě v první polovině 20. století. Praha: Karolinum. Acta Uuniversitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia, 165. ISBN 978-80-246-1380-2.
ŠTĚPÁN, Miroslav, 1958. Přehledné dějiny československých železnic 1824–1948. Praha: Dopravní nakladatelství.
ŠTĚPÁN, Václav, 2009. Historie zámku Bruntál. Bruntál: Muzeum v Bruntále. ISBN 978-80-87038-12-3.
ŠÚSTKOVÁ, Hana, 2006. Biografický slovník poslanců slezského zemského sněmu v Opavě (1861–1918). Ostrava: Ostravská univerzita. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada 8 (20) – Supplementum. ISBN 80-7368-512-4.
ŠVÁBENICKÝ, František a kol., 2017. Troppau 1945: Opava v roce nula. Opava: Statutární město Opava. ISBN 978-80-7572-007-8.
TICHÁNEK, Jiří a kol., 2005. Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku. Kopřivnice. ISBN 80-7362-207-6.
TICHÁNEK, Jiří a ŠERÝ, Zdeněk, 2003. Šlechtická sídla na Novojičínsku. Opava: Butterfly. ISBN 80-239-1701-2.
TOMÁŠKOVÁ, Veronika, 2018. Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781–1861). Český Těšín.
TRAPL, Miloš, 2003. Změny církevní správy na Moravě a ve Slezsku v důsledku Modu vivendi z roku 1928. In: KORDIOVSKÝ, Emil a JAN, Libor (eds.): Vývoj církevní správy na Moravě. Brno, s. 151–154. XXVII. Mikulovské sympozium.
TVARŮŽEK, Břetislav, 1973. Operační cíl Ostrava. Ostrava: Profil.
TVRDÝ, L. a kol. (2007) Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-1665-4.
UHLÍŘ, Dušan, 2009. Exil vratislavského biskupa Filipa Gottharda Schaffgotsche na Jánském Vrchu. In: Jirásek, Zdeněk (ed.): Polská papežská nunciatura v Opavě (Slezsko v církevních dějinách 18. století). Opava, s. 25–30. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa, V.
VACEK, Bohumil (ed.), 1924. Zdravotní zpráva pro Moravu za leta 1911–1920. Sv. 30. Brno.
VACULÍK, Lukáš, 2015. Ohlas celostátní církevní politiky na Ostravsku v letech 1948–1953. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 29, s. 74–93.
VALENTA, Jaroslav, 1961. Česko-polské vztahy v letech 1918–1920 a Těšínské Slezsko. Ostrava: Krajské nakladatelství.
VANĚK, Josef, 1936. Silniční síť na Ostravsku. In: Technická práce na Ostravsku 1926–1936, s. 527–530.
VANĚK, Miroslav, 2010. Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1870-0.
VÁCLAVÍK, Josef, 2011. Četnická letecká hlídka v Dolním Benešově, Moravské Ostravě a Německém Brodě (Jihlavě) 1935–1939, část 1–3. Hobby historie 2 (7), s. 42–46, č. 8, s. 36-40 a č. 9, s. 40-44. ISSN 1804–2228
VENCÁLEK, Jaroslav, 1998. Protisměry územní identity, Ostrava, ISBN 80-86082-10-5.
WAGNER, Oskar, 2009. Kościół macierzysty wielu krajów. Historia Kościoła ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim w latach 1545–1918/20. Cieszyn.
WEISSBROD, Marek, 2009. Frýdecký zámek. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd. ISBN 978-80-86166-26-1.
WEISSMANNOVÁ, Helena a kol., 2004. Ostravsko. In: MACKOVČIN Peter, SEDLÁČEK Miroslav (eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Eko-Centrum Brno, Praha, 456 pp.
WIESNEROVÁ, Markéta, 2011. Bruntálský zámek Řádu německých rytířů – poslední středisko zámecké hudební kultury ve Slezsku na přelomu 18. a 19. století. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 60(2), 127–140. ISSN 0323-0678.
WOLNÝ, Gregor, 1862. Kirchliche Topographie von Mähren, meinst nach Urkunden und Handschriften. I/IV. Brünn.
ZAHRADNIK, Stanisław, 1989. Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowackich. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich. ISBN 83-85012-46-X.
Zaniklé tratě v Česku. [online]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/cestovani/po-cesku/zanikle-trate.K37105 [cit. dne 29. 1. 2021].
ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., 2020. Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914, 2 svazky. Ostrava: Ostravská univerzita, ISBN 978-80-7599-133-1.
ZÁVODNÁ, Michaela, 2011. Blízko a přece daleko! Dopravní spojení Ostravska s Hlučínskem v letech 1901–1938. Časopis Slezského zemského muzea, série B. (60)3, 255–274. ISSN 1211–3131.
ZÁVODNÁ, Michaela, 2016. Město a koleje. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850–1918. České Budějovice – Ostrava: Veduta, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7464-856-4.
ZÁVODNÁ, Michaela, 2016. Místní dráha Svinov–Klimovice (1896–1934). Historie jedné železniční "akciové společnosti" s důrazem na finanční aspekty podnikání v oblasti svépomocných místních drah rakouského Slezska. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. (7)2, 167–183. ISSN 1803-7550.
ZBRANEK, Tomáš Benedikt, 2011a. Apoštolská administratura českotěšínská. In: Kol.: Český Těšín 1920–1989. Válečné a poválečné osudy města. Opava. s. 110–122.
ZBRANEK, Tomáš Benedikt, 2011b. Apoštolský administrátor František Borgiáš Onderek. Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek. 12, s. 104–111.
ZBRANEK, Tomáš, Benedikt, 2008. Ordinář českotěšínský Antonín Veselý. Těšínsko. 51(2), s. 25–27.
ZICH, František, 2003. Regionální identita obyvatel v pohraničí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, ISBN 80-7330-039-7.
ZLÁMAL, Bohumil, 2009: Příručka českých církevních dějin. VI. Doba probuzenského katolicismu (1848–1918). Olomouc.
ZLÁMAL, Bohumil, 2010. Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918–1949). Olomouc.
ZMIJA, Karel, 1985. Doprava a komunikace v Ostravě. In: Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 13. Ostrava: Profil, s. 282–319.
ZUBER, Rudolf, 1966. Jesenicko v období feudalismu až do roku 1848. Ostrava.
ZUBER, Rudolf, 1987. Osudy moravské církve v 18. století. 1695–1777. 1. díl. Praha.
ZUBER, Rudolf, 2003. Osudy moravské církve v 18. století. 2. díl. Olomouc.
ZWACH, Ivan, 2009. Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing, a.s. Praha. ISBN 978-80-200-2984-3
ŽÁČEK, Rudolf, 2004. Dějiny Slezska v datech. Praha : Libri, ISBN 80-7277-245-7.
ŽÁČEK, Rudolf, 2005. Slezsko. Praha: Libri, ISBN 80-7277-245-7.
ŽÁČEK, Rudolf, 2011. K územní struktuře a organizaci církevní správy v československém Slezsku před ustanovením ostravsko-opavské diecéze (80. léta 20. století). In: ŽÁČEK, Rudolf a kol.: Ostravsko-opavská diecéze. Kořeny a souvislosti. Opava, s. 92–119.
ŽOLNERČÍK, Jan, STÁREK, František, KOSTÚR, Jiří, 2010. Baráky. Souostroví svobody. Praha: Pulchra. ISBN 978-80-87377-19-2.
MAHEL, Richard, 2013. Stanovení státní hranice ve Slezsku mezi podunajskou monarchií a pruským královstvím v letech 1742–1743, s přihlédnutím k Hlučínsku a Opavsku. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 3(2), 17–22. ISSN 1804-6967.
MACHAČOVÁ, Jana a ŠRAJEROVÁ, Oľga, ed., 2009. Slezský ústav SZM: profil - výzkum – perspektivy. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 4. a 5. listopadu 2008 v Opavě, Slezské zemské muzeum: Opava 2009, ISSN 0037-6833, 270 s. (vyšlo na CD jako příloha Slezského sborníku, č. 2/3.
MACHOVEC, Martin, 2008. Pohledy zevnitř. Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích. Praha: Pistoius & Olšanská. ISBN 978-80-87053-22-5.
MAKOWSKI, Mariusz, 2005. Szlacheckie siedziby na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego. ISBN 80-239-6051-2.
MATĚJ, K., 1926. Silniční síť na Ostravsku. In: Technická práce na Ostravsku, s. 517–524.
MATĚJ, Miloš, KLÁT, Jaroslav, KORBELÁŘOVÁ, Irena, 2009. Kulturní památky Ostravsko-karvinského revíru. Ostrava. ISBN 978-80-85034-52-3
MATĚJČEK, Jiří, STEINER, Jan, 1970: Vývoj počtu obyvatelstva ve Slezsku a na severovýchodní Moravě v letech 1910–1930. Slezský sborník. 68(3), 280–295. ISSN 0037-6833.
MATEJKO-PETERKA, Ilona et alii, 2016. Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea. Opava: Slezské zemské muzeum. ISBN 978-80-87789-39-1.
MIHOVÁ, Tereza a ŠOPÁK, Pavel, 2015. Nápisy na hrobech. Městský hřbitov v Opavě v letech 1789–1804. Opava: Slezská univerzita. ISBN 978-80-7510-175-4.
MICHEJDA, Karol, 1909. Dzieje kościoła ewangelickiego w księstwie Cieszyńskiem. Cieszyn.
MIKETOVÁ, Hana, MÜLLER, Karel a kol., 2012. Opavský zámek. Opava: Opavská kulturní organizace. ISBN 978-80-87632-01-7.
MIKOLÁŠ, Jaroslav Ludvík, 1930. Okolo biskupství Českého Slezska. Frýdek.
MLÍKOVSKÝ, Jiří, ed. a STÝBLO, Petr, ed., 2006. Nepůvodní druhy fauny a flóry České repub-liky. Praha: ČSOP. 496 s. ISBN 80-86770-17-6.
MOTYČKOVÁ, Hana, MOTYČKA, Vladimír, 2018. Přistěhovalci, emigranti a navrátilci I. Naše příroda 1, s. 40–52.
MOZOR, Karol, 2005. Miejsca pielgrzymkowe i szczególnego kultu na Śląsku Cieszyńskim w obecnych granicach Rzeczypospolitej. In: Lubos-Kozieł, Joanna a kol.: Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Wrocław, s. 520–539. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2846. Historia Sztuki, XXII.
MÜLLER, Karel B., 2007. Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity / Forming Positive Identities between the Past and the Future. A Contribution to the European Identity Project. Sociologický Časopis / Czech Sociological Review [online]., 43(4), 785 [cit. 2021-02-09]. ISSN 00380288.
MÜLLER, Karel, 2012. Heraldické památky Těšínska. Český Těšín: Muzeum Těšínska. ISBN 978-80-86696-30-0.
MÜLLER, Karel, POLÁCH, Radek a ZEZULČÍK, Jaroslav, 2008. Kamenné svědectví minulosti. Heraldické památky Novojičínska. Praha: Libri, Nový Jičín: Muzeum Novojičínska. ISBN 978-80-7277-360-2.
MUSIL, František a PLAČEK, Miroslav, 2003. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska. Praha: Libri. ISBN 80-7277-154-X.
MUSIL, František, 2015. Neznámé zámky Moravy a Slezska. Ostrava: Šmíra Print. ISBN 978-80-87427-97-2.
MYSZOR, Jerzy, 2000. Administracja kośćielna polskiego Śląska Zaolziańskiego 1938–1940. In: Chmiel, Peter a Drabina, Jan (eds.): Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien von Mittelater bis zur Gegenwart / Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności. Ratingen, s. 215–252. Tagungsreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 9.
MYŠKA, Milan, 1967. Migranti z Haliče a jejich podíl na vytváření dělnické třídy v uhelném průmyslu Moravské Ostravy v 2. polovině 19. století. In: Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 4. Ostrava: Profil, s. 147–181. ISSN 0232-0967.
MYŠKA, Milan, 1969. Historicko-demografická charakteristika západní části ostravské průmyslové oblasti na konci 19. století. In: Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 5. Ostrava: Profil, s. 86–97. ISSN 0232-0967.
MYŠKA, Milan, 2011. Hrabě Hodic a jeho svět. Zámecká kultura ve Slezsku mezi barokem a osvícenstvím. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7368-952-0.
NENIČKA, Lubomír, 2010. Druhá republika na Ostravsku 1938–1939. Opava: Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7248-600-7.
NENTWIG, Wolfgang (ed.), 2014. Nevítaní vetřelci. Nakladatelství Academia, Praha. ISBN 978-80-200-2316-2
NESLÁDKOVÁ, Ludmila, 2001. Židé v procesu proměny poddanského městečka Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 20. Ostrava: Tilia, s. 7–27. ISBN 80-86101-41-X.
NESLÁDKOVÁ, Ludmila, 2008. Profesní a sociální charakteristika židovské populace v Československu za první republiky. Demografie. 50(1), 1–14. ISSN 0011-8265.
NEŠPOR, Zdeněk R. a Vojtíšek, Zdeněk, 2015. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha.
NEŠPOR, Zdeněk R., 2009. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska. Praha.
NEUBAUEROVÁ, Michaela, 2008 Římskokatolická církev na Jesenicku v letech 1945–1956. Jesenicko. 9, s. 41–57.
NITRA, Tomáš, 2010. Ostravská letiště se zaměřením na stavební vývoj. Ostrava. ISBN 978-80-85034-56-1
NOWACK, Alfons, 1937. Schlesische Wallfahrtsorte älterer und neuer Zeit im Erzbistum Breslau. Breslau.
NOWAK, Krzysztof a kol., 2008. První nezávislost: Poláci v Těšínském Slezsku v roce 1918. Cieszyn: Biuro Promocji i Informacji, Urząd Miejski. ISBN 9788389835413.
NOWAK, Krzysztof a Panic, Idzi (eds.), 2013. Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918). Cieszyn. Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, V.
OTIPKA, Martin (ed.), 2010. Ostravsko-opavská operace 1945 v paměti českých veteránů: Ostravsko-opavskaja operacije 1945. Memuary češskich veteranov. Ostrava: Montanex. ISBN 978-80-7225-317-3.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena a kol., 2004. Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri. ISBN 80-7277-279-1.
PAŁKA, Elżbieta, 2007. Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej organizaci religijnej do Kościoła czeskiego. Wrocław.
PALLAS, Ladislav, 1970. Jazyková otázka a podmínky vytváření národního vědomí ve Slezsku. Ostrava: Profil.
Památník vydaný ku slavnosti odhalení pomníku, postaveného na hřbitově v Orlové padlým při obsazování Těšínska a za plebiscitu: 30.9.1928 za oslav 10letého výročí Republiky československé. 1928. Orlová.
PASEK, Zbigniew, 2000. Neopietyzm i wolne Kościoły na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku. In: CHMIEL, Peter a DRABINA, Jan (eds.): Die konfesionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart / Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesnosci. Ratingen, s. 155–172. Tagungsreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 9.
PATER, Józef, 1998. Wrocławska Kapituła Katedralna w XIII wieku. Wrocław.
PATER, Józef, 2000. Poczet biskupów wrocławskich. Wrocław.
PATZELT, Herbert, 1969. Der Pietismus im Teschener Schlesien 1709–1730. Göttingen.
PATZELT, Herbert, 1981. Anfänge der Toleranzzeit in Österreichisch-Schlesien. In: Barton, Peter F. (ed.): Im Lichte der Toleranz. Aufsätze zur Toleranzgesetzgebung des 18. Jahrhunderts in den Reichen Joseph II., ihren Voraussetzungen und ihren Folgen. Wien, s. 279–319.
PATZELT, Herbert, 1989. Geschichte der evangelischen Kirche in Österreichisch-Schlesien. Dülmen. Schriften der Stiftung Haus Oberschlesien, 5.
PAVELČÍK, František, 2012. Polní pilot letec Rudolf Škuta. Frýdek-Místek. ISBN 978-80-260-6266-0
PAVELČÍKOVÁ, Nina, 2013. Církevní život na Těšínsku jako objekt zájmu komunistického režimu. Časopis Matice moravské. 82(2), 407–443. ISSN 0323-052X.
PAVLÍČEK, Jaromír, 2003. Opavské Slezsko v boji proti nacistické okupaci 1938–1945. Opava: Matice Slezská. ISBN 80-903055-7-1.
PAVLÍČEK, Stanislav. 2002. Naše lokálky. Místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Dokořán. ISBN 80-86569-13-6.
PAVLOUSEK, Otakar, 1936. Silnice ze železa. In: Technická práce na Ostravsku 1926–1936, s. 542–559.
PERGL, Jan a kol., 2016. Black, Grey and Watch List of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. NeoBiota 28, s. 1–37. ISSN 1314-2488
PETR, Stanislav, 1995. Rukopisné fondy zámeckých a hradních knihoven na Moravě a ve Slezsku. In: KUBÍČEK, Jaromír (ed.). Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník ze 4. odborné konference Olomouc, 11.–12. října 1994.
PIĘTAK, Stanislav, PINDUR, David a SPRATEK, Daniel, 2020. Dějiny evangelíků na Těšínsku od reformace do tolerance. Český Těšín.
PINDUR, David, 2009. Přehled nejstarší církevně správní organizace Těšínska. Od středověku do vzniku generálního vikariátu v roce 1770. In: JIRÁSEK, Zdeněk (ed.): Polská papežská nunciatura v Opavě (Slezsko v církevních dějinách 18. století). Opava, s. 57–92.
PINDUR, David, 2011. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku / Bazylika Nawiedzenia Marii Panny we Frydku. Český Těšín.
PINDUR, David, 2015. Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654–1770. Struktury, procesy, lidé. Český Těšín. Studie o Těšínsku, 22.
PINDUR, David, 2016. Mons. Otto Furch. Významná osobnost římskokatolické církve na Těšínsku ve 20. století. Těšínsko 59(2), 37–50.
PINDUR, David, 2019. Úprava hranic farnosti Staré Hamry na podzim roku 1939. Příspěvek k dějinám církevní správy Slezska. Těšínsko 62(2), 37–60.
PINDUR, David, 2020. Náboženský vývoj od poloviny 19. století do současnosti. In: JEŽ, Radim, PINDUR, David a WAWRECZKA, Henryk: Český Těšín 1920–2020. Český Těšín – Ostrava – Třinec, s. 378–443.
PITRONOVÁ, Blanka, 1967. Vývoj lidnatosti v ostravské průmyslové oblasti v období jejího vzniku. Slezský sborník. 65(4), 442–454. ISSN 0037-6833.
PITRONOVÁ, Blanka, 1969. Vývoj lidnatosti ve Slezsku a na severovýchodní Moravě v období 1869–1910. Slezský sborník. 67(3), 313–335. ISSN 0037-6833.
PITRONOVÁ, Blanka, 1980. Vývoj národnostních poměrů pracovníků v hutnictví železa českých zemí v období 1880–1939. In: Hospodářské dějiny 5. Praha: Historický ústav ČSAV, s. 87–180.
PLAČEK, Miroslav, 2001. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri. ISBN 80-7277-036-5.
PLAČEK, Vilém, 2000. Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742–1960. Hlučín: Kulturní dům Hlučín, Kravaře: Kulturní středisko zámek Kravaře. ISBN 80-902526-5-6.
PLAČEK, Vilém, 2007. Prajzáci II aneb Hlučínsko ve staronové vlasti 1920–1938. Háj ve Slezsku: Maj-Tiskárna. ISBN 978-80-86458-24-3.
POKLUDOVÁ, Andrea a MORYS-TWAROWSKI, Michael, 2013. Opieka zdrowotna. In: Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. Tom V. Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918). Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, s. 397–415. ISBN 978-83-935147-3-1.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2005. Karel Jaromír Bukovanský – Pedagog, vlastivědný pracovník, archeolog, publicista a zakladatel českého muzejnictví ve Slezsku. Časopis slezského zemského muzea, Série B. 54, 26–52.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2007. Zprávy o zdravotních poměrech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století. In: DYRDA, J. M. a GRUSZKI, B. (eds.). Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle zasobów źródłowych. Katowice: Śląska Akademia Medyczna, s. 80–99. Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska, 11. ISSN 1231-4412.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2014. Frýdek a Místek v letech 1848–1918. In: Frýdek-Místek. Praha, s. 225–270.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2015. Pomníky – místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí. In: Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse. Opole: Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, s. 209–218. ISBN 978-83-7126-309-5.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2017. Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti rakouského Slezska 1848–1914. In: 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku. Opava, s. 11–35.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2018. Národnostní poměry Slezska a Ostravska. In: Slezsko a Ostravsko 1918–1938. Opava, s. 24–36.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2020. Proměny spolkového života. In: ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 626–634. ISBN 978-80-7599-133-1.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2020. Regionální tisk v procesu modernizace. In: ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 634–644. ISBN 978-80-7599-133-1.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2020. Rozvoj moderní samosprávy. In: ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 604–626. ISBN 978-80-7599-133-1.
POKLUDOVÁ, Andrea, 2020. Zdravotní stav populace. In: ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 953–1001. ISBN 978-80-7599-133-1.
POPELKA, Petr, 2011. Zrod moderní podnikatelstva: bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a Rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7368-841-7.
POPELKA, Petr, 2013. Hlavní problémy budování moderní silniční infrastruktury v českých zemích v době tereziánské a josefínské (na příkladu Slezsko-haličské silnice). Slezský sborník. 11(2), 211–236. ISSN 0037-6833.
POPELKA, Petr, 2013. Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7464-384-2.
POPELKA, Petr, 2015. Powstanie nowoczesnego transportu na Śląsku Austriackim 1742–1914. Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka. 70(3), 23–37. ISSN 0037-7511.
POTŮČKOVÁ, Martina, MAŇAS, Vladimír a ORLITA, Zdeněk, 2010. Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc.
PROKOP, Radim, 2005. Vodní díla, přehradní nádrže. In: Kulturněhistorická encyklopedie Slez-ska a severovýchodní Moravy. Ostrava, s. 394–395. ISBN 80-7368-024-6
RATAJ, Michael, 2016. Německá žurnalistika a opavští Němci v ČSR. Svědectví dobového tisku. Troppau. ISBN 978-80-270-0781-3.
RIEZNER, Jiří, 2008. Založení evangelického sboru v Holčovicích na Krnovsku. In: MACEK, Ondřej (ed.): Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. Praha, s. 114–125.
ROHÁČEK, Jindřich a kol., 2003. Příroda Slezska. Slezské zemské muzeum. Opava. ISBN 978-80-86224-95-4
RYGULA, Piotr, 2004. Uwarunkowania polityczno-prawne generalnego wikariatu. In: BUDNIAK, Józef a MOZOR, Karol (edd.). Kształtowanie tożsamości religijnej i kulturowej na Śląsku Cieszyńskim w latach działalności Książęco-Biskupiego Wikariatu Generalnego Księstwa Cieszyńskiego (1770–1925). Cieszyn, s. 49–67.
Ředitelství silnic a dálnic ČSR. [online]. Dostupné na: https://www.rsd.cz/wps/portal/ [cit. dne 30. 1. 2021]
ŘEHA, Tomáš, 2014. Města rakouského Slezska první poloviny 19. století nahlížené soudobými statisticko-topografickými prameny. Ostrava, Rukopis, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny.
ŘÍHA, Jiří (ed.), 1931. Zdravotnická ročenka československá 4. Praha: Piras.
SÁDLO, Jiří et al. Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. 3., upr. vyd. Praha: Malá skála, 2008. 255 s. ISBN 978-80-86776-06-4.
SAHEB, Jan, 2018. Strukturální proměny církevní správy rakouského Slezska na prahu modernismu. (K procesu transformace duchovní správy v 18. a v první polovině 19. století). In: VAŘEKA, Marek a ZÁŘICKÝ, Aleš (eds.). Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 54–66. ISBN 978-80-7599-046-4.
SAHEB, Jan, 2020. Náboženský život. In: ZÁŘICKÝ, Aleš (ed.). Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. 2. díl. Ostrava, s. 795–841.
SAMEK, Bohumil, 1994. Umělecké památky Moravy a Slezska. Sv. 1. Praha: Academia. ISBN 80-200-0474-2.
SAMEK, Bohumil, 1994. Umělecké památky Moravy a Slezska. Sv. 2. Praha: Academia. ISBN 80-200-0695-8.
SÁDLO, Jiří, STORCH, David, 2000. Biologie krajiny. Vesmír. Praha. ISBN 80-85977-31-1
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. [online]. Dostupné na: http://www.prodlouzena-rudna.cz/ [online]. [cit. dne 30. 1. 2021].
SEDLÁČEK, Kamil a kol., 1988. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. Díl 1. Ptáci. Státní zemědělské nakladatelství. Praha. ISBN 80-209-0036-5
SEPPELT, Franz Xaver, 1929. Geschichte des Bistums Breslau. Breslau.
SETTARI, Olga, 1992–1993. Zámek Jánský Vrch a město Javorník v minulosti. Příspěvek k hudební topografii Slezska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada hudebněvědná (H). 41–42(27–28), 45–53. ISSN 0231-522X.
SCHELLE, Karel, 2002. Vývoj veřejné správy v letech 1848–1948. Praha: Eurolex Bohemia. ISBN 80-86432-25-4.
SCHENKOVÁ, Marie, 2010. Poutní tradice v českém Slezsku. In: MIHOLA, Jiří (ed.). Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno, s. 83–98.
SCHIPP, Joseph Carl, 1828. Historisch-tographische Beschreibung des Breslauer k. k. Diöcesantheils. Teschen.
SCHIPP, Joseph Karl, 1821. Stand des Breslauer k. k. Diözesantheils mit endes des Jahrs 1820. Teschen.
SCHLÉE, Fidelis. Stavební řád pro Moravu a Slezsko s výkladem, judikaturou a vzorci. V Praze: [Nákladem "Sociální služby"], 1932. 340 s. Knihovna veřejné správy a samosprávy; Sv. 7.
SCHWARZ, Karl W., 2010. Superintendent Theodor Haase – ein Protestant aus dem Teschnerland. Aus Anlass seines 100. Todestages. In: CZYŻ, Renata, GOJNICZEK, Wacław a SPRATEK, Daniel (eds.): Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie. Cieszyn, s. 206–225.
Silnice země Moravskoslezské v pětiletém plánu obnovy, 1946. Brno: Zemský národní výbor v Brně.
SIWEK, Tadeusz a KAŇOK, Jaromír. Vědomí slezské identity v mentální mapě. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. 97 s. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity = Scripta Philosophicae Universitatis Ostraviensis; č. 136. ISBN 80-7042-576-8.
SIWEK, Tadeusz, BOGDOVÁ, Kamila, 2007. České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 43(4), 1039–1053.
SLÁDEK, Pavel, VAVŘAČOVÁ, Michaela a kol., 2014. Historie trati Ostrava-Svinov – Český Těšín. Místní dráha Svinov-Vítkovice – Těšín s odbočkou do Fryštátu. 100 let tratě Suchá ve Slezsku – Těšín. 50 let Polanecké spojky. Ostrava: Železniční muzeum moravskoslezské. Knihovna muzea č. 2. ISBN 978-80-905805-0-3.
SOKOLOVÁ, Gabriela, HERNOVÁ, Šárka a ŠRAJEROVÁ, Oľga, 1997. Češi, Slováci a Poláci na Těšínsku a jejich vzájemné vztahy. Opava: Slezský ústav SZM, ISBN 80-86101-03-7.
SPRATEK, Daniel, 2002. Právní poměry v evangelické církvi na Těšínsku v letech 1709–1781 a jejich vliv na uspořádání toleranční církve v Rakousku (2. díl). Revue církevního práva – Church Law Review. 22(2), 93–126. ISSN 1211-1635.
SPURNÝ, František a kol., 1983. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sv. 2. Severní Morava. Praha: Svoboda.
SPURNÝ, František, 2003. Počátky starokatolické církve na Moravě před 1. světovou válkou. In: In: KORDIOVSKÝ, Emil a JAN, Libor (eds.): Vývoj církevní správy na Moravě. Brno, s. 221–225. XXVII. Mikulovské sympozium.
SPYRA, Janusz a WODZIŃSKI, Marcin (eds.), 2001. Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku. Český Těšín.
SPYRA, Janusz, 2005. Źydzi na Śląsku Austriackim 1742–1918. Od tolerowanych Źydów do źydowskiej gminy vyznaniowej. Katowice: Muzeum Śląskie. ISBN 8387455148.
SPYRA, Janusz, 2009. Żydowskie gminy wyznaniowe na Śląsku Austriackim (1742–1918). Katowice.
SPYRA, Janusz, 2012. Śląsk Cieszyński w okresie 1653–1848. Cieszyn. Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych pod redakcją Idziego Panica, IV.
SPYRA, Janusz, 2015. Biografický slovník rabínů rakouského Slezska. Ostrava.
STANĚK, Tomáš, 1991. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha: Academia. ISBN 80-200-0328-2.
STANZEL, Josef G., 2007. Kirchliche Organisation, insbes. die Pfarreiorganisation im Freiwaldauer Gebiet vom 18. Jahrhundert bis Gegenwart. In: Historický seminář na téma Církevní život v dějinách Jesenicka. Sborník referátů. Jeseník, s. 18–26. VII. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku.
STAROSTA, Antonín, 1936. O spotřebě vody průmyslové na Ostravsku. In: Technická práce na Ostravsku 1926–1936. Vydáno k XVI. sjezdu československých inženýrů. Moravská Ostrava, s. 116–121.
STARÝ, Marek, 2007. Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1848. Praha: Vysoká škola finanční a správní. ISBN 978-80-86754-79-6.
SVĚRÁK, Tomáš, 1921. Květena ulic Opavských. Věstník Matice opavské 26, s. 50–54
SZYMECZEK, Józef (ed.), 2004. Stát, církev a národ v československé části těšínského Slezska (1945–1953). Český Těšín. Bibliotheca Tessinensis, II. Seria Bohemica, 1.
SZYMECZEK, Józef, 2008. Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945–1950. Cieszyn.
SZYMECZEK, Józef, 2010: Vznik Československa a evangelíci augsburského vyznání v těšínském Slezsku 1918–1923. Český Těšín.
ŠAFÁŘ, Jiří. a kol., 2003. Olomoucko. In: MACKOVČIN Peter, SEDLÁČEK Miroslav (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp. ISBN 80-86064-46-8
ŠIGUT, František, 1968. Pokusy o zřízení biskupství v Opavě. Slezský sborník. 66, s. 526–527.
ŠIGUT, Josef, 1947. Církevně správní reformy na pruských hranicích po uzavření míru těšínského 1779. Slezský sborník. 47, s. 13–32.
ŠIMEČEK, Zdeněk, 1968. K počátkům novinářství v Opavě. Slezský sborník. 66(1), 40–59.
ŠÍL, Jiří. A5.14 Produkce letce Adolfa Warchalowského…. In: ŠOPÁK, Pavel a kolektiv: Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava, s. 116. ISBN 978-80-86224-91-6
ŠKUTA, Vladimír a Vávrovský, Emil (eds.), 1965. Partyzánská obec Morávka: několik vzpomínek na boje našeho lidu proti fašismu v letech 1939–1945. Frýdek-Místek: Okresní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků.
ŠOPÁK, Pavel a kol., 2011. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava: Slezské zemské muzeum. ISBN 978-80-86224-90-9.
ŠOPÁK, Pavel a kol., 2012. Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava: Slezské zemské muzeum. ISBN 978-80-86224-91-6.
ŠOPÁK, Pavel a kol., 2013. Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava. Slezsko: Lidé a země, III.
ŠOPÁK, Pavel, 2002. Mezi raciem a emocí. Stavby Franze Biely (1789–1871). Časopis Slezského zemského muzea, série B. 51(1), 60–72. ISSN 0323-0678.
ŠOPÁK, Pavel, 2003. Klasicistní architektura Opavy let 1780–1850. Opava: Matice Slezská. ISBN 80-903055-5-5.
ŠOPÁK, Pavel, 2014. Vzdálené ohlasy. Moderní architektura českého Slezska ve středoevropském kontextu. Sv. 1. Opava: Slezská univerzita. ISBN 978-80-7510-068-9.
ŠOPÁK, Pavel, 2015. Schillerův park ve Zlatých Horách. In: Jesenicko. Vlastivědný sborník 16. Jeseník, s. 36–37. ISSN 1213-0192
ŠRAJEROVÁ, Oľga, 2013. Marginalizácia sliezskej identity. In: SOUKUPOVÁ, Blanka, NOSKOVÁ, Helena a BEDNAŘÍK, Petr, ed., Paměť-národ-menšiny-marginalizace-identity 1. Praha, Urbánní studie, sv. 6, s. 71-86, ISBN 978-80-87398-50-0.
ŠRAJEROVÁ, Oľga, 2015. Historické a aktuálne otázky vývoja národnostných vzťahov, kultúr a identít v národnostne zmiešanej oblasti Sliezska a severenej Moravy. Slezsko: Pamäť -Identita- Region. Opava: Slezské zemské muzeum, ISBN 978-80-87789-29-2.
ŠRAJEROVÁ, Oľga, 2017. Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava). Človek a spoločnosť / Individual and Society [online]., 20(1), 1–21 [cit. 2021-02-08]. ISSN 13353608
ŠRAJEROVÁ, Oľga, 2019. Vývoj sliezskej identity - porovanie dlhodobých sociologických výskumov (1967-2018). In: Hruška, L., Šrajerová, O. eds., Regionální a národní identita. Recenzovaný sborník z mezinárodního odborného workshopu. Konaný dne 16.10.2019 v Českém Těšíně. Ostrava: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum z.ú.2019, ISBN 978-80-87955-08-6, s. 20-48.
ŠRAJEROVÁ, Oľga, ed., 2001. Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea. ISBN 80-86224-27-9.
ŠRAJEROVÁ, Oľga, ed., 2006. Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace. Opava ISBN 80-86224-60-0.
ŠRAJEROVÁ, Oľga, ed., 2003. České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky. Opava, ISBN 80-86101-70-3.
ŠTAFL, Adolf. Stavební řády moravské a stavební řád slezský s příslušnými zákony, nařízeními, výnosy, výkladem, poznámkami a judikaturou. V Praze: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1940. viii, 849 s. Právnická knihovna; sv. 54.
ŠTAIF, Jiří, 2005. Obezřetná elita 1830–1851. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. Praha: Dokořán. ISBN 80-7363-014-1.
ŠTARHA, Ivan, 2005. Přehled dějin správy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Moravský zemský archiv v Brně. ISBN 80-86931-02-1.
ŠTEFEK, Petr, Uhelné dráhy v Ostravsko – karvinském revíru. [online]. Dostupné na: http://spz.logout.cz/trate/bdr.html [cit. dne 29. 1. 2021].
ŠTEMBERK, Jan, 2010. Podnikání v českých zemích v automobilové dopravě v první polovině 20. století. Praha: Karolinum. Acta Uuniversitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia, 165. ISBN 978-80-246-1380-2.
ŠTĚPÁN, Miroslav, 1958. Přehledné dějiny československých železnic 1824–1948. Praha: Dopravní nakladatelství.
ŠTĚPÁN, Václav, 2009. Historie zámku Bruntál. Bruntál: Muzeum v Bruntále. ISBN 978-80-87038-12-3.
ŠÚSTKOVÁ, Hana, 2006. Biografický slovník poslanců slezského zemského sněmu v Opavě (1861–1918). Ostrava: Ostravská univerzita. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada 8 (20) – Supplementum. ISBN 80-7368-512-4.
ŠVÁBENICKÝ, František a kol., 2017. Troppau 1945: Opava v roce nula. Opava: Statutární město Opava. ISBN 978-80-7572-007-8.
TICHÁNEK, Jiří a kol., 2005. Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku. Kopřivnice. ISBN 80-7362-207-6.
TICHÁNEK, Jiří a ŠERÝ, Zdeněk, 2003. Šlechtická sídla na Novojičínsku. Opava: Butterfly. ISBN 80-239-1701-2.
TOMÁŠKOVÁ, Veronika, 2018. Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781–1861). Český Těšín.
TRAPL, Miloš, 2003. Změny církevní správy na Moravě a ve Slezsku v důsledku Modu vivendi z roku 1928. In: KORDIOVSKÝ, Emil a JAN, Libor (eds.): Vývoj církevní správy na Moravě. Brno, s. 151–154. XXVII. Mikulovské sympozium.
TVARŮŽEK, Břetislav, 1973. Operační cíl Ostrava. Ostrava: Profil.
TVRDÝ, L. a kol. (2007) Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-1665-4.
UHLÍŘ, Dušan, 2009. Exil vratislavského biskupa Filipa Gottharda Schaffgotsche na Jánském Vrchu. In: Jirásek, Zdeněk (ed.): Polská papežská nunciatura v Opavě (Slezsko v církevních dějinách 18. století). Opava, s. 25–30. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa, V.
VACEK, Bohumil (ed.), 1924. Zdravotní zpráva pro Moravu za leta 1911–1920. Sv. 30. Brno.
VACULÍK, Lukáš, 2015. Ohlas celostátní církevní politiky na Ostravsku v letech 1948–1953. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 29, s. 74–93.
VALENTA, Jaroslav, 1961. Česko-polské vztahy v letech 1918–1920 a Těšínské Slezsko. Ostrava: Krajské nakladatelství.
VANĚK, Josef, 1936. Silniční síť na Ostravsku. In: Technická práce na Ostravsku 1926–1936, s. 527–530.
VANĚK, Miroslav, 2010. Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1870-0.
VÁCLAVÍK, Josef, 2011. Četnická letecká hlídka v Dolním Benešově, Moravské Ostravě a Německém Brodě (Jihlavě) 1935–1939, část 1–3. Hobby historie 2 (7), s. 42–46, č. 8, s. 36-40 a č. 9, s. 40-44. ISSN 1804–2228
VENCÁLEK, Jaroslav, 1998. Protisměry územní identity, Ostrava, ISBN 80-86082-10-5.
WAGNER, Oskar, 2009. Kościół macierzysty wielu krajów. Historia Kościoła ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim w latach 1545–1918/20. Cieszyn.
WEISSBROD, Marek, 2009. Frýdecký zámek. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd. ISBN 978-80-86166-26-1.
WEISSMANNOVÁ, Helena a kol., 2004. Ostravsko. In: MACKOVČIN Peter, SEDLÁČEK Miroslav (eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Eko-Centrum Brno, Praha, 456 pp.
WIESNEROVÁ, Markéta, 2011. Bruntálský zámek Řádu německých rytířů – poslední středisko zámecké hudební kultury ve Slezsku na přelomu 18. a 19. století. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 60(2), 127–140. ISSN 0323-0678.
WOLNÝ, Gregor, 1862. Kirchliche Topographie von Mähren, meinst nach Urkunden und Handschriften. I/IV. Brünn.
ZAHRADNIK, Stanisław, 1989. Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowackich. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich. ISBN 83-85012-46-X.
Zaniklé tratě v Česku. [online]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/cestovani/po-cesku/zanikle-trate.K37105 [cit. dne 29. 1. 2021].
ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., 2020. Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914, 2 svazky. Ostrava: Ostravská univerzita, ISBN 978-80-7599-133-1.
ZÁVODNÁ, Michaela, 2011. Blízko a přece daleko! Dopravní spojení Ostravska s Hlučínskem v letech 1901–1938. Časopis Slezského zemského muzea, série B. (60)3, 255–274. ISSN 1211–3131.
ZÁVODNÁ, Michaela, 2016. Město a koleje. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850–1918. České Budějovice – Ostrava: Veduta, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7464-856-4.
ZÁVODNÁ, Michaela, 2016. Místní dráha Svinov–Klimovice (1896–1934). Historie jedné železniční "akciové společnosti" s důrazem na finanční aspekty podnikání v oblasti svépomocných místních drah rakouského Slezska. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. (7)2, 167–183. ISSN 1803-7550.
ZBRANEK, Tomáš Benedikt, 2011a. Apoštolská administratura českotěšínská. In: Kol.: Český Těšín 1920–1989. Válečné a poválečné osudy města. Opava. s. 110–122.
ZBRANEK, Tomáš Benedikt, 2011b. Apoštolský administrátor František Borgiáš Onderek. Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek. 12, s. 104–111.
ZBRANEK, Tomáš, Benedikt, 2008. Ordinář českotěšínský Antonín Veselý. Těšínsko. 51(2), s. 25–27.
ZICH, František, 2003. Regionální identita obyvatel v pohraničí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, ISBN 80-7330-039-7.
ZLÁMAL, Bohumil, 2009: Příručka českých církevních dějin. VI. Doba probuzenského katolicismu (1848–1918). Olomouc.
ZLÁMAL, Bohumil, 2010. Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918–1949). Olomouc.
ZMIJA, Karel, 1985. Doprava a komunikace v Ostravě. In: Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 13. Ostrava: Profil, s. 282–319.
ZUBER, Rudolf, 1966. Jesenicko v období feudalismu až do roku 1848. Ostrava.
ZUBER, Rudolf, 1987. Osudy moravské církve v 18. století. 1695–1777. 1. díl. Praha.
ZUBER, Rudolf, 2003. Osudy moravské církve v 18. století. 2. díl. Olomouc.
ZWACH, Ivan, 2009. Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing, a.s. Praha. ISBN 978-80-200-2984-3
ŽÁČEK, Rudolf, 2004. Dějiny Slezska v datech. Praha : Libri, ISBN 80-7277-245-7.
ŽÁČEK, Rudolf, 2005. Slezsko. Praha: Libri, ISBN 80-7277-245-7.
ŽÁČEK, Rudolf, 2011. K územní struktuře a organizaci církevní správy v československém Slezsku před ustanovením ostravsko-opavské diecéze (80. léta 20. století). In: ŽÁČEK, Rudolf a kol.: Ostravsko-opavská diecéze. Kořeny a souvislosti. Opava, s. 92–119.
ŽOLNERČÍK, Jan, STÁREK, František, KOSTÚR, Jiří, 2010. Baráky. Souostroví svobody. Praha: Pulchra. ISBN 978-80-87377-19-2.